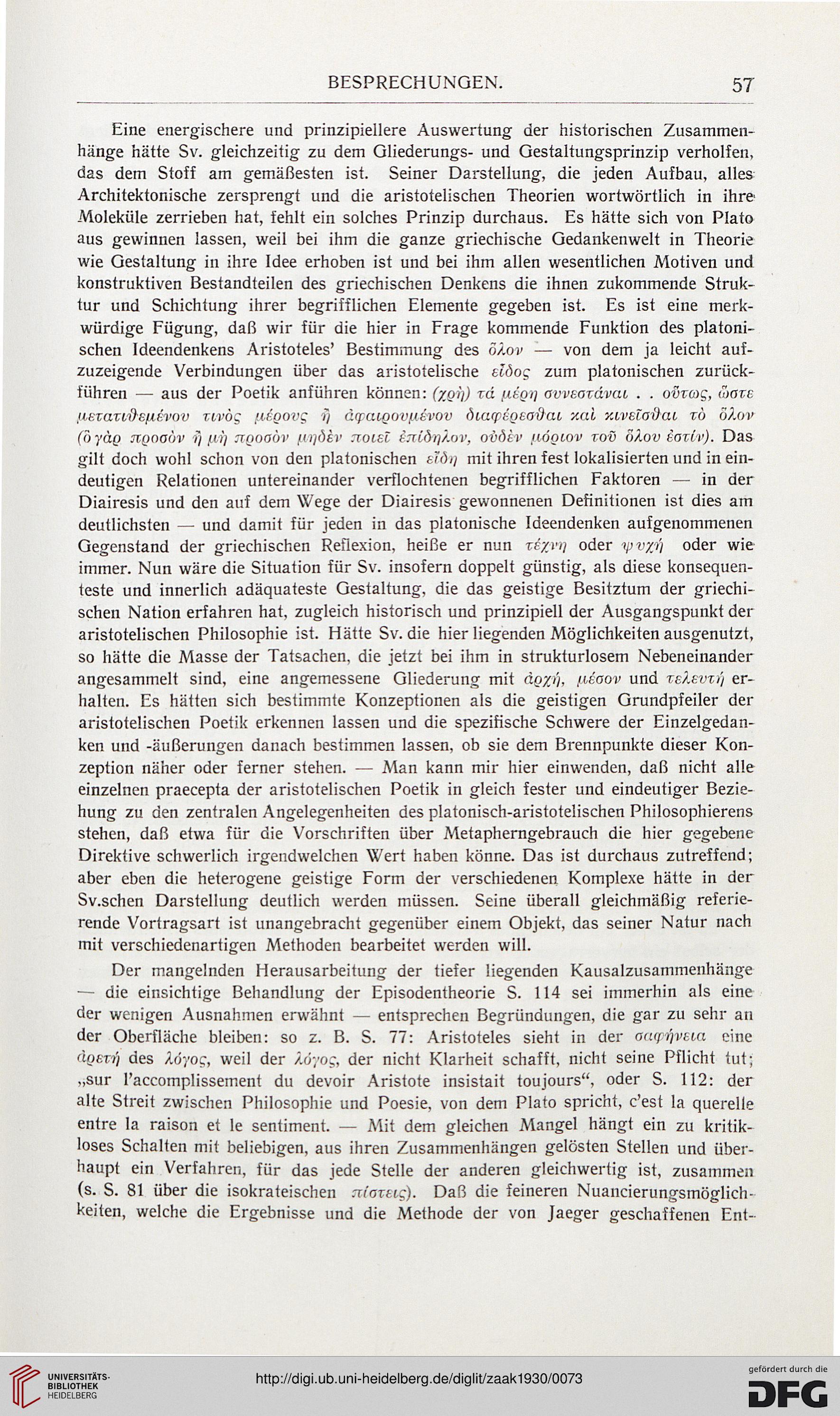BESPRECHUNGEN.
57
Eine energischere und prinzipiellere Auswertung der historischen Zusammen-
hänge hätte Sv. gleichzeitig zu dem Gliederungs- und Gestaltungsprinzip verholfen,
das dem Stoff am gemäßesten ist. Seiner Darstellung, die jeden Aufbau, alles
Architektonische zersprengt und die aristotelischen Theorien wortwörtlich in ihre
Moleküle zerrieben hat, fehlt ein solches Prinzip durchaus. Es hätte sich von Plato
aus gewinnen lassen, weil bei ihm die ganze griechische Gedankenwelt in Theorie
wie Gestaltung in ihre Idee erhoben ist und bei ihm allen wesentlichen Motiven und
konstruktiven Bestandteilen des griechischen Denkens die ihnen zukommende Struk-
tur und Schichtung ihrer begrifflichen Elemente gegeben ist. Es ist eine merk-
würdige Fügung, daß wir für die hier in Frage kommende Funktion des platoni-
schen Ideendenkens Aristoteles' Bestimmung des ö/.ov — von dem ja leicht auf-
zuzeigende Verbindungen über das aristotelische eldog zum platonischen zurück-
führen — aus der Poetik anführen können: (xQi}) fd ixkqi) avveazdvat . . ovvcag, waze
jiezatii}efi£v<)v zvvög uKoovg V d(patQOVfi&vov dutq>£Qea&ai xal r.iveiadat, tö öAov
(oyäQ jTQoauv j) fir] xqooöv /nidev .-rot« inldrjÄjov, ovdiv /wgiov zov ökov toziv). Das
gilt doch wohl schon von den platonischen eldr} mit ihren fest lokalisierten und in ein-
deutigen Relationen untereinander verflochtenen begrifflichen Faktoren — in der
Diairesis und den auf dem Wege der Diairesis gewonnenen Definitionen ist dies am
deutlichsten — und damit für jeden in das platonische Ideendenken aufgenommenen
Gegenstand der griechischen Reflexion, heiße er nun xt/y)} oder ipvztf oder wie
immer. Nun wäre die Situation für Sv. insofern doppelt günstig, als diese konsequen-
teste und innerlich adäquateste Gestaltung, die das geistige Besitztum der griechi-
schen Nation erfahren hat, zugleich historisch und prinzipiell der Ausgangspunkt der
aristotelischen Philosophie ist. Hätte Sv. die hier liegenden Möglichkeiten ausgenutzt,
so hätte die Masse der Tatsachen, die jetzt bei ihm in strukturlosem Nebeneinander
angesammelt sind, eine angemessene Gliederung mit ägy/i, /leaov und re/.evzi) er-
halten. Es hätten sich bestimmte Konzeptionen als die geistigen Grundpfeiler der
aristotelischen Poetik erkennen lassen und die spezifische Schwere der Einzelgedan-
ken und -äußerungen danach bestimmen lassen, ob sie dem Brennpunkte dieser Kon-
zeption näher oder ferner stehen. — Man kann mir hier einwenden, daß nicht alle
einzelnen praecepta der aristotelischen Poetik in gleich fester und eindeutiger Bezie-
hung zu den zentralen Angelegenheiten des platonisch-aristotelischen Philosophierens
stehen, daß etwa für die Vorschriften über Metapherngebrauch die hier gegebene
Direktive schwerlich irgendwelchen Wert haben könne. Das ist durchaus zutreffend;
aber eben die heterogene geistige Form der verschiedenen Komplexe hätte in der
Sv.schen Darstellung deutlich werden müssen. Seine überall gleichmäßig referie-
rende Vortragsart ist unangebracht gegenüber einem Objekt, das seiner Natur nach
mit verschiedenartigen Methoden bearbeitet werden will.
Der mangelnden Herausarbeitung der tiefer liegenden Kausalzusammenhänge
— die einsichtige Behandlung der Episodentheorie S. 114 sei immerhin als eine
der wenigen Ausnahmen erwähnt — entsprechen Begründungen, die gar zu sehr au
der Oberfläche bleiben: so z. B. S. 77: Aristoteles sieht in der aag^veux eine
doerj} des Xöyog, weil der Xdyog, der nicht Klarheit schafft, nicht seine Pflicht tut;
„sur raccomplissement du devoir Aristote insistait toujours", oder S. 112: der
alte Streit zwischen Philosophie und Poesie, von dem Plato spricht, c'est la querelle
entre Ia raison et le sentiment. — Mit dem gleichen Mangel hängt ein zu kritik-
loses Schalten mit beliebigen, aus ihren Zusammenhängen gelösten Stellen und über-
haupt ein Verfahren, für das jede Stelle der anderen gleichwertig ist, zusammen
(s. S. 81 über die isokrateischen xiorug). Daß die feineren Nuancierungsmöglich-
keiten, welche die Ergebnisse und die Methode der von Jaeger geschaffenen Ent-
57
Eine energischere und prinzipiellere Auswertung der historischen Zusammen-
hänge hätte Sv. gleichzeitig zu dem Gliederungs- und Gestaltungsprinzip verholfen,
das dem Stoff am gemäßesten ist. Seiner Darstellung, die jeden Aufbau, alles
Architektonische zersprengt und die aristotelischen Theorien wortwörtlich in ihre
Moleküle zerrieben hat, fehlt ein solches Prinzip durchaus. Es hätte sich von Plato
aus gewinnen lassen, weil bei ihm die ganze griechische Gedankenwelt in Theorie
wie Gestaltung in ihre Idee erhoben ist und bei ihm allen wesentlichen Motiven und
konstruktiven Bestandteilen des griechischen Denkens die ihnen zukommende Struk-
tur und Schichtung ihrer begrifflichen Elemente gegeben ist. Es ist eine merk-
würdige Fügung, daß wir für die hier in Frage kommende Funktion des platoni-
schen Ideendenkens Aristoteles' Bestimmung des ö/.ov — von dem ja leicht auf-
zuzeigende Verbindungen über das aristotelische eldog zum platonischen zurück-
führen — aus der Poetik anführen können: (xQi}) fd ixkqi) avveazdvat . . ovvcag, waze
jiezatii}efi£v<)v zvvög uKoovg V d(patQOVfi&vov dutq>£Qea&ai xal r.iveiadat, tö öAov
(oyäQ jTQoauv j) fir] xqooöv /nidev .-rot« inldrjÄjov, ovdiv /wgiov zov ökov toziv). Das
gilt doch wohl schon von den platonischen eldr} mit ihren fest lokalisierten und in ein-
deutigen Relationen untereinander verflochtenen begrifflichen Faktoren — in der
Diairesis und den auf dem Wege der Diairesis gewonnenen Definitionen ist dies am
deutlichsten — und damit für jeden in das platonische Ideendenken aufgenommenen
Gegenstand der griechischen Reflexion, heiße er nun xt/y)} oder ipvztf oder wie
immer. Nun wäre die Situation für Sv. insofern doppelt günstig, als diese konsequen-
teste und innerlich adäquateste Gestaltung, die das geistige Besitztum der griechi-
schen Nation erfahren hat, zugleich historisch und prinzipiell der Ausgangspunkt der
aristotelischen Philosophie ist. Hätte Sv. die hier liegenden Möglichkeiten ausgenutzt,
so hätte die Masse der Tatsachen, die jetzt bei ihm in strukturlosem Nebeneinander
angesammelt sind, eine angemessene Gliederung mit ägy/i, /leaov und re/.evzi) er-
halten. Es hätten sich bestimmte Konzeptionen als die geistigen Grundpfeiler der
aristotelischen Poetik erkennen lassen und die spezifische Schwere der Einzelgedan-
ken und -äußerungen danach bestimmen lassen, ob sie dem Brennpunkte dieser Kon-
zeption näher oder ferner stehen. — Man kann mir hier einwenden, daß nicht alle
einzelnen praecepta der aristotelischen Poetik in gleich fester und eindeutiger Bezie-
hung zu den zentralen Angelegenheiten des platonisch-aristotelischen Philosophierens
stehen, daß etwa für die Vorschriften über Metapherngebrauch die hier gegebene
Direktive schwerlich irgendwelchen Wert haben könne. Das ist durchaus zutreffend;
aber eben die heterogene geistige Form der verschiedenen Komplexe hätte in der
Sv.schen Darstellung deutlich werden müssen. Seine überall gleichmäßig referie-
rende Vortragsart ist unangebracht gegenüber einem Objekt, das seiner Natur nach
mit verschiedenartigen Methoden bearbeitet werden will.
Der mangelnden Herausarbeitung der tiefer liegenden Kausalzusammenhänge
— die einsichtige Behandlung der Episodentheorie S. 114 sei immerhin als eine
der wenigen Ausnahmen erwähnt — entsprechen Begründungen, die gar zu sehr au
der Oberfläche bleiben: so z. B. S. 77: Aristoteles sieht in der aag^veux eine
doerj} des Xöyog, weil der Xdyog, der nicht Klarheit schafft, nicht seine Pflicht tut;
„sur raccomplissement du devoir Aristote insistait toujours", oder S. 112: der
alte Streit zwischen Philosophie und Poesie, von dem Plato spricht, c'est la querelle
entre Ia raison et le sentiment. — Mit dem gleichen Mangel hängt ein zu kritik-
loses Schalten mit beliebigen, aus ihren Zusammenhängen gelösten Stellen und über-
haupt ein Verfahren, für das jede Stelle der anderen gleichwertig ist, zusammen
(s. S. 81 über die isokrateischen xiorug). Daß die feineren Nuancierungsmöglich-
keiten, welche die Ergebnisse und die Methode der von Jaeger geschaffenen Ent-