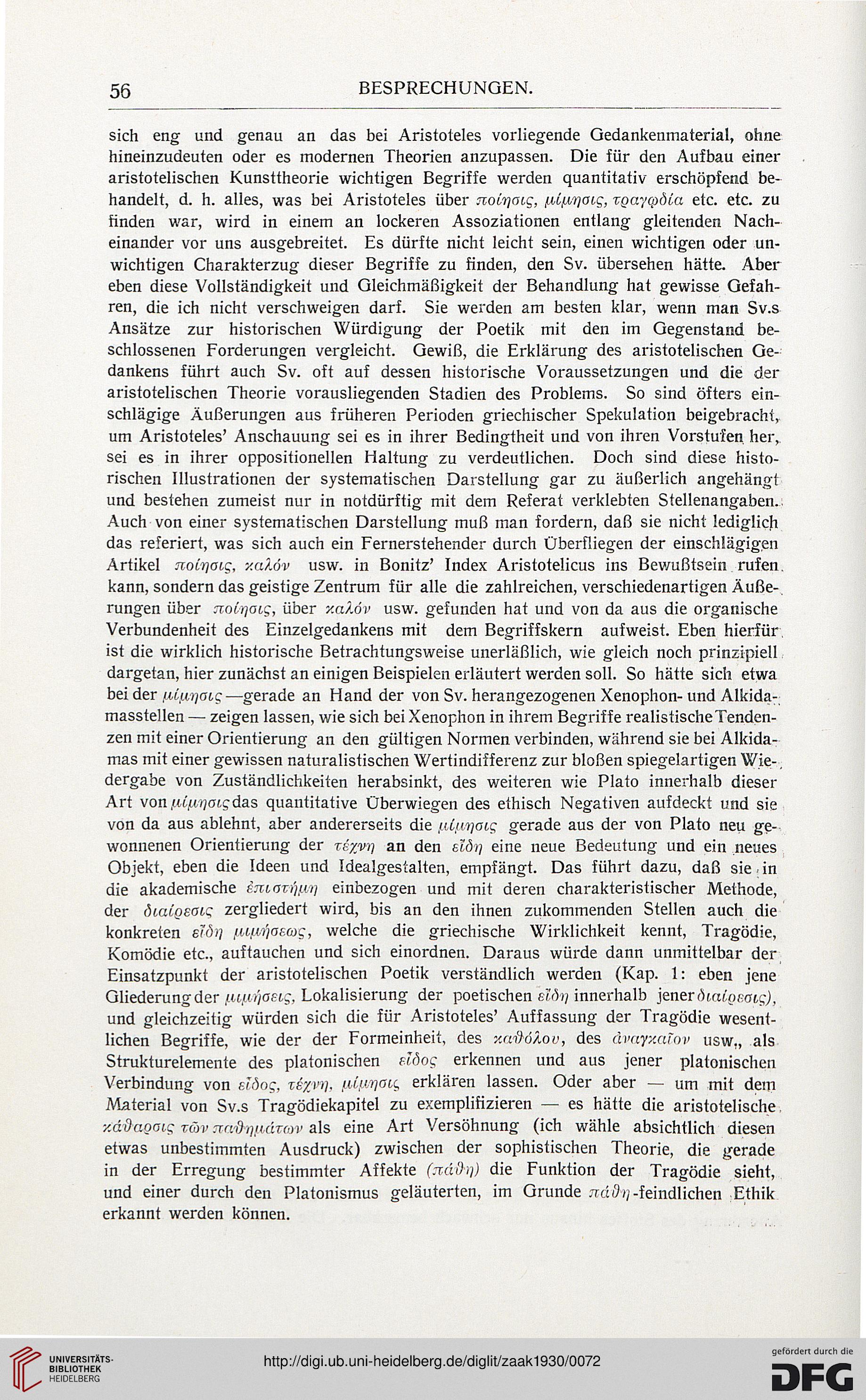56
BESPRECHUNGEN.
sich eng und genau an das bei Aristoteles vorliegende Gedankenmaterial, ohne
hineinzudeuten oder es modernen Theorien anzupassen. Die für den Aufbau einer
aristotelischen Kunsttheorie wichtigen Begriffe werden quantitativ erschöpfend be-
handelt, d. h. alles, was bei Aristoteles über noh]ocg, nL^rjoig, zga-/q>dia etc. etc. zu
finden war, wird in einem an lockeren Assoziationen entlang gleitenden Nach-
einander vor uns ausgebreitet. Es dürfte nicht leicht sein, einen wichtigen oder un-
wichtigen Charakterzug dieser Begriffe zu finden, den Sv. übersehen hätte. Aber
eben diese Vollständigkeit und Gleichmäßigkeit der Behandlung hat gewisse Gefah-
ren, die ich nicht verschweigen darf. Sie werden am besten klar, wenn man Sv.s
Ansätze zur historischen Würdigung der Poetik mit den im Gegenstand be-
schlossenen Forderungen vergleicht. Gewiß, die Erklärung des aristotelischen Ge-
dankens führt auch Sv. oft auf dessen historische Voraussetzungen und die der
aristotelischen Theorie vorausliegenden Stadien des Problems. So sind öfters ein-
schlägige Äußerungen aus früheren Perioden griechischer Spekulation beigebracht,
um Aristoteles' Anschauung sei es in ihrer Bedingtheit und von ihren Vorstufen her,
sei es in ihrer oppositionellen Haltung zu verdeutlichen. Doch sind diese histo-
rischen Illustrationen der systematischen Darstellung gar zu äußerlich angehängt
und bestehen zumeist nur in notdürftig mit dem Referat verklebten Stellenangaben..
Auch von einer systematischen Darstellung muß man fordern, daß sie nicht lediglich
das referiert, was sich auch ein Fernerstehender durch Überfliegen der einschlägigen
Artikel jtomjoic, xaXöv usw. in Bonitz' Index Aristotelicus ins Bev/ußtsein rufen,
kann, sondern das geistige Zentrum für alle die zahlreichen, verschiedenartigen Äuße-
rungen über noh)Ois> über r.a/.öv usw. gefunden hat und von da aus die organische
Verbundenheit des Einzelgedankens mit dem Begriffskern aufweist. Eben hierfür
ist die wirklich historische Betrachtungsweise unerläßlich, wie gleich noch prinzipiell
dargetan, hier zunächst an einigen Beispielen erläutert werden soll. So hätte sich etwa
bei der //iuijcftc—gerade an Hand der von Sv. herangezogenen Xenophon- und Alkida-
masstellen — zeigen lassen, wie sich bei Xenophon in ihrem Begriffe realistische Tenden-
zen mit einer Orientierung an den gültigen Normen verbinden, während sie bei Alkida-
mas mit einer gewissen naturalistischen Wertindifferenz zur bloßen spiegelartigen Wie-,
dergabe von Zuständlichkeiten herabsinkt, des weiteren wie Plato innerhalb dieser
Art von,tu/«)cricdas quantitative Überwiegen des ethisch Negativen aufdeckt und sie
von da aus ablehnt, aber andererseits die fitfirjaig gerade aus der von Plato neu ge-
wonnenen Orientierung der %£%w\ an den eldy eine neue Bedeutung und ein neues
Objekt, eben die Ideen und Idealgestalten, empfängt. Das führt dazu, daß sie in
die akademische imovifjiM} einbezogen und mit deren charakteristischer Methode,
der diaigeoig zergliedert wird, bis an den ihnen zukommenden Stellen auch die
konkreten eldii [U/M/joems, welche die griechische Wirklichkeit kennt, Tragödie,
Komödie etc., auftauchen und sich einordnen. Daraus würde dann unmittelbar der
Einsatzpunkt der aristotelischen Poetik verständlich werden (Kap. 1: eben jene
Gliederung der (UiMfjoeig, Lokalisierung der poetischen sM fj innerhalb jener öiaiosoig),
und gleichzeitig würden sich die für Aristoteles' Auffassung der Tragödie wesent-
lichen Begriffe, wie der der Formeinheit, des y.m'MÄou, des ävayxaiov usw., als.
Strukturelemente des platonischen döog erkennen und aus jener platonischen
Verbindung von sldog, %&%<m, W'^crtc erklären lassen. Oder aber — um mit dem
Material von Sv.s Tragödiekapitel zu exemplifizieren — es hätte die aristotelische
XdftaQOiq töv nad^fi&c&v als eine Art Versöhnung (ich wähle absichtlich diesen
etwas unbestimmten Ausdruck) zwischen der sophistischen Theorie, die gerade
in der Erregung bestimmter Affekte (adftr)) die Funktion der Tragödie sieht,
und einer durch den Piatonismus geläuterten, im Grunde nd-feindlichen Ethik
erkannt werden können.
BESPRECHUNGEN.
sich eng und genau an das bei Aristoteles vorliegende Gedankenmaterial, ohne
hineinzudeuten oder es modernen Theorien anzupassen. Die für den Aufbau einer
aristotelischen Kunsttheorie wichtigen Begriffe werden quantitativ erschöpfend be-
handelt, d. h. alles, was bei Aristoteles über noh]ocg, nL^rjoig, zga-/q>dia etc. etc. zu
finden war, wird in einem an lockeren Assoziationen entlang gleitenden Nach-
einander vor uns ausgebreitet. Es dürfte nicht leicht sein, einen wichtigen oder un-
wichtigen Charakterzug dieser Begriffe zu finden, den Sv. übersehen hätte. Aber
eben diese Vollständigkeit und Gleichmäßigkeit der Behandlung hat gewisse Gefah-
ren, die ich nicht verschweigen darf. Sie werden am besten klar, wenn man Sv.s
Ansätze zur historischen Würdigung der Poetik mit den im Gegenstand be-
schlossenen Forderungen vergleicht. Gewiß, die Erklärung des aristotelischen Ge-
dankens führt auch Sv. oft auf dessen historische Voraussetzungen und die der
aristotelischen Theorie vorausliegenden Stadien des Problems. So sind öfters ein-
schlägige Äußerungen aus früheren Perioden griechischer Spekulation beigebracht,
um Aristoteles' Anschauung sei es in ihrer Bedingtheit und von ihren Vorstufen her,
sei es in ihrer oppositionellen Haltung zu verdeutlichen. Doch sind diese histo-
rischen Illustrationen der systematischen Darstellung gar zu äußerlich angehängt
und bestehen zumeist nur in notdürftig mit dem Referat verklebten Stellenangaben..
Auch von einer systematischen Darstellung muß man fordern, daß sie nicht lediglich
das referiert, was sich auch ein Fernerstehender durch Überfliegen der einschlägigen
Artikel jtomjoic, xaXöv usw. in Bonitz' Index Aristotelicus ins Bev/ußtsein rufen,
kann, sondern das geistige Zentrum für alle die zahlreichen, verschiedenartigen Äuße-
rungen über noh)Ois> über r.a/.öv usw. gefunden hat und von da aus die organische
Verbundenheit des Einzelgedankens mit dem Begriffskern aufweist. Eben hierfür
ist die wirklich historische Betrachtungsweise unerläßlich, wie gleich noch prinzipiell
dargetan, hier zunächst an einigen Beispielen erläutert werden soll. So hätte sich etwa
bei der //iuijcftc—gerade an Hand der von Sv. herangezogenen Xenophon- und Alkida-
masstellen — zeigen lassen, wie sich bei Xenophon in ihrem Begriffe realistische Tenden-
zen mit einer Orientierung an den gültigen Normen verbinden, während sie bei Alkida-
mas mit einer gewissen naturalistischen Wertindifferenz zur bloßen spiegelartigen Wie-,
dergabe von Zuständlichkeiten herabsinkt, des weiteren wie Plato innerhalb dieser
Art von,tu/«)cricdas quantitative Überwiegen des ethisch Negativen aufdeckt und sie
von da aus ablehnt, aber andererseits die fitfirjaig gerade aus der von Plato neu ge-
wonnenen Orientierung der %£%w\ an den eldy eine neue Bedeutung und ein neues
Objekt, eben die Ideen und Idealgestalten, empfängt. Das führt dazu, daß sie in
die akademische imovifjiM} einbezogen und mit deren charakteristischer Methode,
der diaigeoig zergliedert wird, bis an den ihnen zukommenden Stellen auch die
konkreten eldii [U/M/joems, welche die griechische Wirklichkeit kennt, Tragödie,
Komödie etc., auftauchen und sich einordnen. Daraus würde dann unmittelbar der
Einsatzpunkt der aristotelischen Poetik verständlich werden (Kap. 1: eben jene
Gliederung der (UiMfjoeig, Lokalisierung der poetischen sM fj innerhalb jener öiaiosoig),
und gleichzeitig würden sich die für Aristoteles' Auffassung der Tragödie wesent-
lichen Begriffe, wie der der Formeinheit, des y.m'MÄou, des ävayxaiov usw., als.
Strukturelemente des platonischen döog erkennen und aus jener platonischen
Verbindung von sldog, %&%<m, W'^crtc erklären lassen. Oder aber — um mit dem
Material von Sv.s Tragödiekapitel zu exemplifizieren — es hätte die aristotelische
XdftaQOiq töv nad^fi&c&v als eine Art Versöhnung (ich wähle absichtlich diesen
etwas unbestimmten Ausdruck) zwischen der sophistischen Theorie, die gerade
in der Erregung bestimmter Affekte (adftr)) die Funktion der Tragödie sieht,
und einer durch den Piatonismus geläuterten, im Grunde nd-feindlichen Ethik
erkannt werden können.