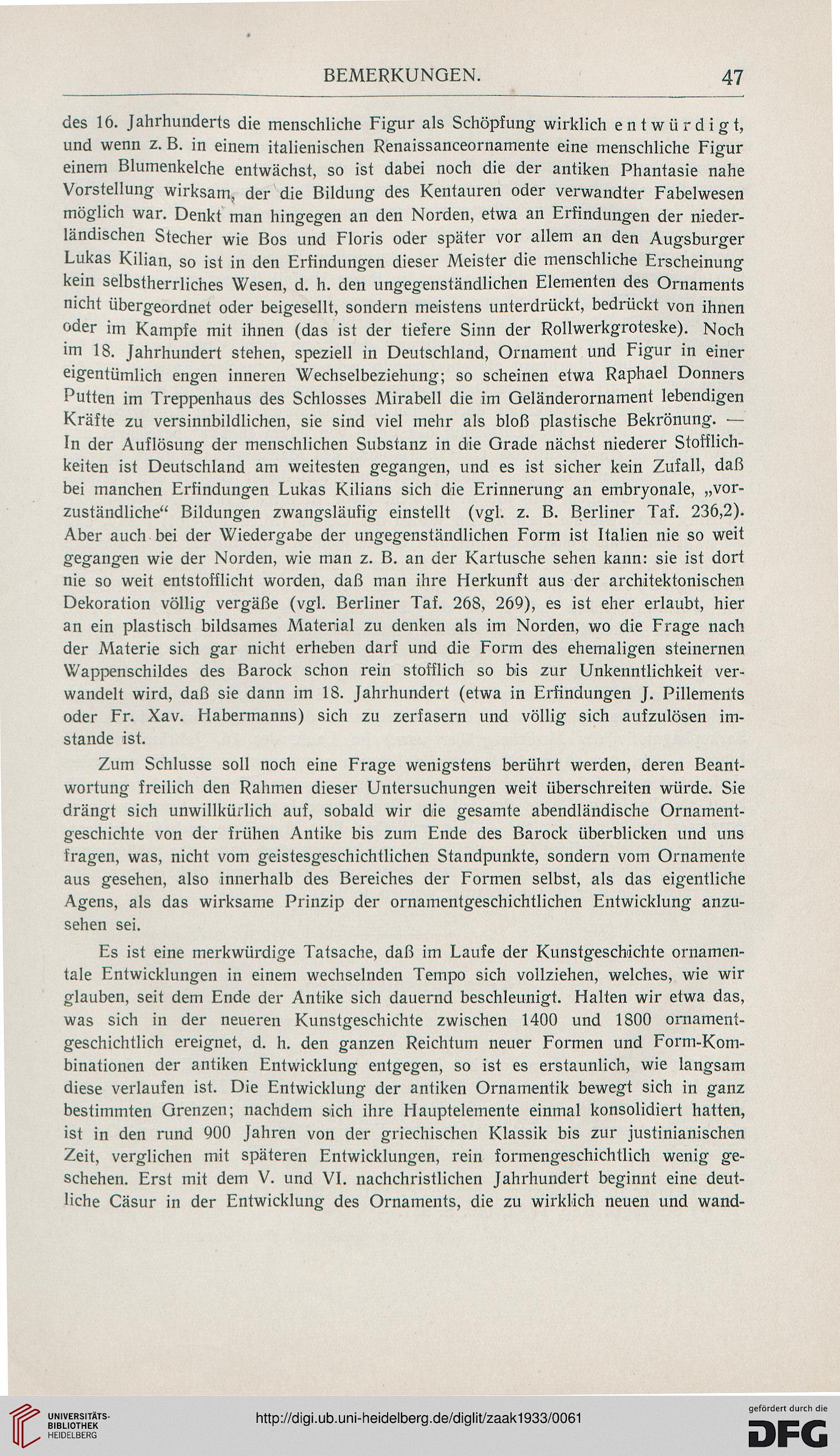BEMERKUNGEN.
47
des 16. Jahrhunderts die menschliche Figur als Schöpfung wirklich entwürdigt,
und wenn z. B. in einem italienischen Renaissanceornamente eine menschliche Figur
einem Blumenkelche entwächst, so ist dabei noch die der antiken Phantasie nahe
Vorstellung wirksam, der die Bildung des Kentauren oder verwandter Fabelwesen
möglich war. Denkt man hingegen an den Norden, etwa an Erfindungen der nieder-
ländischen Stecher wie Bos und Floris oder später vor allem an den Augsburger
Lukas Kilian, so ist in den Erfindungen dieser Meister die menschliche Erscheinung
kein selbstherrliches Wesen, d. h. den ungegenständlichen Elementen des Ornaments
nicht übergeordnet oder beigesellt, sondern meistens unterdrückt, bedrückt von ihnen
oder im Kampfe mit ihnen (das ist der tiefere Sinn der Rollwerkgroteske). Noch
im 18. Jahrhundert stehen, speziell in Deutschland, Ornament und Figur in einer
eigentümlich engen inneren Wechselbeziehung; so scheinen etwa Raphael Donners
Putten im Treppenhaus des Schlosses Mirabell die im Oeländerornament lebendigen
Kräfte zu versinnbildlichen, sie sind viel mehr als bloß plastische Bekrönung. •—
In der Auflösung der menschlichen Substanz in die Grade nächst niederer Stofflich-
keiten ist Deutschland am weitesten gegangen, und es ist sicher kein Zufall, daß
bei manchen Erfindungen Lukas Kilians sich die Erinnerung an embryonale, „vor-
zuständliche" Bildungen zwangsläufig einstellt (vgl. z. B. Berliner Taf. 236,2).
Aber auch bei der Wiedergabe der ungegenständlichen Form ist Italien nie so weit
gegangen wie der Norden, wie man z. B. an der Kartusche sehen kann: sie ist dort
nie so weit entstofflicht worden, daß man ihre Herkunft aus der architektonischen
Dekoration völlig vergäße (vgl. Berliner Taf. 268, 269), es ist eher erlaubt, hier
an ein plastisch bildsames Material zu denken als im Norden, wo die Frage nach
der Materie sich gar nicht erheben darf und die Form des ehemaligen steinernen
Wappenschildes des Barock schon rein stofflich so bis zur Unkenntlichkeit ver-
wandelt wird, daß sie dann im 18. Jahrhundert (etwa in Erfindungen J. Pillements
oder Fr. Xav. Habermanns) sich zu zerfasern und völlig sich aufzulösen im-
stande ist.
Zum Schlüsse soll noch eine Frage wenigstens berührt werden, deren Beant-
wortung freilich den Rahmen dieser Untersuchungen weit überschreiten würde. Sie
drängt sich unwillkürlich auf, sobald wir die gesamte abendländische Ornament-
geschichte von der frühen Antike bis zum Ende des Barock überblicken und uns
fragen, was, nicht vom geistesgeschichtlichen Standpunkte, sondern vom Ornamente
aus gesehen, also innerhalb des Bereiches der Formen selbst, als das eigentliche
Agens, als das wirksame Prinzip der ornamentgeschichtlichen Entwicklung anzu-
sehen sei.
Es ist eine merkwürdige Tatsache, daß im Laufe der Kunstgeschichte ornamen-
tale Entwicklungen in einem wechselnden Tempo sich vollziehen, welches, wie wir
glauben, seit dem Ende der Antike sich dauernd beschleunigt. Halten wir etwa das,
was sich in der neueren Kunstgeschichte zwischen 1400 und 1800 ornament-
geschichtlich ereignet, d. h. den ganzen Reichtum neuer Formen und Form-Kom-
binationen der antiken Entwicklung entgegen, so ist es erstaunlich, wie langsam
diese verlaufen ist. Die Entwicklung der antiken Ornamentik bewegt sich in ganz
bestimmten Grenzen; nachdem sich ihre Hauptelemente einmal konsolidiert hatten,
ist in den rund 900 Jahren von der griechischen Klassik bis zur justinianischen
Zeit, verglichen mit späteren Entwicklungen, rein formengeschichtlich wenig ge-
schehen. Erst mit dem V. und VI. nachchristlichen Jahrhundert beginnt eine deut-
liche Cäsur in der Entwicklung des Ornaments, die zu wirklich neuen und wand-
47
des 16. Jahrhunderts die menschliche Figur als Schöpfung wirklich entwürdigt,
und wenn z. B. in einem italienischen Renaissanceornamente eine menschliche Figur
einem Blumenkelche entwächst, so ist dabei noch die der antiken Phantasie nahe
Vorstellung wirksam, der die Bildung des Kentauren oder verwandter Fabelwesen
möglich war. Denkt man hingegen an den Norden, etwa an Erfindungen der nieder-
ländischen Stecher wie Bos und Floris oder später vor allem an den Augsburger
Lukas Kilian, so ist in den Erfindungen dieser Meister die menschliche Erscheinung
kein selbstherrliches Wesen, d. h. den ungegenständlichen Elementen des Ornaments
nicht übergeordnet oder beigesellt, sondern meistens unterdrückt, bedrückt von ihnen
oder im Kampfe mit ihnen (das ist der tiefere Sinn der Rollwerkgroteske). Noch
im 18. Jahrhundert stehen, speziell in Deutschland, Ornament und Figur in einer
eigentümlich engen inneren Wechselbeziehung; so scheinen etwa Raphael Donners
Putten im Treppenhaus des Schlosses Mirabell die im Oeländerornament lebendigen
Kräfte zu versinnbildlichen, sie sind viel mehr als bloß plastische Bekrönung. •—
In der Auflösung der menschlichen Substanz in die Grade nächst niederer Stofflich-
keiten ist Deutschland am weitesten gegangen, und es ist sicher kein Zufall, daß
bei manchen Erfindungen Lukas Kilians sich die Erinnerung an embryonale, „vor-
zuständliche" Bildungen zwangsläufig einstellt (vgl. z. B. Berliner Taf. 236,2).
Aber auch bei der Wiedergabe der ungegenständlichen Form ist Italien nie so weit
gegangen wie der Norden, wie man z. B. an der Kartusche sehen kann: sie ist dort
nie so weit entstofflicht worden, daß man ihre Herkunft aus der architektonischen
Dekoration völlig vergäße (vgl. Berliner Taf. 268, 269), es ist eher erlaubt, hier
an ein plastisch bildsames Material zu denken als im Norden, wo die Frage nach
der Materie sich gar nicht erheben darf und die Form des ehemaligen steinernen
Wappenschildes des Barock schon rein stofflich so bis zur Unkenntlichkeit ver-
wandelt wird, daß sie dann im 18. Jahrhundert (etwa in Erfindungen J. Pillements
oder Fr. Xav. Habermanns) sich zu zerfasern und völlig sich aufzulösen im-
stande ist.
Zum Schlüsse soll noch eine Frage wenigstens berührt werden, deren Beant-
wortung freilich den Rahmen dieser Untersuchungen weit überschreiten würde. Sie
drängt sich unwillkürlich auf, sobald wir die gesamte abendländische Ornament-
geschichte von der frühen Antike bis zum Ende des Barock überblicken und uns
fragen, was, nicht vom geistesgeschichtlichen Standpunkte, sondern vom Ornamente
aus gesehen, also innerhalb des Bereiches der Formen selbst, als das eigentliche
Agens, als das wirksame Prinzip der ornamentgeschichtlichen Entwicklung anzu-
sehen sei.
Es ist eine merkwürdige Tatsache, daß im Laufe der Kunstgeschichte ornamen-
tale Entwicklungen in einem wechselnden Tempo sich vollziehen, welches, wie wir
glauben, seit dem Ende der Antike sich dauernd beschleunigt. Halten wir etwa das,
was sich in der neueren Kunstgeschichte zwischen 1400 und 1800 ornament-
geschichtlich ereignet, d. h. den ganzen Reichtum neuer Formen und Form-Kom-
binationen der antiken Entwicklung entgegen, so ist es erstaunlich, wie langsam
diese verlaufen ist. Die Entwicklung der antiken Ornamentik bewegt sich in ganz
bestimmten Grenzen; nachdem sich ihre Hauptelemente einmal konsolidiert hatten,
ist in den rund 900 Jahren von der griechischen Klassik bis zur justinianischen
Zeit, verglichen mit späteren Entwicklungen, rein formengeschichtlich wenig ge-
schehen. Erst mit dem V. und VI. nachchristlichen Jahrhundert beginnt eine deut-
liche Cäsur in der Entwicklung des Ornaments, die zu wirklich neuen und wand-