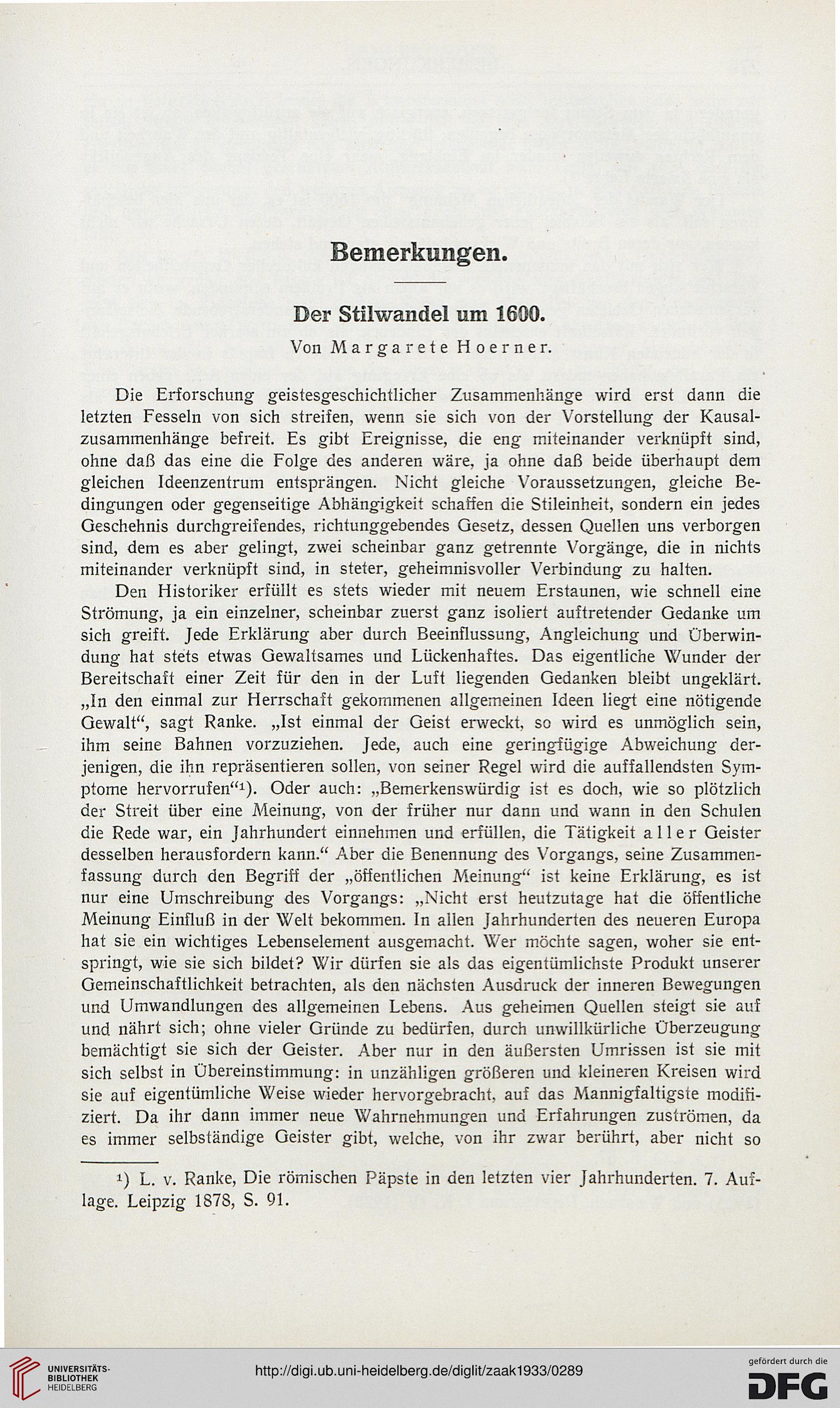Bemerkungen.
Der Stilwandel um 1600.
Von Margarete Hoerner.
Die Erforschung geistesgeschichtlicher Zusammenhänge wird erst dann die
letzten Fesseln von sich streifen, wenn sie sich von der Vorstellung der Kausal-
zusammenhänge befreit. Es gibt Ereignisse, die eng miteinander verknüpft sind,
ohne daß das eine die Folge des anderen wäre, ja ohne daß beide überhaupt dem
gleichen Ideenzentrum entsprängen. Nicht gleiche Voraussetzungen, gleiche Be-
dingungen oder gegenseitige Abhängigkeit schaffen die Stileinheit, sondern ein jedes
Geschehnis durchgreifendes, richtunggebendes Gesetz, dessen Quellen uns verborgen
sind, dem es aber gelingt, zwei scheinbar ganz getrennte Vorgänge, die in nichts
miteinander verknüpft sind, in steter, geheimnisvoller Verbindung zu halten.
Den Historiker erfüllt es stets wieder mit neuem Erstaunen, wie schnell eine
Strömung, ja ein einzelner, scheinbar zuerst ganz isoliert auftretender Gedanke um
sich greift. Jede Erklärung aber durch Beeinflussung, Angleichung und Überwin-
dung hat stets etwas Gewaltsames und Lückenhaftes. Das eigentliche Wunder der
Bereitschaft einer Zeit für den in der Luft liegenden Gedanken bleibt ungeklärt.
„In den einmal zur Herrschaft gekommenen allgemeinen Ideen liegt eine nötigende
Gewalt", sagt Ranke. „Ist einmal der Geist erweckt, so wird es unmöglich sein,
ihm seine Bahnen vorzuziehen. Jede, auch eine geringfügige Abweichung der-
jenigen, die ihn repräsentieren sollen, von seiner Regel wird die auffallendsten Sym-
ptome hervorrufen"1). Oder auch: „Bemerkenswürdig ist es doch, wie so plötzlich
der Streit über eine Meinung, von der früher nur dann und wann in den Schulen
die Rede war, ein Jahrhundert einnehmen und erfüllen, die Tätigkeit aller Geister
desselben herausfordern kann." Aber die Benennung des Vorgangs, seine Zusammen-
fassung durch den Begriff der „öffentlichen Meinung" ist keine Erklärung, es ist
nur eine Umschreibung des Vorgangs: „Nicht erst heutzutage hat die öffentliche
Meinung Einfluß in der Welt bekommen. In allen Jahrhunderten des neueren Europa
hat sie ein wichtiges Lebenselement ausgemacht. Wer möchte sagen, woher sie ent-
springt, wie sie sich bildet? Wir dürfen sie als das eigentümlichste Produkt unserer
Gemeinschaftlichkeit betrachten, als den nächsten Ausdruck der inneren Bewegungen
und Umwandlungen des allgemeinen Lebens. Aus geheimen Quellen steigt sie auf
und nährt sich; ohne vieler Gründe zu bedürfen, durch unwillkürliche Überzeugung
bemächtigt sie sich der Geister. Aber nur in den äußersten Umrissen ist sie mit
sich selbst in Übereinstimmung: in unzähligen größeren und kleineren Kreisen wird
sie auf eigentümliche Weise wieder hervorgebracht, auf das Mannigfaltigste modifi-
ziert. Da ihr dann immer neue Wahrnehmungen und Erfahrungen zuströmen, da
es immer selbständige Geister gibt, welche, von ihr zwar berührt, aber nicht so
*) L. v. Ranke, Die römischen Päpste in den letzten vier Jahrhunderten. 7. Auf-
lage. Leipzig 1878, S. 91.
Der Stilwandel um 1600.
Von Margarete Hoerner.
Die Erforschung geistesgeschichtlicher Zusammenhänge wird erst dann die
letzten Fesseln von sich streifen, wenn sie sich von der Vorstellung der Kausal-
zusammenhänge befreit. Es gibt Ereignisse, die eng miteinander verknüpft sind,
ohne daß das eine die Folge des anderen wäre, ja ohne daß beide überhaupt dem
gleichen Ideenzentrum entsprängen. Nicht gleiche Voraussetzungen, gleiche Be-
dingungen oder gegenseitige Abhängigkeit schaffen die Stileinheit, sondern ein jedes
Geschehnis durchgreifendes, richtunggebendes Gesetz, dessen Quellen uns verborgen
sind, dem es aber gelingt, zwei scheinbar ganz getrennte Vorgänge, die in nichts
miteinander verknüpft sind, in steter, geheimnisvoller Verbindung zu halten.
Den Historiker erfüllt es stets wieder mit neuem Erstaunen, wie schnell eine
Strömung, ja ein einzelner, scheinbar zuerst ganz isoliert auftretender Gedanke um
sich greift. Jede Erklärung aber durch Beeinflussung, Angleichung und Überwin-
dung hat stets etwas Gewaltsames und Lückenhaftes. Das eigentliche Wunder der
Bereitschaft einer Zeit für den in der Luft liegenden Gedanken bleibt ungeklärt.
„In den einmal zur Herrschaft gekommenen allgemeinen Ideen liegt eine nötigende
Gewalt", sagt Ranke. „Ist einmal der Geist erweckt, so wird es unmöglich sein,
ihm seine Bahnen vorzuziehen. Jede, auch eine geringfügige Abweichung der-
jenigen, die ihn repräsentieren sollen, von seiner Regel wird die auffallendsten Sym-
ptome hervorrufen"1). Oder auch: „Bemerkenswürdig ist es doch, wie so plötzlich
der Streit über eine Meinung, von der früher nur dann und wann in den Schulen
die Rede war, ein Jahrhundert einnehmen und erfüllen, die Tätigkeit aller Geister
desselben herausfordern kann." Aber die Benennung des Vorgangs, seine Zusammen-
fassung durch den Begriff der „öffentlichen Meinung" ist keine Erklärung, es ist
nur eine Umschreibung des Vorgangs: „Nicht erst heutzutage hat die öffentliche
Meinung Einfluß in der Welt bekommen. In allen Jahrhunderten des neueren Europa
hat sie ein wichtiges Lebenselement ausgemacht. Wer möchte sagen, woher sie ent-
springt, wie sie sich bildet? Wir dürfen sie als das eigentümlichste Produkt unserer
Gemeinschaftlichkeit betrachten, als den nächsten Ausdruck der inneren Bewegungen
und Umwandlungen des allgemeinen Lebens. Aus geheimen Quellen steigt sie auf
und nährt sich; ohne vieler Gründe zu bedürfen, durch unwillkürliche Überzeugung
bemächtigt sie sich der Geister. Aber nur in den äußersten Umrissen ist sie mit
sich selbst in Übereinstimmung: in unzähligen größeren und kleineren Kreisen wird
sie auf eigentümliche Weise wieder hervorgebracht, auf das Mannigfaltigste modifi-
ziert. Da ihr dann immer neue Wahrnehmungen und Erfahrungen zuströmen, da
es immer selbständige Geister gibt, welche, von ihr zwar berührt, aber nicht so
*) L. v. Ranke, Die römischen Päpste in den letzten vier Jahrhunderten. 7. Auf-
lage. Leipzig 1878, S. 91.