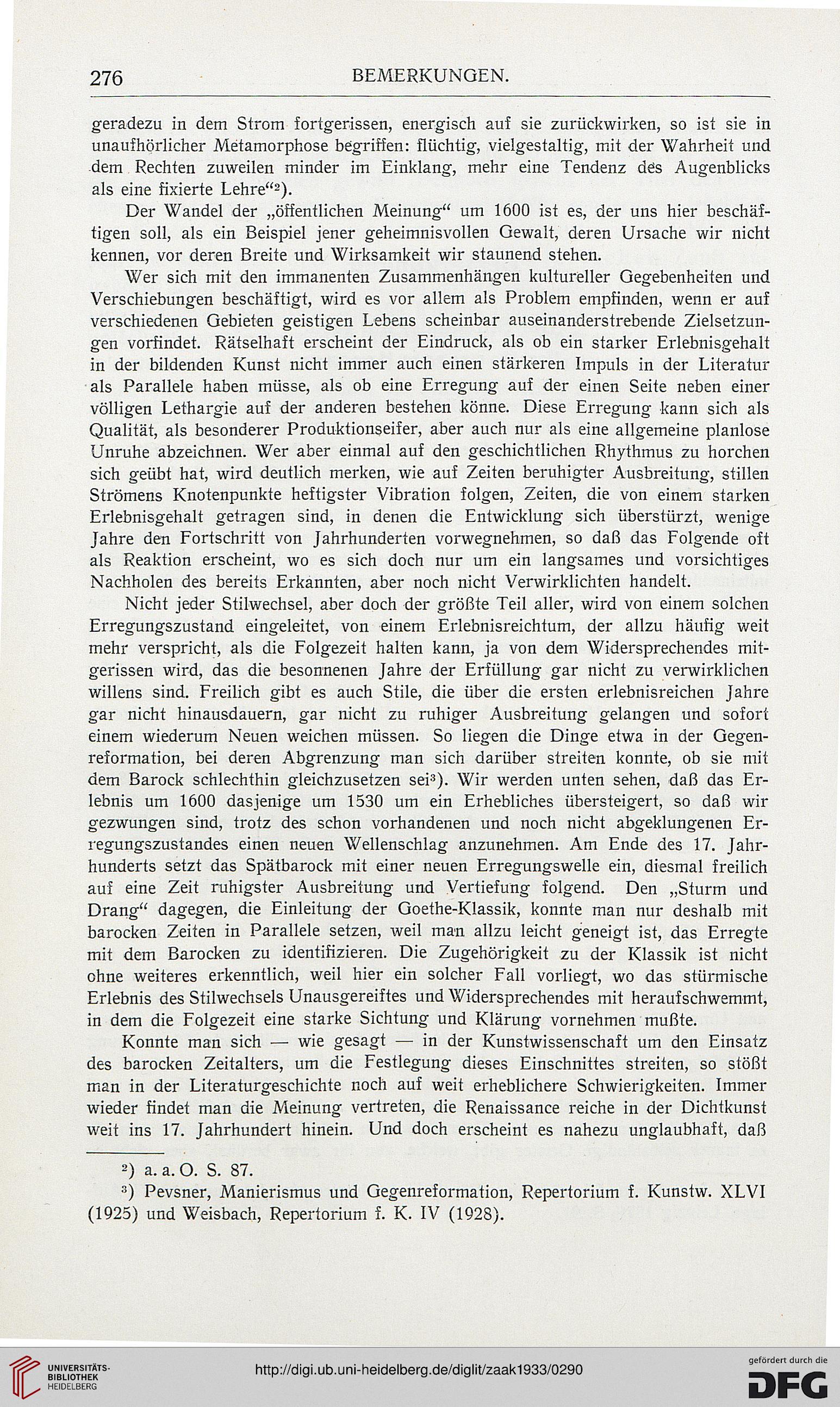276
BEMERKUNGEN.
geradezu in dem Strom fortgerissen, energisch auf sie zurückwirken, so ist sie in
unaufhörlicher Metamorphose begriffen: flüchtig, vielgestaltig, mit der Wahrheit und
dem Rechten zuweilen minder im Einklang, mehr eine Tendenz des Augenblicks
als eine fixierte Lehre"2).
Der Wandel der „öffentlichen Meinung" um 1600 ist es, der uns hier beschäf-
tigen soll, als ein Beispiel jener geheimnisvollen Gewalt, deren Ursache wir nicht
kennen, vor deren Breite und Wirksamkeit wir staunend stehen.
Wer sich mit den immanenten Zusammenhängen kultureller Gegebenheiten und
Verschiebungen beschäftigt, wird es vor allem als Problem empfinden, wenn er auf
verschiedenen Gebieten geistigen Lebens scheinbar auseinanderstrebende Zielsetzun-
gen vorfindet. Rätselhaft erscheint der Eindruck, als ob ein starker Erlebnisgehalt
in der bildenden Kunst nicht immer auch einen stärkeren Impuls in der Literatur
als Parallele haben müsse, als ob eine Erregung auf der einen Seite neben einer
völligen Lethargie auf der anderen bestehen könne. Diese Erregung kann sich als
Qualität, als besonderer Produktionseifer, aber auch nur als eine allgemeine planlose
Unruhe abzeichnen. Wer aber einmal auf den geschichtlichen Rhythmus zu horchen
sich geübt hat, wird deutlich merken, wie auf Zeiten beruhigter Ausbreitung, stillen
Strömens Knotenpunkte heftigster Vibration folgen, Zeiten, die von einem starken
Erlebnisgehalt getragen sind, in denen die Entwicklung sich überstürzt, wenige
Jahre den Fortschritt von Jahrhunderten vorwegnehmen, so daß das Folgende oft
als Reaktion erscheint, wo es sich doch nur um ein langsames und vorsichtiges
Nachholen des bereits Erkannten, aber noch nicht Verwirklichten handelt.
Nicht jeder Stilwechsel, aber doch der größte Teil aller, wird von einem solchen
Erregungszustand eingeleitet, von einem Erlebnisreichtum, der allzu häufig weit
mehr verspricht, als die Folgezeit halten kann, ja von dem Widersprechendes mit-
gerissen wird, das die besonnenen Jahre der Erfüllung gar nicht zu verwirklichen
willens sind. Freilich gibt es auch Stile, die über die ersten erlebnisreichen Jahre
gar nicht hinausdauern, gar nicht zu ruhiger Ausbreitung gelangen und sofort
einem wiederum Neuen weichen müssen. So liegen die Dinge etwa in der Gegen-
reformation, bei deren Abgrenzung man sich darüber streiten konnte, ob sie mit
dem Barock schlechthin gleichzusetzen sei3). Wir werden unten sehen, daß das Er-
lebnis um 1600 dasjenige um 1530 um ein Erhebliches übersteigert, so daß wir
gezwungen sind, trotz des schon vorhandenen und noch nicht abgeklungenen Er-
regungszustandes einen neuen Wellenschlag anzunehmen. Am Ende des 17. Jahr-
hunderts setzt das Spätbarock mit einer neuen Erregungswelle ein, diesmal freilich
auf eine Zeit ruhigster Ausbreitung und Vertiefung folgend. Den „Sturm und
Drang" dagegen, die Einleitung der Goethe-Klassik, konnte man nur deshalb mit
barocken Zeiten in Parallele setzen, weil man allzu leicht geneigt ist, das Erregte
mit dem Barocken zu identifizieren. Die Zugehörigkeit zu der Klassik ist nicht
ohne weiteres erkenntlich, weil hier ein solcher Fall vorliegt, wo das stürmische
Erlebnis des Stilwechsels Unausgereiftes und Widersprechendes mit heraufschwemmt,
in dem die Folgezeit eine starke Sichtung und Klärung vornehmen mußte.
Konnte man sich — wie gesagt — in der Kunstwissenschaft um den Einsatz
des barocken Zeitalters, um die Festlegung dieses Einschnittes streiten, so stößt
man in der Literaturgeschichte noch auf weit erheblichere Schwierigkeiten. Immer
wieder findet man die Meinung vertreten, die Renaissance reiche in der Dichtkunst
weit ins 17. Jahrhundert hinein. Und doch erscheint es nahezu unglaubhaft, daß
2) a.a.O. S. 87.
■") Pevsner, Manierismus und Gegenreformation, Repertorium f. Kunstw. XLVI
(1925) und Weisbach, Repertorium f. K. IV (1928).
BEMERKUNGEN.
geradezu in dem Strom fortgerissen, energisch auf sie zurückwirken, so ist sie in
unaufhörlicher Metamorphose begriffen: flüchtig, vielgestaltig, mit der Wahrheit und
dem Rechten zuweilen minder im Einklang, mehr eine Tendenz des Augenblicks
als eine fixierte Lehre"2).
Der Wandel der „öffentlichen Meinung" um 1600 ist es, der uns hier beschäf-
tigen soll, als ein Beispiel jener geheimnisvollen Gewalt, deren Ursache wir nicht
kennen, vor deren Breite und Wirksamkeit wir staunend stehen.
Wer sich mit den immanenten Zusammenhängen kultureller Gegebenheiten und
Verschiebungen beschäftigt, wird es vor allem als Problem empfinden, wenn er auf
verschiedenen Gebieten geistigen Lebens scheinbar auseinanderstrebende Zielsetzun-
gen vorfindet. Rätselhaft erscheint der Eindruck, als ob ein starker Erlebnisgehalt
in der bildenden Kunst nicht immer auch einen stärkeren Impuls in der Literatur
als Parallele haben müsse, als ob eine Erregung auf der einen Seite neben einer
völligen Lethargie auf der anderen bestehen könne. Diese Erregung kann sich als
Qualität, als besonderer Produktionseifer, aber auch nur als eine allgemeine planlose
Unruhe abzeichnen. Wer aber einmal auf den geschichtlichen Rhythmus zu horchen
sich geübt hat, wird deutlich merken, wie auf Zeiten beruhigter Ausbreitung, stillen
Strömens Knotenpunkte heftigster Vibration folgen, Zeiten, die von einem starken
Erlebnisgehalt getragen sind, in denen die Entwicklung sich überstürzt, wenige
Jahre den Fortschritt von Jahrhunderten vorwegnehmen, so daß das Folgende oft
als Reaktion erscheint, wo es sich doch nur um ein langsames und vorsichtiges
Nachholen des bereits Erkannten, aber noch nicht Verwirklichten handelt.
Nicht jeder Stilwechsel, aber doch der größte Teil aller, wird von einem solchen
Erregungszustand eingeleitet, von einem Erlebnisreichtum, der allzu häufig weit
mehr verspricht, als die Folgezeit halten kann, ja von dem Widersprechendes mit-
gerissen wird, das die besonnenen Jahre der Erfüllung gar nicht zu verwirklichen
willens sind. Freilich gibt es auch Stile, die über die ersten erlebnisreichen Jahre
gar nicht hinausdauern, gar nicht zu ruhiger Ausbreitung gelangen und sofort
einem wiederum Neuen weichen müssen. So liegen die Dinge etwa in der Gegen-
reformation, bei deren Abgrenzung man sich darüber streiten konnte, ob sie mit
dem Barock schlechthin gleichzusetzen sei3). Wir werden unten sehen, daß das Er-
lebnis um 1600 dasjenige um 1530 um ein Erhebliches übersteigert, so daß wir
gezwungen sind, trotz des schon vorhandenen und noch nicht abgeklungenen Er-
regungszustandes einen neuen Wellenschlag anzunehmen. Am Ende des 17. Jahr-
hunderts setzt das Spätbarock mit einer neuen Erregungswelle ein, diesmal freilich
auf eine Zeit ruhigster Ausbreitung und Vertiefung folgend. Den „Sturm und
Drang" dagegen, die Einleitung der Goethe-Klassik, konnte man nur deshalb mit
barocken Zeiten in Parallele setzen, weil man allzu leicht geneigt ist, das Erregte
mit dem Barocken zu identifizieren. Die Zugehörigkeit zu der Klassik ist nicht
ohne weiteres erkenntlich, weil hier ein solcher Fall vorliegt, wo das stürmische
Erlebnis des Stilwechsels Unausgereiftes und Widersprechendes mit heraufschwemmt,
in dem die Folgezeit eine starke Sichtung und Klärung vornehmen mußte.
Konnte man sich — wie gesagt — in der Kunstwissenschaft um den Einsatz
des barocken Zeitalters, um die Festlegung dieses Einschnittes streiten, so stößt
man in der Literaturgeschichte noch auf weit erheblichere Schwierigkeiten. Immer
wieder findet man die Meinung vertreten, die Renaissance reiche in der Dichtkunst
weit ins 17. Jahrhundert hinein. Und doch erscheint es nahezu unglaubhaft, daß
2) a.a.O. S. 87.
■") Pevsner, Manierismus und Gegenreformation, Repertorium f. Kunstw. XLVI
(1925) und Weisbach, Repertorium f. K. IV (1928).