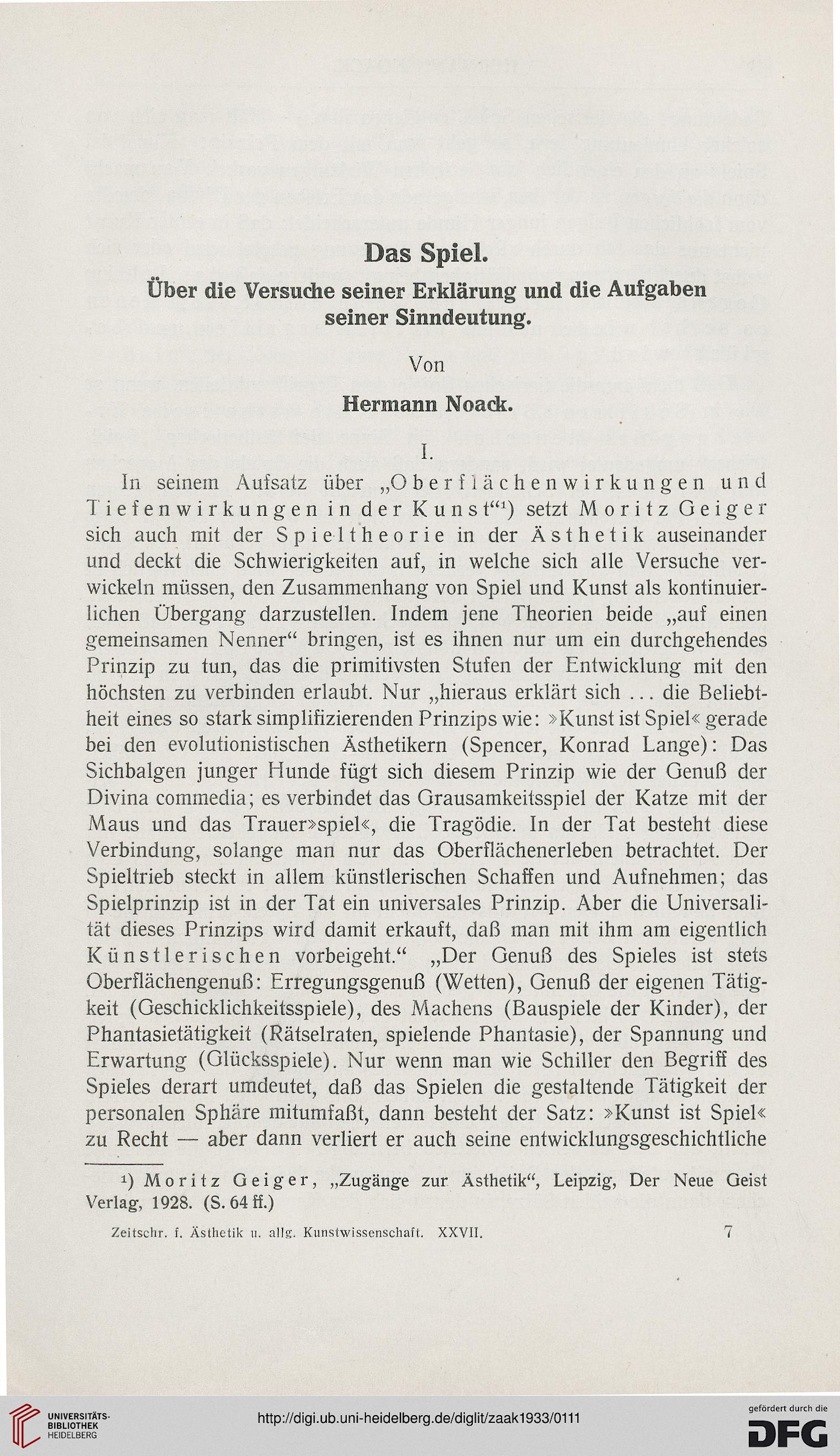Das Spiel.
Über die Versuche seiner Erklärung und die Aufgaben
seiner Sinndeutung.
Von
Hermann Noack.
I.
In seinem Aufsatz über „Oberflächenwirkungen und
T iefenwirkungen in der Kunst"1) setzt Moritz Geiger
sich auch mit der Spieltheorie in der Ästhetik auseinander
und deckt die Schwierigkeiten auf, in welche sich alle Versuche ver-
wickeln müssen, den Zusammenhang von Spiel und Kunst als kontinuier-
lichen Übergang darzustellen. Indem jene Theorien beide „auf einen
gemeinsamen Nenner" bringen, ist es ihnen nur um ein durchgehendes
Prinzip zu tun, das die primitivsten Stufen der Entwicklung mit den
höchsten zu verbinden erlaubt. Nur „hieraus erklärt sich ... die Beliebt-
heit eines so stark simplifizierenden Prinzips wie: »Kunst ist Spiel« gerade
bei den evolutionistischen Ästhetikern (Spencer, Konrad Lange): Das
Sichbalgen junger Hunde fügt sich diesem Prinzip wie der Genuß der
Divina commedia; es verbindet das Grausamkeitsspiel der Katze mit der
Maus und das Trauer»spiel«, die Tragödie. In der Tat besteht diese
Verbindung, solange man nur das Oberflächenerleben betrachtet. Der
Spieltrieb steckt in allem künstlerischen Schaffen und Aufnehmen; das
Spielprinzip ist in der Tat ein universales Prinzip. Aber die Universali-
tät dieses Prinzips wird damit erkauft, daß man mit ihm am eigentlich
Künstlerischen vorbeigeht." „Der Genuß des Spieles ist stets
Oberflächengenuß: Erregungsgenuß (Wetten), Genuß der eigenen Tätig-
keit (Geschicklichkeitsspiele), des Machens (Bauspiele der Kinder), der
Phantasietätigkeit (Rätselraten, spielende Phantasie), der Spannung und
Erwartung (Glücksspiele). Nur wenn man wie Schiller den Begriff des
Spieles derart umdeutet, daß das Spielen die gestaltende Tätigkeit der
personalen Sphäre mitumfaßt, dann besteht der Satz: »Kunst ist Spiel«
zu Recht — aber dann verliert er auch seine entwicklungsgeschichtliche
1) Moritz Geiger, „Zugänge zur Ästhetik", Leipzig, Der Neue Geist
Verlag, 1928. (S.64H.)
Zeitschr. f. Ästhetik u. allst. Kunstwissenschaft. XXVII.
7
Über die Versuche seiner Erklärung und die Aufgaben
seiner Sinndeutung.
Von
Hermann Noack.
I.
In seinem Aufsatz über „Oberflächenwirkungen und
T iefenwirkungen in der Kunst"1) setzt Moritz Geiger
sich auch mit der Spieltheorie in der Ästhetik auseinander
und deckt die Schwierigkeiten auf, in welche sich alle Versuche ver-
wickeln müssen, den Zusammenhang von Spiel und Kunst als kontinuier-
lichen Übergang darzustellen. Indem jene Theorien beide „auf einen
gemeinsamen Nenner" bringen, ist es ihnen nur um ein durchgehendes
Prinzip zu tun, das die primitivsten Stufen der Entwicklung mit den
höchsten zu verbinden erlaubt. Nur „hieraus erklärt sich ... die Beliebt-
heit eines so stark simplifizierenden Prinzips wie: »Kunst ist Spiel« gerade
bei den evolutionistischen Ästhetikern (Spencer, Konrad Lange): Das
Sichbalgen junger Hunde fügt sich diesem Prinzip wie der Genuß der
Divina commedia; es verbindet das Grausamkeitsspiel der Katze mit der
Maus und das Trauer»spiel«, die Tragödie. In der Tat besteht diese
Verbindung, solange man nur das Oberflächenerleben betrachtet. Der
Spieltrieb steckt in allem künstlerischen Schaffen und Aufnehmen; das
Spielprinzip ist in der Tat ein universales Prinzip. Aber die Universali-
tät dieses Prinzips wird damit erkauft, daß man mit ihm am eigentlich
Künstlerischen vorbeigeht." „Der Genuß des Spieles ist stets
Oberflächengenuß: Erregungsgenuß (Wetten), Genuß der eigenen Tätig-
keit (Geschicklichkeitsspiele), des Machens (Bauspiele der Kinder), der
Phantasietätigkeit (Rätselraten, spielende Phantasie), der Spannung und
Erwartung (Glücksspiele). Nur wenn man wie Schiller den Begriff des
Spieles derart umdeutet, daß das Spielen die gestaltende Tätigkeit der
personalen Sphäre mitumfaßt, dann besteht der Satz: »Kunst ist Spiel«
zu Recht — aber dann verliert er auch seine entwicklungsgeschichtliche
1) Moritz Geiger, „Zugänge zur Ästhetik", Leipzig, Der Neue Geist
Verlag, 1928. (S.64H.)
Zeitschr. f. Ästhetik u. allst. Kunstwissenschaft. XXVII.
7