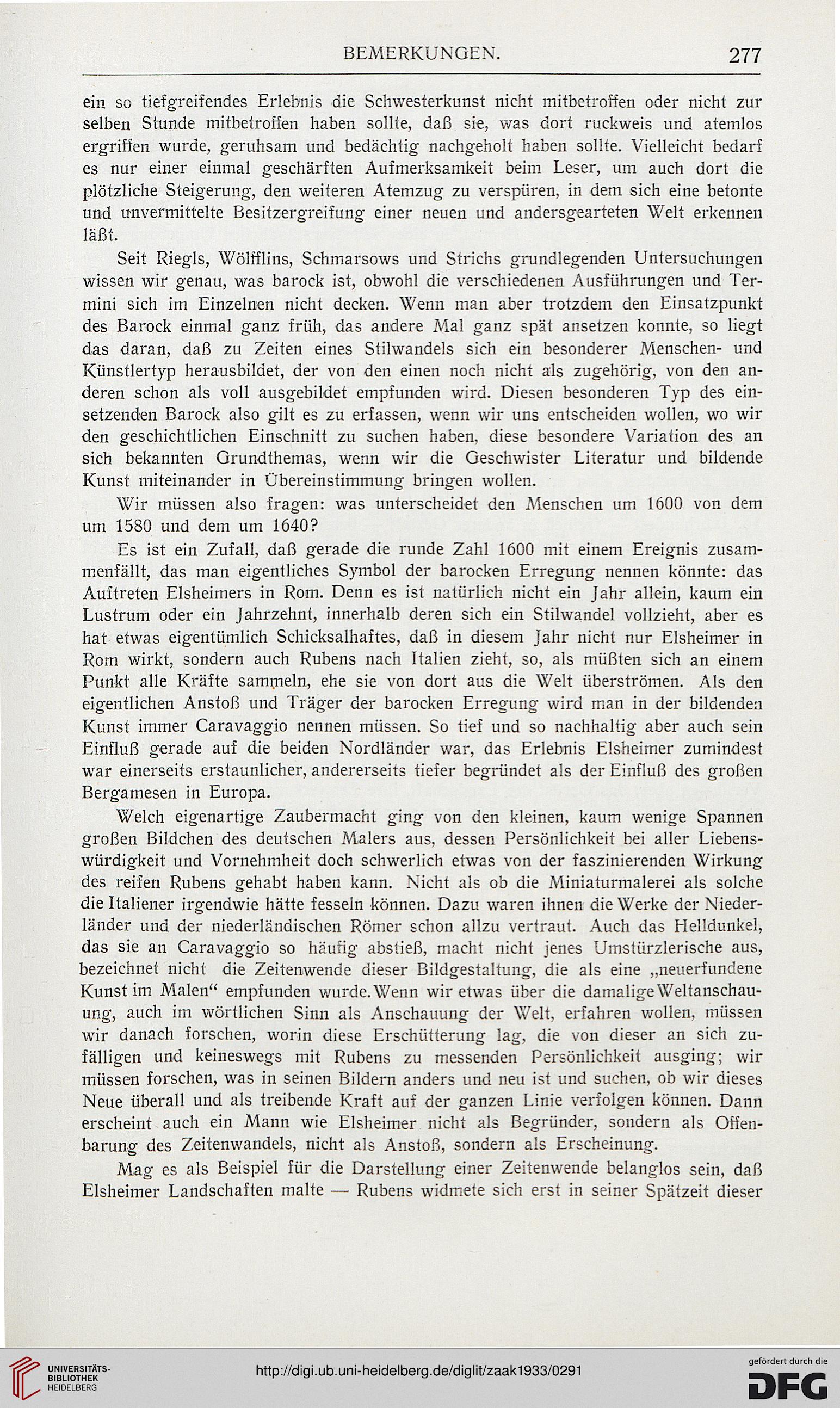BEMERKUNGEN.
277
ein so tiefgreifendes Erlebnis die Schwesterkunst nicht mitbetroffen oder nicht zur
selben Stunde mitbetroffen haben sollte, daß sie, was dort ruckweis und atemlos
ergriffen wurde, geruhsam und bedächtig nachgeholt haben sollte. Vielleicht bedarf
es nur einer einmal geschärften Aufmerksamkeit beim Leser, um auch dort die
plötzliche Steigerung, den weiteren Atemzug zu verspüren, in dem sich eine betonte
und unvermittelte Besitzergreifung einer neuen und andersgearteten Welt erkennen
läßt.
Seit Riegls, Wölfflins, Schmarsows und Strichs grundlegenden Untersuchungen
wissen wir genau, was barock ist, obwohl die verschiedenen Ausführungen und Ter-
mini sich im Einzelnen nicht decken. Wenn man aber trotzdem den Einsatzpunkt
des Barock einmal ganz früh, das andere Mal ganz spät ansetzen konnte, so liegt
das daran, daß zu Zeiten eines Stilwandels sich ein besonderer Menschen- und
Künstlertyp herausbildet, der von den einen noch nicht als zugehörig, von den an-
deren schon als voll ausgebildet empfunden wird. Diesen besonderen Typ des ein-
setzenden Barock also gilt es zu erfassen, wenn wir uns entscheiden wollen, wo wir
den geschichtlichen Einschnitt zu suchen haben, diese besondere Variation des an
sich bekannten Qrundthemas, wenn wir die Geschwister Literatur und bildende
Kunst miteinander in Übereinstimmung bringen wollen.
Wir müssen also fragen: was unterscheidet den Menschen um 1600 von dem
um 1580 und dem um 1640?
Es ist ein Zufall, daß gerade die runde Zahl 1600 mit einem Ereignis zusam-
menfällt, das man eigentliches Symbol der barocken Erregung nennen könnte: das
Auftreten Elsheimers in Rom. Denn es ist natürlich nicht ein Jahr allein, kaum ein
Lustrum oder ein Jahrzehnt, innerhalb deren sich ein Stilwandel vollzieht, aber es
hat etwas eigentümlich Schicksalhaftes, daß in diesem Jahr nicht nur Elsheimer in
Rom wirkt, sondern auch Rubens nach Italien zieht, so, als müßten sich an einem
Punkt alle Kräfte samrneln, ehe sie von dort aus die Welt überströmen. Als den
eigentlichen Anstoß und Träger der barocken Erregung wird man in der bildenden
Kunst immer Caravaggio nennen müssen. So tief und so nachhaltig aber auch sein
Einfluß gerade auf die beiden Nordländer war, das Erlebnis Elsheimer zumindest
war einerseits erstaunlicher, andererseits tiefer begründet als der Einfluß des großen
Bergamesen in Europa.
Welch eigenartige Zaubermacht ging von den kleinen, kaum wenige Spannen
großen Bildchen des deutschen Malers aus, dessen Persönlichkeit bei aller Liebens-
würdigkeit und Vornehmheit doch schwerlich etwas von der faszinierenden Wirkung
des reifen Rubens gehabt haben kann. Nicht als ob die Miniaturmalerei als solche
die Italiener irgendwie hätte fesseln können. Dazu waren ihnen die Werke der Nieder-
länder und der niederländischen Römer schon allzu vertraut. Auch das Helldunkel,
das sie an Caravaggio so häufig abstieß, macht nicht jenes Umstürzlerische aus,
bezeichnet nicht die Zeitenwende dieser Bildgestaltung, die als eine „neuerfundene
Kunst im Malen" empfunden wurde. Wenn wir etwas über die damalige Weltanschau-
ung, auch im wörtlichen Sinn als Anschauung der Welt, erfahren wollen, müssen
wir danach forschen, worin diese Erschütterung lag, die von dieser an sich zu-
fälligen und keineswegs mit Rubens zu messenden Persönlichkeit ausging; wir
müssen forschen, was in seinen Bildern anders und neu ist und suchen, ob v/ir dieses
Neue überall und als treibende Kraft auf der ganzen Linie verfolgen können. Dann
erscheint auch ein Mann wie Elsheimer nicht als Begründer, sondern als Offen-
barung des Zeitenwandels, nicht als Anstoß, sondern als Erscheinung.
Mag es als Beispiel für die Darstellung einer Zeitenwende belanglos sein, daß
Elsheimer Landschaften malte — Rubens widmete sich erst in seiner Spätzeit dieser
277
ein so tiefgreifendes Erlebnis die Schwesterkunst nicht mitbetroffen oder nicht zur
selben Stunde mitbetroffen haben sollte, daß sie, was dort ruckweis und atemlos
ergriffen wurde, geruhsam und bedächtig nachgeholt haben sollte. Vielleicht bedarf
es nur einer einmal geschärften Aufmerksamkeit beim Leser, um auch dort die
plötzliche Steigerung, den weiteren Atemzug zu verspüren, in dem sich eine betonte
und unvermittelte Besitzergreifung einer neuen und andersgearteten Welt erkennen
läßt.
Seit Riegls, Wölfflins, Schmarsows und Strichs grundlegenden Untersuchungen
wissen wir genau, was barock ist, obwohl die verschiedenen Ausführungen und Ter-
mini sich im Einzelnen nicht decken. Wenn man aber trotzdem den Einsatzpunkt
des Barock einmal ganz früh, das andere Mal ganz spät ansetzen konnte, so liegt
das daran, daß zu Zeiten eines Stilwandels sich ein besonderer Menschen- und
Künstlertyp herausbildet, der von den einen noch nicht als zugehörig, von den an-
deren schon als voll ausgebildet empfunden wird. Diesen besonderen Typ des ein-
setzenden Barock also gilt es zu erfassen, wenn wir uns entscheiden wollen, wo wir
den geschichtlichen Einschnitt zu suchen haben, diese besondere Variation des an
sich bekannten Qrundthemas, wenn wir die Geschwister Literatur und bildende
Kunst miteinander in Übereinstimmung bringen wollen.
Wir müssen also fragen: was unterscheidet den Menschen um 1600 von dem
um 1580 und dem um 1640?
Es ist ein Zufall, daß gerade die runde Zahl 1600 mit einem Ereignis zusam-
menfällt, das man eigentliches Symbol der barocken Erregung nennen könnte: das
Auftreten Elsheimers in Rom. Denn es ist natürlich nicht ein Jahr allein, kaum ein
Lustrum oder ein Jahrzehnt, innerhalb deren sich ein Stilwandel vollzieht, aber es
hat etwas eigentümlich Schicksalhaftes, daß in diesem Jahr nicht nur Elsheimer in
Rom wirkt, sondern auch Rubens nach Italien zieht, so, als müßten sich an einem
Punkt alle Kräfte samrneln, ehe sie von dort aus die Welt überströmen. Als den
eigentlichen Anstoß und Träger der barocken Erregung wird man in der bildenden
Kunst immer Caravaggio nennen müssen. So tief und so nachhaltig aber auch sein
Einfluß gerade auf die beiden Nordländer war, das Erlebnis Elsheimer zumindest
war einerseits erstaunlicher, andererseits tiefer begründet als der Einfluß des großen
Bergamesen in Europa.
Welch eigenartige Zaubermacht ging von den kleinen, kaum wenige Spannen
großen Bildchen des deutschen Malers aus, dessen Persönlichkeit bei aller Liebens-
würdigkeit und Vornehmheit doch schwerlich etwas von der faszinierenden Wirkung
des reifen Rubens gehabt haben kann. Nicht als ob die Miniaturmalerei als solche
die Italiener irgendwie hätte fesseln können. Dazu waren ihnen die Werke der Nieder-
länder und der niederländischen Römer schon allzu vertraut. Auch das Helldunkel,
das sie an Caravaggio so häufig abstieß, macht nicht jenes Umstürzlerische aus,
bezeichnet nicht die Zeitenwende dieser Bildgestaltung, die als eine „neuerfundene
Kunst im Malen" empfunden wurde. Wenn wir etwas über die damalige Weltanschau-
ung, auch im wörtlichen Sinn als Anschauung der Welt, erfahren wollen, müssen
wir danach forschen, worin diese Erschütterung lag, die von dieser an sich zu-
fälligen und keineswegs mit Rubens zu messenden Persönlichkeit ausging; wir
müssen forschen, was in seinen Bildern anders und neu ist und suchen, ob v/ir dieses
Neue überall und als treibende Kraft auf der ganzen Linie verfolgen können. Dann
erscheint auch ein Mann wie Elsheimer nicht als Begründer, sondern als Offen-
barung des Zeitenwandels, nicht als Anstoß, sondern als Erscheinung.
Mag es als Beispiel für die Darstellung einer Zeitenwende belanglos sein, daß
Elsheimer Landschaften malte — Rubens widmete sich erst in seiner Spätzeit dieser