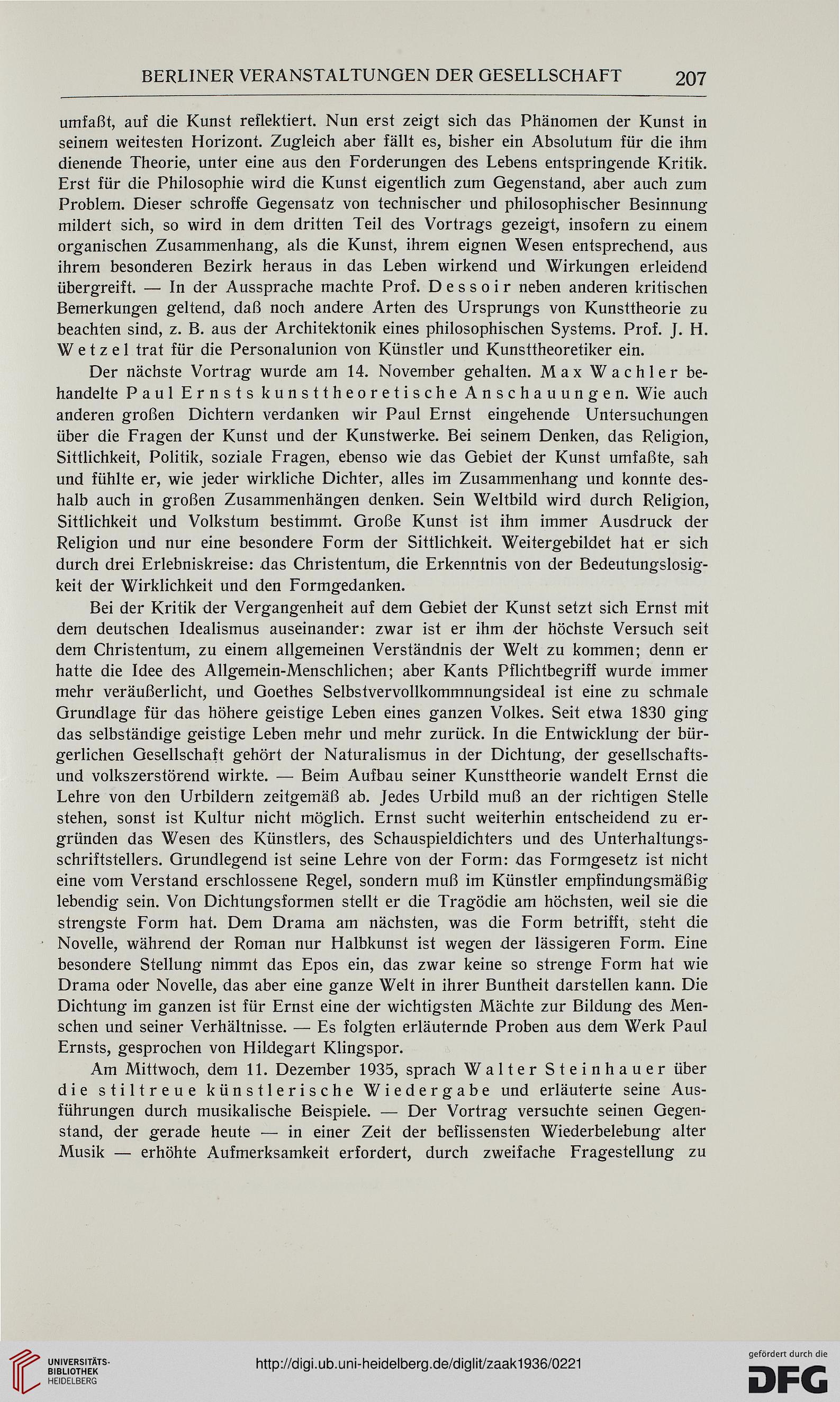BERLINER VERANSTALTUNGEN DER GESELLSCHAFT 207
umfaßt, auf die Kunst reflektiert. Nun erst zeigt sich das Phänomen der Kunst in
seinem weitesten Horizont. Zugleich aber fällt es, bisher ein Absolutum für die ihm
dienende Theorie, unter eine aus den Forderungen des Lebens entspringende Kritik.
Erst für die Philosophie wird die Kunst eigentlich zum Gegenstand, aber auch zum
Problem. Dieser schroffe Gegensatz von technischer und philosophischer Besinnung
mildert sich, so wird in dem dritten Teil des Vortrags gezeigt, insofern zu einem
organischen Zusammenhang, als die Kunst, ihrem eignen Wesen entsprechend, aus
ihrem besonderen Bezirk heraus in das Leben wirkend und Wirkungen erleidend
übergreift. — In der Aussprache machte Prof. D e s s o i r neben anderen kritischen
Bemerkungen geltend, daß noch andere Arten des Ursprungs von Kunsttheorie zu
beachten sind, z. B. aus der Architektonik eines philosophischen Systems. Prof. J. H.
W e t z e 1 trat für die Personalunion von Künstler und Kunsttheoretiker ein.
Der nächste Vortrag wurde am 14. November gehalten. Max Wachler be-
handelte Paul Ernsts kunsttheoretische Anschauungen. Wie auch
anderen großen Dichtern verdanken wir Paul Ernst eingehende Untersuchungen
über die Fragen der Kunst und der Kunstwerke. Bei seinem Denken, das Religion,
Sittlichkeit, Politik, soziale Fragen, ebenso wie das Gebiet der Kunst umfaßte, sah
und fühlte er, wie jeder wirkliche Dichter, alles im Zusammenhang und konnte des-
halb auch in großen Zusammenhängen denken. Sein Weltbild wird durch Religion,
Sittlichkeit und Volkstum bestimmt. Große Kunst ist ihm immer Ausdruck der
Religion und nur eine besondere Form der Sittlichkeit. Weitergebildet hat er sich
durch drei Erlebniskreise: das Christentum, die Erkenntnis von der Bedeutungslosig-
keit der Wirklichkeit und den Formgedanken.
Bei der Kritik der Vergangenheit auf dem Gebiet der Kunst setzt sich Ernst mit
dem deutschen Idealismus auseinander: zwar ist er ihm der höchste Versuch seit
dem Christentum, zu einem allgemeinen Verständnis der Welt zu kommen; denn er
hatte die Idee des Allgemein-Menschlichen; aber Kants Pflichtbegriff wurde immer
mehr veräußerlicht, und Goethes Selbstvervollkommnungsideal ist eine zu schmale
Grundlage für das höhere geistige Leben eines ganzen Volkes. Seit etwa 1830 ging
das selbständige geistige Leben mehr und mehr zurück. In die Entwicklung der bür-
gerlichen Gesellschaft gehört der Naturalismus in der Dichtung, der gesellschafts-
und volkszerstörend wirkte. — Beim Aufbau seiner Kunsttheorie wandelt Ernst die
Lehre von den Urbildern zeitgemäß ab. Jedes Urbild muß an der richtigen Stelle
stehen, sonst ist Kultur nicht möglich. Ernst sucht weiterhin entscheidend zu er-
gründen das Wesen des Künstlers, des Schauspieldichters und des Unterhaltungs-
schriftstellers. Grundlegend ist seine Lehre von der Form: das Formgesetz ist nicht
eine vom Verstand erschlossene Regel, sondern muß im Künstler empfindungsmäßig
lebendig sein. Von Dichtungsformen stellt er die Tragödie am höchsten, weil sie die
strengste Form hat. Dem Drama am nächsten, was die Form betrifft, steht die
Novelle, während der Roman nur Halbkunst ist wegen der lässigeren Form. Eine
besondere Stellung nimmt das Epos ein, das zwar keine so strenge Form hat wie
Drama oder Novelle, das aber eine ganze Welt in ihrer Buntheit darstellen kann. Die
Dichtung im ganzen ist für Ernst eine der wichtigsten Mächte zur Bildung des Men-
schen und seiner Verhältnisse. — Es folgten erläuternde Proben aus dem Werk Paul
Ernsts, gesprochen von Hildegart Klingspor.
Am Mittwoch, dem 11. Dezember 1935, sprach Walter Steinhauer über
die stiltreue künstlerische Wiedergabe und erläuterte seine Aus-
führungen durch musikalische Beispiele. — Der Vortrag versuchte seinen Gegen-
stand, der gerade heute — in einer Zeit der beflissensten Wiederbelebung alter
Musik — erhöhte Aufmerksamkeit erfordert, durch zweifache Fragestellung zu
umfaßt, auf die Kunst reflektiert. Nun erst zeigt sich das Phänomen der Kunst in
seinem weitesten Horizont. Zugleich aber fällt es, bisher ein Absolutum für die ihm
dienende Theorie, unter eine aus den Forderungen des Lebens entspringende Kritik.
Erst für die Philosophie wird die Kunst eigentlich zum Gegenstand, aber auch zum
Problem. Dieser schroffe Gegensatz von technischer und philosophischer Besinnung
mildert sich, so wird in dem dritten Teil des Vortrags gezeigt, insofern zu einem
organischen Zusammenhang, als die Kunst, ihrem eignen Wesen entsprechend, aus
ihrem besonderen Bezirk heraus in das Leben wirkend und Wirkungen erleidend
übergreift. — In der Aussprache machte Prof. D e s s o i r neben anderen kritischen
Bemerkungen geltend, daß noch andere Arten des Ursprungs von Kunsttheorie zu
beachten sind, z. B. aus der Architektonik eines philosophischen Systems. Prof. J. H.
W e t z e 1 trat für die Personalunion von Künstler und Kunsttheoretiker ein.
Der nächste Vortrag wurde am 14. November gehalten. Max Wachler be-
handelte Paul Ernsts kunsttheoretische Anschauungen. Wie auch
anderen großen Dichtern verdanken wir Paul Ernst eingehende Untersuchungen
über die Fragen der Kunst und der Kunstwerke. Bei seinem Denken, das Religion,
Sittlichkeit, Politik, soziale Fragen, ebenso wie das Gebiet der Kunst umfaßte, sah
und fühlte er, wie jeder wirkliche Dichter, alles im Zusammenhang und konnte des-
halb auch in großen Zusammenhängen denken. Sein Weltbild wird durch Religion,
Sittlichkeit und Volkstum bestimmt. Große Kunst ist ihm immer Ausdruck der
Religion und nur eine besondere Form der Sittlichkeit. Weitergebildet hat er sich
durch drei Erlebniskreise: das Christentum, die Erkenntnis von der Bedeutungslosig-
keit der Wirklichkeit und den Formgedanken.
Bei der Kritik der Vergangenheit auf dem Gebiet der Kunst setzt sich Ernst mit
dem deutschen Idealismus auseinander: zwar ist er ihm der höchste Versuch seit
dem Christentum, zu einem allgemeinen Verständnis der Welt zu kommen; denn er
hatte die Idee des Allgemein-Menschlichen; aber Kants Pflichtbegriff wurde immer
mehr veräußerlicht, und Goethes Selbstvervollkommnungsideal ist eine zu schmale
Grundlage für das höhere geistige Leben eines ganzen Volkes. Seit etwa 1830 ging
das selbständige geistige Leben mehr und mehr zurück. In die Entwicklung der bür-
gerlichen Gesellschaft gehört der Naturalismus in der Dichtung, der gesellschafts-
und volkszerstörend wirkte. — Beim Aufbau seiner Kunsttheorie wandelt Ernst die
Lehre von den Urbildern zeitgemäß ab. Jedes Urbild muß an der richtigen Stelle
stehen, sonst ist Kultur nicht möglich. Ernst sucht weiterhin entscheidend zu er-
gründen das Wesen des Künstlers, des Schauspieldichters und des Unterhaltungs-
schriftstellers. Grundlegend ist seine Lehre von der Form: das Formgesetz ist nicht
eine vom Verstand erschlossene Regel, sondern muß im Künstler empfindungsmäßig
lebendig sein. Von Dichtungsformen stellt er die Tragödie am höchsten, weil sie die
strengste Form hat. Dem Drama am nächsten, was die Form betrifft, steht die
Novelle, während der Roman nur Halbkunst ist wegen der lässigeren Form. Eine
besondere Stellung nimmt das Epos ein, das zwar keine so strenge Form hat wie
Drama oder Novelle, das aber eine ganze Welt in ihrer Buntheit darstellen kann. Die
Dichtung im ganzen ist für Ernst eine der wichtigsten Mächte zur Bildung des Men-
schen und seiner Verhältnisse. — Es folgten erläuternde Proben aus dem Werk Paul
Ernsts, gesprochen von Hildegart Klingspor.
Am Mittwoch, dem 11. Dezember 1935, sprach Walter Steinhauer über
die stiltreue künstlerische Wiedergabe und erläuterte seine Aus-
führungen durch musikalische Beispiele. — Der Vortrag versuchte seinen Gegen-
stand, der gerade heute — in einer Zeit der beflissensten Wiederbelebung alter
Musik — erhöhte Aufmerksamkeit erfordert, durch zweifache Fragestellung zu