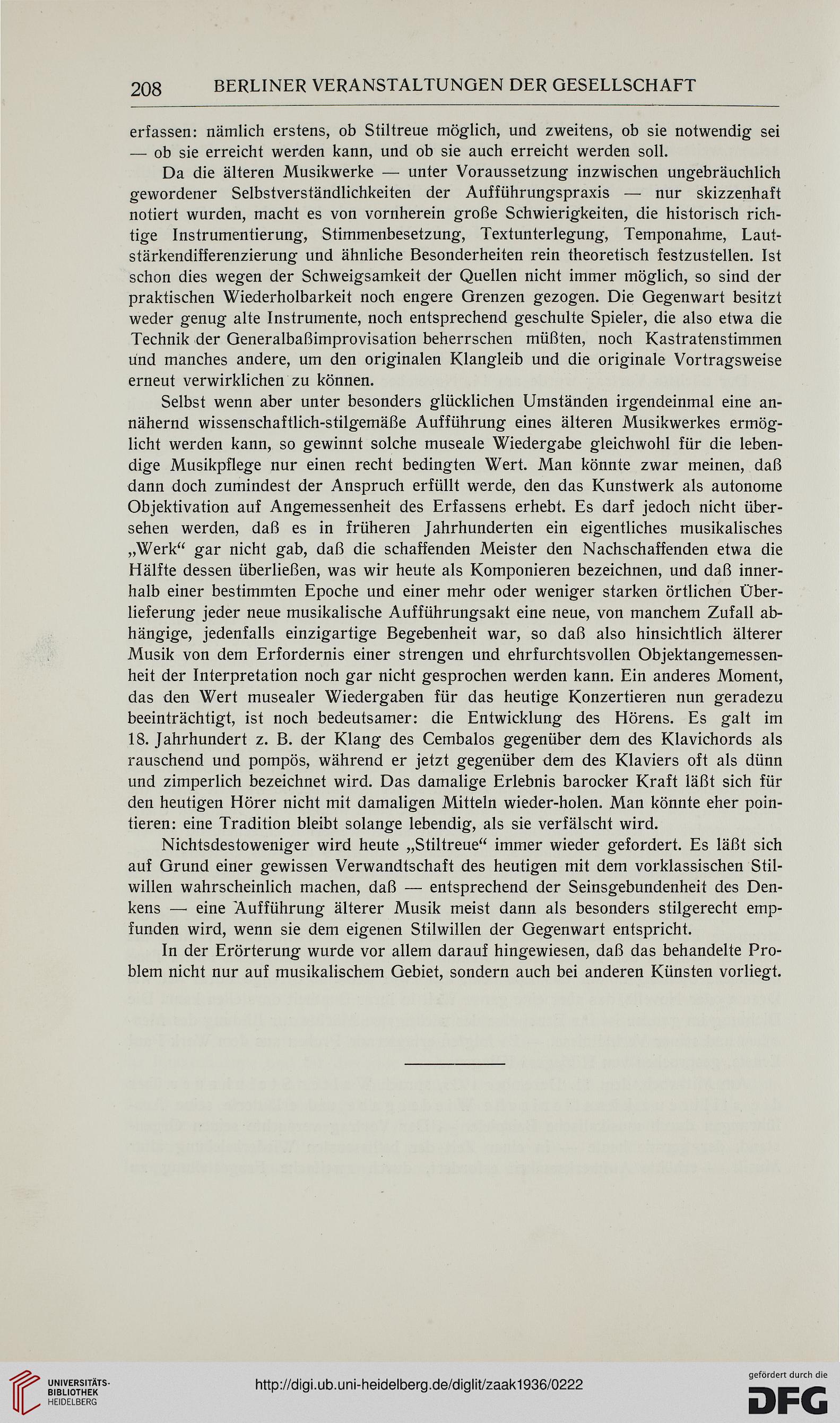208 BERLINER VERANSTALTUNGEN DER GESELLSCHAFT
erfassen: nämlich erstens, ob Stiltreue möglich, und zweitens, ob sie notwendig sei
— ob sie erreicht werden kann, und ob sie auch erreicht werden soll.
Da die älteren Musikwerke — unter Voraussetzung inzwischen ungebräuchlich
gewordener Selbstverständlichkeiten der Aufführungspraxis — nur skizzenhaft
notiert wurden, macht es von vornherein große Schwierigkeiten, die historisch rich-
tige Instrumentierung, Stimmenbesetzung, Textunterlegung, Temponahme, Laut-
stärkendifferenzierung und ähnliche Besonderheiten rein theoretisch festzustellen. Ist
schon dies wegen der Schweigsamkeit der Quellen nicht immer möglich, so sind der
praktischen Wiederholbarkeit noch engere Grenzen gezogen. Die Gegenwart besitzt
weder genug alte Instrumente, noch entsprechend geschulte Spieler, die also etwa die
Technik der Generalbaßimprovisation beherrschen müßten, noch Kastratenstimmen
und manches andere, um den originalen Klangleib und die originale Vortragsweise
erneut verwirklichen zu können.
Selbst wenn aber unter besonders glücklichen Umständen irgendeinmal eine an-
nähernd wissenschaftlich-stilgemäße Aufführung eines älteren Musikwerkes ermög-
licht werden kann, so gewinnt solche museale Wiedergabe gleichwohl für die leben-
dige Musikpflege nur einen recht bedingten Wert. Man könnte zwar meinen, daß
dann doch zumindest der Anspruch erfüllt werde, den das Kunstwerk als autonome
Objektivation auf Angemessenheit des Erfassens erhebt. Es darf jedoch nicht über-
sehen werden, daß es in früheren Jahrhunderten ein eigentliches musikalisches
„Werk" gar nicht gab, daß die schaffenden Meister den Nachschaffenden etwa die
Hälfte dessen überließen, was wir heute als Komponieren bezeichnen, und daß inner-
halb einer bestimmten Epoche und einer mehr oder weniger starken örtlichen Über-
lieferung jeder neue musikalische Aufführungsakt eine neue, von manchem Zufall ab-
hängige, jedenfalls einzigartige Begebenheit war, so daß also hinsichtlich älterer
Musik von dem Erfordernis einer strengen und ehrfurchtsvollen Objektangemessen-
heit der Interpretation noch gar nicht gesprochen werden kann. Ein anderes Moment,
das den Wert musealer Wiedergaben für das heutige Konzertieren nun geradezu
beeinträchtigt, ist noch bedeutsamer: die Entwicklung des Hörens. Es galt im
18. Jahrhundert z. B. der Klang des Cembalos gegenüber dem des Klavichords als
rauschend und pompös, während er jetzt gegenüber dem des Klaviers oft als dünn
und zimperlich bezeichnet wird. Das damalige Erlebnis barocker Kraft läßt sich für
den heutigen Hörer nicht mit damaligen Mitteln wieder-holen. Man könnte eher poin-
tieren: eine Tradition bleibt solange lebendig, als sie verfälscht wird.
Nichtsdestoweniger wird heute „Stiltreue" immer wieder gefordert. Es läßt sich
auf Grund einer gewissen Verwandtschaft des heutigen mit dem vorklassischen Stil-
willen wahrscheinlich machen, daß — entsprechend der Seinsgebundenheit des Den-
kens — eine Aufführung älterer Musik meist dann als besonders stilgerecht emp-
funden wird, wenn sie dem eigenen Stilwillen der Gegenwart entspricht.
In der Erörterung wurde vor allem darauf hingewiesen, daß das behandelte Pro-
blem nicht nur auf musikalischem Gebiet, sondern auch bei anderen Künsten vorliegt.
erfassen: nämlich erstens, ob Stiltreue möglich, und zweitens, ob sie notwendig sei
— ob sie erreicht werden kann, und ob sie auch erreicht werden soll.
Da die älteren Musikwerke — unter Voraussetzung inzwischen ungebräuchlich
gewordener Selbstverständlichkeiten der Aufführungspraxis — nur skizzenhaft
notiert wurden, macht es von vornherein große Schwierigkeiten, die historisch rich-
tige Instrumentierung, Stimmenbesetzung, Textunterlegung, Temponahme, Laut-
stärkendifferenzierung und ähnliche Besonderheiten rein theoretisch festzustellen. Ist
schon dies wegen der Schweigsamkeit der Quellen nicht immer möglich, so sind der
praktischen Wiederholbarkeit noch engere Grenzen gezogen. Die Gegenwart besitzt
weder genug alte Instrumente, noch entsprechend geschulte Spieler, die also etwa die
Technik der Generalbaßimprovisation beherrschen müßten, noch Kastratenstimmen
und manches andere, um den originalen Klangleib und die originale Vortragsweise
erneut verwirklichen zu können.
Selbst wenn aber unter besonders glücklichen Umständen irgendeinmal eine an-
nähernd wissenschaftlich-stilgemäße Aufführung eines älteren Musikwerkes ermög-
licht werden kann, so gewinnt solche museale Wiedergabe gleichwohl für die leben-
dige Musikpflege nur einen recht bedingten Wert. Man könnte zwar meinen, daß
dann doch zumindest der Anspruch erfüllt werde, den das Kunstwerk als autonome
Objektivation auf Angemessenheit des Erfassens erhebt. Es darf jedoch nicht über-
sehen werden, daß es in früheren Jahrhunderten ein eigentliches musikalisches
„Werk" gar nicht gab, daß die schaffenden Meister den Nachschaffenden etwa die
Hälfte dessen überließen, was wir heute als Komponieren bezeichnen, und daß inner-
halb einer bestimmten Epoche und einer mehr oder weniger starken örtlichen Über-
lieferung jeder neue musikalische Aufführungsakt eine neue, von manchem Zufall ab-
hängige, jedenfalls einzigartige Begebenheit war, so daß also hinsichtlich älterer
Musik von dem Erfordernis einer strengen und ehrfurchtsvollen Objektangemessen-
heit der Interpretation noch gar nicht gesprochen werden kann. Ein anderes Moment,
das den Wert musealer Wiedergaben für das heutige Konzertieren nun geradezu
beeinträchtigt, ist noch bedeutsamer: die Entwicklung des Hörens. Es galt im
18. Jahrhundert z. B. der Klang des Cembalos gegenüber dem des Klavichords als
rauschend und pompös, während er jetzt gegenüber dem des Klaviers oft als dünn
und zimperlich bezeichnet wird. Das damalige Erlebnis barocker Kraft läßt sich für
den heutigen Hörer nicht mit damaligen Mitteln wieder-holen. Man könnte eher poin-
tieren: eine Tradition bleibt solange lebendig, als sie verfälscht wird.
Nichtsdestoweniger wird heute „Stiltreue" immer wieder gefordert. Es läßt sich
auf Grund einer gewissen Verwandtschaft des heutigen mit dem vorklassischen Stil-
willen wahrscheinlich machen, daß — entsprechend der Seinsgebundenheit des Den-
kens — eine Aufführung älterer Musik meist dann als besonders stilgerecht emp-
funden wird, wenn sie dem eigenen Stilwillen der Gegenwart entspricht.
In der Erörterung wurde vor allem darauf hingewiesen, daß das behandelte Pro-
blem nicht nur auf musikalischem Gebiet, sondern auch bei anderen Künsten vorliegt.