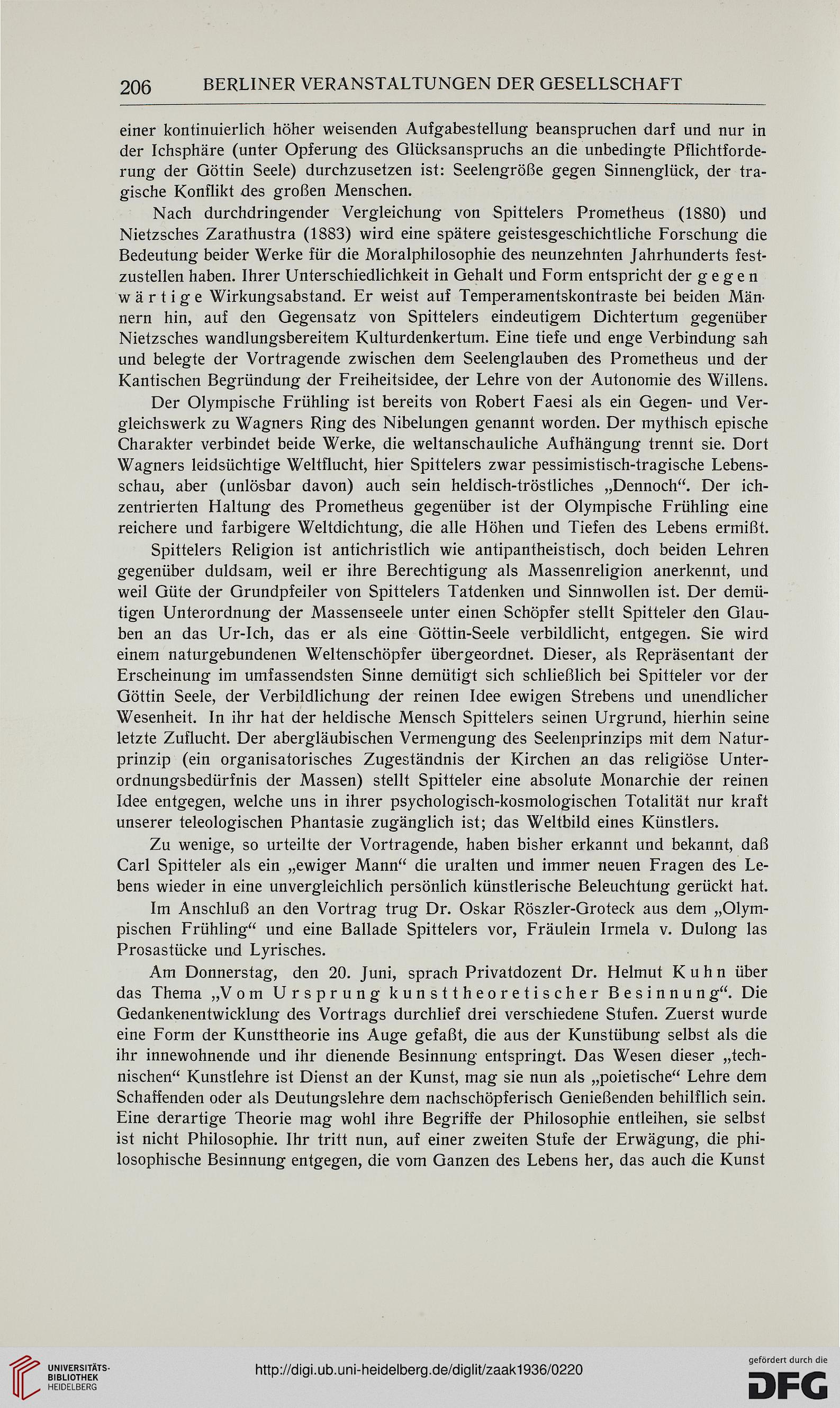206 BERLINER VERANSTALTUNGEN DER GESELLSCHAFT
einer kontinuierlich höher weisenden Aufgabestellung beanspruchen darf und nur in
der Ichsphäre (unter Opferung des Glücksanspruchs an die unbedingte Pflichtforde-
rung der Göttin Seele) durchzusetzen ist: Seelengröße gegen Sinnenglück, der tra-
gische Konflikt des großen Menschen.
Nach durchdringender Vergleichung von Spittelers Prometheus (1880) und
Nietzsches Zarathustra (1883) wird eine spätere geistesgeschichtliche Forschung die
Bedeutung beider Werke für die Moralphilosophie des neunzehnten Jahrhunderts fest-
zustellen haben. Ihrer Unterschiedlichkeit in Gehalt und Form entspricht der gegen
w ä r t i g e Wirkungsabstand. Er weist auf Temperamentskontraste bei beiden Män-
nern hin, auf den Gegensatz von Spittelers eindeutigem Dichtertum gegenüber
Nietzsches wandlungsbereitem Kulturdenkertum. Eine tiefe und enge Verbindung sah
und belegte der Vortragende zwischen dem Seelenglauben des Prometheus und der
Kantischen Begründung der Freiheitsidee, der Lehre von der Autonomie des Willens.
Der Olympische Frühling ist bereits von Robert Faesi als ein Gegen- und Ver-
gleichswerk zu Wagners Ring des Nibelungen genannt worden. Der mythisch epische
Charakter verbindet beide Werke, die weltanschauliche Aufhängung trennt sie. Dort
Wagners leidsüchtige Weltflucht, hier Spittelers zwar pessimistisch-tragische Lebens-
schau, aber (unlösbar davon) auch sein heldisch-tröstliches „Dennoch". Der ich-
zentrierten Haltung des Prometheus gegenüber ist der Olympische Frühling eine
reichere und farbigere Weltdichtung, die alle Höhen und Tiefen des Lebens ermißt.
Spittelers Religion ist antichristlich wie antipantheistisch, doch beiden Lehren
gegenüber duldsam, weil er ihre Berechtigung als Massenreligion anerkennt, und
weil Güte der Grundpfeiler von Spittelers Tatdenken und Sinnwollen ist. Der demü-
tigen Unterordnung der Massenseele unter einen Schöpfer stellt Spitteier den Glau-
ben an das Ur-Ich, das er als eine Göttin-Seele verbildlicht, entgegen. Sie wird
einem naturgebundenen Weltenschöpfer übergeordnet. Dieser, als Repräsentant der
Erscheinung im umfassendsten Sinne demütigt sich schließlich bei Spitteier vor der
Göttin Seele, der Verbildlichung der reinen Idee ewigen Strebens und unendlicher
Wesenheit. In ihr hat der heldische Mensch Spittelers seinen Urgrund, hierhin seine
letzte Zuflucht. Der abergläubischen Vermengung des Seelenprinzips mit dem Natur-
prinzip (ein organisatorisches Zugeständnis der Kirchen an das religiöse Unter-
ordnungsbedürfnis der Massen) stellt Spitteier eine absolute Monarchie der reinen
Idee entgegen, welche uns in ihrer psychologisch-kosmologischen Totalität nur kraft
unserer teleologischen Phantasie zugänglich ist; das Weltbild eines Künstlers.
Zu wenige, so urteilte der Vortragende, haben bisher erkannt und bekannt, daß
Carl Spitteier als ein „ewiger Mann" die uralten und immer neuen Fragen des Le-
bens wieder in eine unvergleichlich persönlich künstlerische Beleuchtung gerückt hat.
Im Anschluß an den Vortrag trug Dr. Oskar Röszler-Groteck aus dem „Olym-
pischen Frühling" und eine Ballade Spittelers vor, Fräulein Irmela v. Dulong las
Prosastücke und Lyrisches.
Am Donnerstag, den 20. Juni, sprach Privatdozent Dr. Helmut Kuhn über
das Thema „Vom Ursprung kunsttheoretischer Besinnung". Die
Gedankenentwicklung des Vortrags durchlief drei verschiedene Stufen. Zuerst wurde
eine Form der Kunsttheorie ins Auge gefaßt, die aus der Kunstübung selbst als die
ihr innewohnende und ihr dienende Besinnung entspringt. Das Wesen dieser „tech-
nischen" Kunstlehre ist Dienst an der Kunst, mag sie nun als „poietische" Lehre dem
Schaffenden oder als Deutungslehre dem nachschöpferisch Genießenden behilflich sein.
Eine derartige Theorie mag wohl ihre Begriffe der Philosophie entleihen, sie selbst
ist nicht Philosophie. Ihr tritt nun, auf einer zweiten Stufe der Erwägung, die phi-
losophische Besinnung entgegen, die vom Ganzen des Lebens her, das auch die Kunst
einer kontinuierlich höher weisenden Aufgabestellung beanspruchen darf und nur in
der Ichsphäre (unter Opferung des Glücksanspruchs an die unbedingte Pflichtforde-
rung der Göttin Seele) durchzusetzen ist: Seelengröße gegen Sinnenglück, der tra-
gische Konflikt des großen Menschen.
Nach durchdringender Vergleichung von Spittelers Prometheus (1880) und
Nietzsches Zarathustra (1883) wird eine spätere geistesgeschichtliche Forschung die
Bedeutung beider Werke für die Moralphilosophie des neunzehnten Jahrhunderts fest-
zustellen haben. Ihrer Unterschiedlichkeit in Gehalt und Form entspricht der gegen
w ä r t i g e Wirkungsabstand. Er weist auf Temperamentskontraste bei beiden Män-
nern hin, auf den Gegensatz von Spittelers eindeutigem Dichtertum gegenüber
Nietzsches wandlungsbereitem Kulturdenkertum. Eine tiefe und enge Verbindung sah
und belegte der Vortragende zwischen dem Seelenglauben des Prometheus und der
Kantischen Begründung der Freiheitsidee, der Lehre von der Autonomie des Willens.
Der Olympische Frühling ist bereits von Robert Faesi als ein Gegen- und Ver-
gleichswerk zu Wagners Ring des Nibelungen genannt worden. Der mythisch epische
Charakter verbindet beide Werke, die weltanschauliche Aufhängung trennt sie. Dort
Wagners leidsüchtige Weltflucht, hier Spittelers zwar pessimistisch-tragische Lebens-
schau, aber (unlösbar davon) auch sein heldisch-tröstliches „Dennoch". Der ich-
zentrierten Haltung des Prometheus gegenüber ist der Olympische Frühling eine
reichere und farbigere Weltdichtung, die alle Höhen und Tiefen des Lebens ermißt.
Spittelers Religion ist antichristlich wie antipantheistisch, doch beiden Lehren
gegenüber duldsam, weil er ihre Berechtigung als Massenreligion anerkennt, und
weil Güte der Grundpfeiler von Spittelers Tatdenken und Sinnwollen ist. Der demü-
tigen Unterordnung der Massenseele unter einen Schöpfer stellt Spitteier den Glau-
ben an das Ur-Ich, das er als eine Göttin-Seele verbildlicht, entgegen. Sie wird
einem naturgebundenen Weltenschöpfer übergeordnet. Dieser, als Repräsentant der
Erscheinung im umfassendsten Sinne demütigt sich schließlich bei Spitteier vor der
Göttin Seele, der Verbildlichung der reinen Idee ewigen Strebens und unendlicher
Wesenheit. In ihr hat der heldische Mensch Spittelers seinen Urgrund, hierhin seine
letzte Zuflucht. Der abergläubischen Vermengung des Seelenprinzips mit dem Natur-
prinzip (ein organisatorisches Zugeständnis der Kirchen an das religiöse Unter-
ordnungsbedürfnis der Massen) stellt Spitteier eine absolute Monarchie der reinen
Idee entgegen, welche uns in ihrer psychologisch-kosmologischen Totalität nur kraft
unserer teleologischen Phantasie zugänglich ist; das Weltbild eines Künstlers.
Zu wenige, so urteilte der Vortragende, haben bisher erkannt und bekannt, daß
Carl Spitteier als ein „ewiger Mann" die uralten und immer neuen Fragen des Le-
bens wieder in eine unvergleichlich persönlich künstlerische Beleuchtung gerückt hat.
Im Anschluß an den Vortrag trug Dr. Oskar Röszler-Groteck aus dem „Olym-
pischen Frühling" und eine Ballade Spittelers vor, Fräulein Irmela v. Dulong las
Prosastücke und Lyrisches.
Am Donnerstag, den 20. Juni, sprach Privatdozent Dr. Helmut Kuhn über
das Thema „Vom Ursprung kunsttheoretischer Besinnung". Die
Gedankenentwicklung des Vortrags durchlief drei verschiedene Stufen. Zuerst wurde
eine Form der Kunsttheorie ins Auge gefaßt, die aus der Kunstübung selbst als die
ihr innewohnende und ihr dienende Besinnung entspringt. Das Wesen dieser „tech-
nischen" Kunstlehre ist Dienst an der Kunst, mag sie nun als „poietische" Lehre dem
Schaffenden oder als Deutungslehre dem nachschöpferisch Genießenden behilflich sein.
Eine derartige Theorie mag wohl ihre Begriffe der Philosophie entleihen, sie selbst
ist nicht Philosophie. Ihr tritt nun, auf einer zweiten Stufe der Erwägung, die phi-
losophische Besinnung entgegen, die vom Ganzen des Lebens her, das auch die Kunst