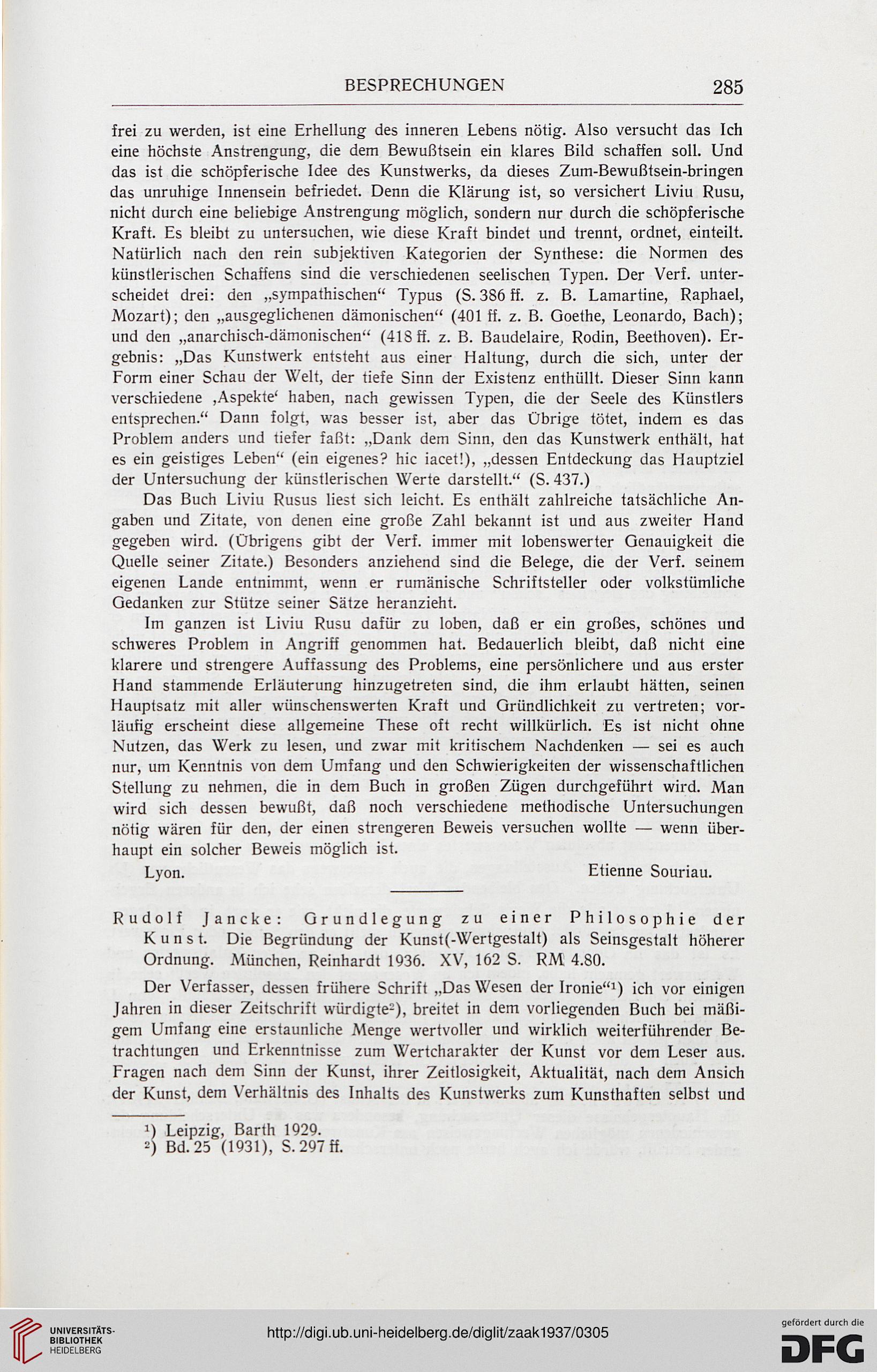BESPRECHUNGEN
285
frei zu werden, ist eine Erhellung des inneren Lebens nötig. Also versucht das Ich
eine höchste Anstrengung, die dem Bewußtsein ein klares Bild scharfen soll. Und
das ist die schöpferische Idee des Kunstwerks, da dieses Zum-Bewußtsein-bringen
das unruhige Innensein befriedet. Denn die Klärung ist, so versichert Liviu Rusu,
nicht durch eine beliebige Anstrengung möglich, sondern nur durch die schöpferische
Kraft. Es bleibt zu untersuchen, wie diese Kraft bindet und trennt, ordnet, einteilt.
Natürlich nach den rein subjektiven Kategorien der Synthese: die Normen des
künstlerischen Schaffens sind die verschiedenen seelischen Typen. Der Verf. unter-
scheidet drei: den „sympathischen" Typus (S. 386 ff. z. B. Lamartine, Raphael,
Mozart); den „ausgeglichenen dämonischen" (401 ff. z. B. Goethe, Leonardo, Bach);
und den „anarchisch-dämonischen" (418 ff. z. B. Baudelaire, Rodin, Beethoven). Er-
gebnis: „Das Kunstwerk entsteht aus einer Haltung, durch die sich, unter der
Form einer Schau der Welt, der tiefe Sinn der Existenz enthüllt. Dieser Sinn kann
verschiedene ,Aspekte' haben, nach gewissen Typen, die der Seele des Künstlers
entsprechen." Dann folgt, was besser ist, aber das Übrige tötet, indem es das
Problem anders und tiefer faßt: „Dank dem Sinn, den das Kunstwerk enthält, hat
es ein geistiges Leben" (ein eigenes? hic iacet!), „dessen Entdeckung das Hauptziel
der Untersuchung der künstlerischen Werte darstellt." (S. 437.)
Das Buch Liviu Rusus liest sich leicht. Es enthält zahlreiche tatsächliche An-
gaben und Zitate, von denen eine große Zahl bekannt ist und aus zweiter Hand
gegeben wird. (Übrigens gibt der Verf. immer mit lobenswerter Genauigkeit die
Quelle seiner Zitate.) Besonders anziehend sind die Belege, die der Verf. seinem
eigenen Lande entnimmt, wenn er rumänische Schriftsteller oder volkstümliche
Gedanken zur Stütze seiner Sätze heranzieht.
Im ganzen ist Liviu Rusu dafür zu loben, daß er ein großes, schönes und
schweres Problem in Angriff genommen hat. Bedauerlich bleibt, daß nicht eine
klarere und strengere Auffassung des Problems, eine persönlichere und aus erster
Hand stammende Erläuterung hinzugetreten sind, die ihm erlaubt hätten, seinen
Hauptsatz mit aller wünschenswerten Kraft und Gründlichkeit zu vertreten; vor-
läufig erscheint diese allgemeine These oft recht willkürlich. Es ist nicht ohne
Nutzen, das Werk zu lesen, und zwar mit kritischem Nachdenken — sei es auch
nur, um Kenntnis von dem Umfang und den Schwierigkeiten der wissenschaftlichen
Stellung zu nehmen, die in dem Buch in großen Zügen durchgeführt wird. Man
wird sich dessen bewußt, daß noch verschiedene methodische Untersuchungen
nötig wären für den, der einen strengeren Beweis versuchen wollte — wenn über-
haupt ein solcher Beweis möglich ist.
Lyon. Etienne Souriau.
Rudolf Jancke: Grundlegung zu einer Philosophie der
Kunst. Die Begründung der Kunst(-Wertgeslalt) als Seinsgestalt höherer
Ordnung. München, Reinhardt 1936. XV, 162 S. RM 4.80.
Der Verfasser, dessen frühere Schrift „Das Wesen der Ironie"1) ich vor einigen
Jahren in dieser Zeitschrift würdigte2), breitet in dem vorliegenden Buch bei mäßi-
gem Umfang eine erstaunliche Menge wertvoller und wirklich weiterführender Be-
trachtungen und Erkenntnisse zum Wertcharakter der Kunst vor dem Leser aus.
Fragen nach dem Sinn der Kunst, ihrer Zeitlosigkeit, Aktualität, nach dem Ansich
der Kunst, dem Verhältnis des Inhalts des Kunstwerks zum Kunsthaften selbst und
') Leipzig, Barth 1929.
-) Bd. 25 (1931), S. 297 ff.
285
frei zu werden, ist eine Erhellung des inneren Lebens nötig. Also versucht das Ich
eine höchste Anstrengung, die dem Bewußtsein ein klares Bild scharfen soll. Und
das ist die schöpferische Idee des Kunstwerks, da dieses Zum-Bewußtsein-bringen
das unruhige Innensein befriedet. Denn die Klärung ist, so versichert Liviu Rusu,
nicht durch eine beliebige Anstrengung möglich, sondern nur durch die schöpferische
Kraft. Es bleibt zu untersuchen, wie diese Kraft bindet und trennt, ordnet, einteilt.
Natürlich nach den rein subjektiven Kategorien der Synthese: die Normen des
künstlerischen Schaffens sind die verschiedenen seelischen Typen. Der Verf. unter-
scheidet drei: den „sympathischen" Typus (S. 386 ff. z. B. Lamartine, Raphael,
Mozart); den „ausgeglichenen dämonischen" (401 ff. z. B. Goethe, Leonardo, Bach);
und den „anarchisch-dämonischen" (418 ff. z. B. Baudelaire, Rodin, Beethoven). Er-
gebnis: „Das Kunstwerk entsteht aus einer Haltung, durch die sich, unter der
Form einer Schau der Welt, der tiefe Sinn der Existenz enthüllt. Dieser Sinn kann
verschiedene ,Aspekte' haben, nach gewissen Typen, die der Seele des Künstlers
entsprechen." Dann folgt, was besser ist, aber das Übrige tötet, indem es das
Problem anders und tiefer faßt: „Dank dem Sinn, den das Kunstwerk enthält, hat
es ein geistiges Leben" (ein eigenes? hic iacet!), „dessen Entdeckung das Hauptziel
der Untersuchung der künstlerischen Werte darstellt." (S. 437.)
Das Buch Liviu Rusus liest sich leicht. Es enthält zahlreiche tatsächliche An-
gaben und Zitate, von denen eine große Zahl bekannt ist und aus zweiter Hand
gegeben wird. (Übrigens gibt der Verf. immer mit lobenswerter Genauigkeit die
Quelle seiner Zitate.) Besonders anziehend sind die Belege, die der Verf. seinem
eigenen Lande entnimmt, wenn er rumänische Schriftsteller oder volkstümliche
Gedanken zur Stütze seiner Sätze heranzieht.
Im ganzen ist Liviu Rusu dafür zu loben, daß er ein großes, schönes und
schweres Problem in Angriff genommen hat. Bedauerlich bleibt, daß nicht eine
klarere und strengere Auffassung des Problems, eine persönlichere und aus erster
Hand stammende Erläuterung hinzugetreten sind, die ihm erlaubt hätten, seinen
Hauptsatz mit aller wünschenswerten Kraft und Gründlichkeit zu vertreten; vor-
läufig erscheint diese allgemeine These oft recht willkürlich. Es ist nicht ohne
Nutzen, das Werk zu lesen, und zwar mit kritischem Nachdenken — sei es auch
nur, um Kenntnis von dem Umfang und den Schwierigkeiten der wissenschaftlichen
Stellung zu nehmen, die in dem Buch in großen Zügen durchgeführt wird. Man
wird sich dessen bewußt, daß noch verschiedene methodische Untersuchungen
nötig wären für den, der einen strengeren Beweis versuchen wollte — wenn über-
haupt ein solcher Beweis möglich ist.
Lyon. Etienne Souriau.
Rudolf Jancke: Grundlegung zu einer Philosophie der
Kunst. Die Begründung der Kunst(-Wertgeslalt) als Seinsgestalt höherer
Ordnung. München, Reinhardt 1936. XV, 162 S. RM 4.80.
Der Verfasser, dessen frühere Schrift „Das Wesen der Ironie"1) ich vor einigen
Jahren in dieser Zeitschrift würdigte2), breitet in dem vorliegenden Buch bei mäßi-
gem Umfang eine erstaunliche Menge wertvoller und wirklich weiterführender Be-
trachtungen und Erkenntnisse zum Wertcharakter der Kunst vor dem Leser aus.
Fragen nach dem Sinn der Kunst, ihrer Zeitlosigkeit, Aktualität, nach dem Ansich
der Kunst, dem Verhältnis des Inhalts des Kunstwerks zum Kunsthaften selbst und
') Leipzig, Barth 1929.
-) Bd. 25 (1931), S. 297 ff.