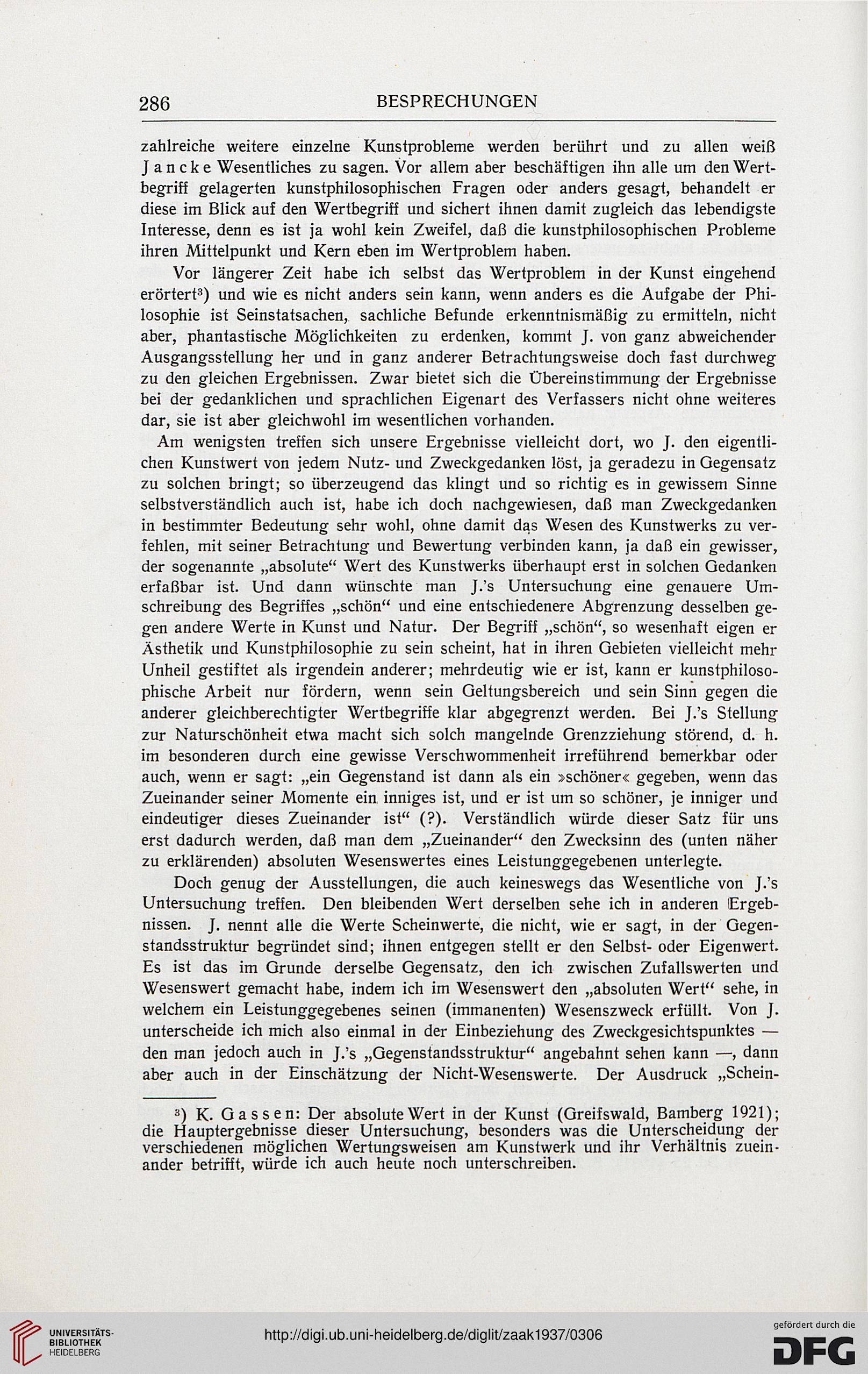286
BESPRECHUNGEN
zahlreiche weitere einzelne Kunstprobleme werden berührt und zu allen weiß
J a n c k e Wesentliches zu sagen. Vor allem aber beschäftigen ihn alle um den Wert-
begriff gelagerten kunstphilosophischen Fragen oder anders gesagt, behandelt er
diese im Blick auf den Wertbegriff und sichert ihnen damit zugleich das lebendigste
Interesse, denn es ist ja wohl kein Zweifel, daß die kunstphilosophischen Probleme
ihren Mittelpunkt und Kern eben im Wertproblem haben.
Vor längerer Zeit habe ich selbst das Wertproblem in der Kunst eingehend
erörtert3) und wie es nicht anders sein kann, wenn anders es die Aufgabe der Phi-
losophie ist Seinstatsachen, sachliche Befunde erkenntnismäßig zu ermitteln, nicht
aber, phantastische Möglichkeiten zu erdenken, kommt J. von ganz abweichender
Ausgangsstellung her und in ganz anderer Betrachtungsweise doch fast durchweg
zu den gleichen Ergebnissen. Zwar bietet sich die Übereinstimmung der Ergebnisse
bei der gedanklichen und sprachlichen Eigenart des Verfassers nicht ohne weiteres
dar, sie ist aber gleichwohl im wesentlichen vorhanden.
Am wenigsten treffen sich unsere Ergebnisse vielleicht dort, wo J. den eigentli-
chen Kunstwert von jedem Nutz- und Zweckgedanken löst, ja geradezu in Gegensatz
zu solchen bringt; so überzeugend das klingt und so richtig es in gewissem Sinne
selbstverständlich auch ist, habe ich doch nachgewiesen, daß man Zweckgedanken
in bestimmter Bedeutung sehr wohl, ohne damit das Wesen des Kunstwerks zu ver-
fehlen, mit seiner Betrachtung und Bewertung verbinden kann, ja daß ein gewisser,
der sogenannte „absolute" Wert des Kunstwerks überhaupt erst in solchen Gedanken
erfaßbar ist. Und dann wünschte man J.'s Untersuchung eine genauere Um-
schreibung des Begriffes „schön" und eine entschiedenere Abgrenzung desselben ge-
gen andere Werte in Kunst und Natur. Der Begriff „schön", so wesenhaft eigen er
Ästhetik und Kunstphilosophie zu sein scheint, hat in ihren Gebieten vielleicht mehr
Unheil gestiftet als irgendein anderer; mehrdeutig wie er ist, kann er kunstphiloso-
phische Arbeit nur fördern, wenn sein Geltungsbereich und sein Sinn gegen die
anderer gleichberechtigter Wertbegriffe klar abgegrenzt werden. Bei J.'s Stellung
zur Naturschönheit etwa macht sich solch mangelnde Grenzziehung störend, d. h.
im besonderen durch eine gewisse Verschwommenheit irreführend bemerkbar oder
auch, wenn er sagt: „ein Gegenstand ist dann als ein »schöner« gegeben, wenn das
Zueinander seiner Momente ein inniges ist, und er ist um so schöner, je inniger und
eindeutiger dieses Zueinander ist" (?). Verständlich würde dieser Satz für uns
erst dadurch werden, daß man dem „Zueinander" den Zwecksinn des (unten näher
zu erklärenden) absoluten Wesenswertes eines Leistunggegebenen unterlegte.
Doch genug der Ausstellungen, die auch keineswegs das Wesentliche von J.'s
Untersuchung treffen. Den bleibenden Wert derselben sehe ich in anderen Ergeb-
nissen. J. nennt alle die Werte Scheinwerte, die nicht, wie er sagt, in der Gegen-
standsstruktur begründet sind; ihnen entgegen stellt er den Selbst- oder Eigenwert.
Es ist das im Grunde derselbe Gegensatz, den ich zwischen Zufallswerten und
Wesenswert gemacht habe, indem ich im Wesenswert den „absoluten Wert" sehe, in
welchem ein Leistunggegebenes seinen (immanenten) Wesenszweck erfüllt. Von J.
unterscheide ich mich also einmal in der Einbeziehung des Zweckgesichtspunktes —
den man jedoch auch in J.'s „Gegenstandsstruktur" angebahnt sehen kann —, dann
aber auch in der Einschätzung der Nicht-Wesenswerte. Der Ausdruck „Schein-
3) K. Gassen: Der absolute Wert in der Kunst (Greifswald, Bamberg 1921);
die Hauptergebnisse dieser Untersuchung, besonders was die Unterscheidung der
verschiedenen möglichen Wertungsweisen am Kunstwerk und ihr Verhältnis zuein-
ander betrifft, würde ich auch heute noch unterschreiben.
BESPRECHUNGEN
zahlreiche weitere einzelne Kunstprobleme werden berührt und zu allen weiß
J a n c k e Wesentliches zu sagen. Vor allem aber beschäftigen ihn alle um den Wert-
begriff gelagerten kunstphilosophischen Fragen oder anders gesagt, behandelt er
diese im Blick auf den Wertbegriff und sichert ihnen damit zugleich das lebendigste
Interesse, denn es ist ja wohl kein Zweifel, daß die kunstphilosophischen Probleme
ihren Mittelpunkt und Kern eben im Wertproblem haben.
Vor längerer Zeit habe ich selbst das Wertproblem in der Kunst eingehend
erörtert3) und wie es nicht anders sein kann, wenn anders es die Aufgabe der Phi-
losophie ist Seinstatsachen, sachliche Befunde erkenntnismäßig zu ermitteln, nicht
aber, phantastische Möglichkeiten zu erdenken, kommt J. von ganz abweichender
Ausgangsstellung her und in ganz anderer Betrachtungsweise doch fast durchweg
zu den gleichen Ergebnissen. Zwar bietet sich die Übereinstimmung der Ergebnisse
bei der gedanklichen und sprachlichen Eigenart des Verfassers nicht ohne weiteres
dar, sie ist aber gleichwohl im wesentlichen vorhanden.
Am wenigsten treffen sich unsere Ergebnisse vielleicht dort, wo J. den eigentli-
chen Kunstwert von jedem Nutz- und Zweckgedanken löst, ja geradezu in Gegensatz
zu solchen bringt; so überzeugend das klingt und so richtig es in gewissem Sinne
selbstverständlich auch ist, habe ich doch nachgewiesen, daß man Zweckgedanken
in bestimmter Bedeutung sehr wohl, ohne damit das Wesen des Kunstwerks zu ver-
fehlen, mit seiner Betrachtung und Bewertung verbinden kann, ja daß ein gewisser,
der sogenannte „absolute" Wert des Kunstwerks überhaupt erst in solchen Gedanken
erfaßbar ist. Und dann wünschte man J.'s Untersuchung eine genauere Um-
schreibung des Begriffes „schön" und eine entschiedenere Abgrenzung desselben ge-
gen andere Werte in Kunst und Natur. Der Begriff „schön", so wesenhaft eigen er
Ästhetik und Kunstphilosophie zu sein scheint, hat in ihren Gebieten vielleicht mehr
Unheil gestiftet als irgendein anderer; mehrdeutig wie er ist, kann er kunstphiloso-
phische Arbeit nur fördern, wenn sein Geltungsbereich und sein Sinn gegen die
anderer gleichberechtigter Wertbegriffe klar abgegrenzt werden. Bei J.'s Stellung
zur Naturschönheit etwa macht sich solch mangelnde Grenzziehung störend, d. h.
im besonderen durch eine gewisse Verschwommenheit irreführend bemerkbar oder
auch, wenn er sagt: „ein Gegenstand ist dann als ein »schöner« gegeben, wenn das
Zueinander seiner Momente ein inniges ist, und er ist um so schöner, je inniger und
eindeutiger dieses Zueinander ist" (?). Verständlich würde dieser Satz für uns
erst dadurch werden, daß man dem „Zueinander" den Zwecksinn des (unten näher
zu erklärenden) absoluten Wesenswertes eines Leistunggegebenen unterlegte.
Doch genug der Ausstellungen, die auch keineswegs das Wesentliche von J.'s
Untersuchung treffen. Den bleibenden Wert derselben sehe ich in anderen Ergeb-
nissen. J. nennt alle die Werte Scheinwerte, die nicht, wie er sagt, in der Gegen-
standsstruktur begründet sind; ihnen entgegen stellt er den Selbst- oder Eigenwert.
Es ist das im Grunde derselbe Gegensatz, den ich zwischen Zufallswerten und
Wesenswert gemacht habe, indem ich im Wesenswert den „absoluten Wert" sehe, in
welchem ein Leistunggegebenes seinen (immanenten) Wesenszweck erfüllt. Von J.
unterscheide ich mich also einmal in der Einbeziehung des Zweckgesichtspunktes —
den man jedoch auch in J.'s „Gegenstandsstruktur" angebahnt sehen kann —, dann
aber auch in der Einschätzung der Nicht-Wesenswerte. Der Ausdruck „Schein-
3) K. Gassen: Der absolute Wert in der Kunst (Greifswald, Bamberg 1921);
die Hauptergebnisse dieser Untersuchung, besonders was die Unterscheidung der
verschiedenen möglichen Wertungsweisen am Kunstwerk und ihr Verhältnis zuein-
ander betrifft, würde ich auch heute noch unterschreiben.