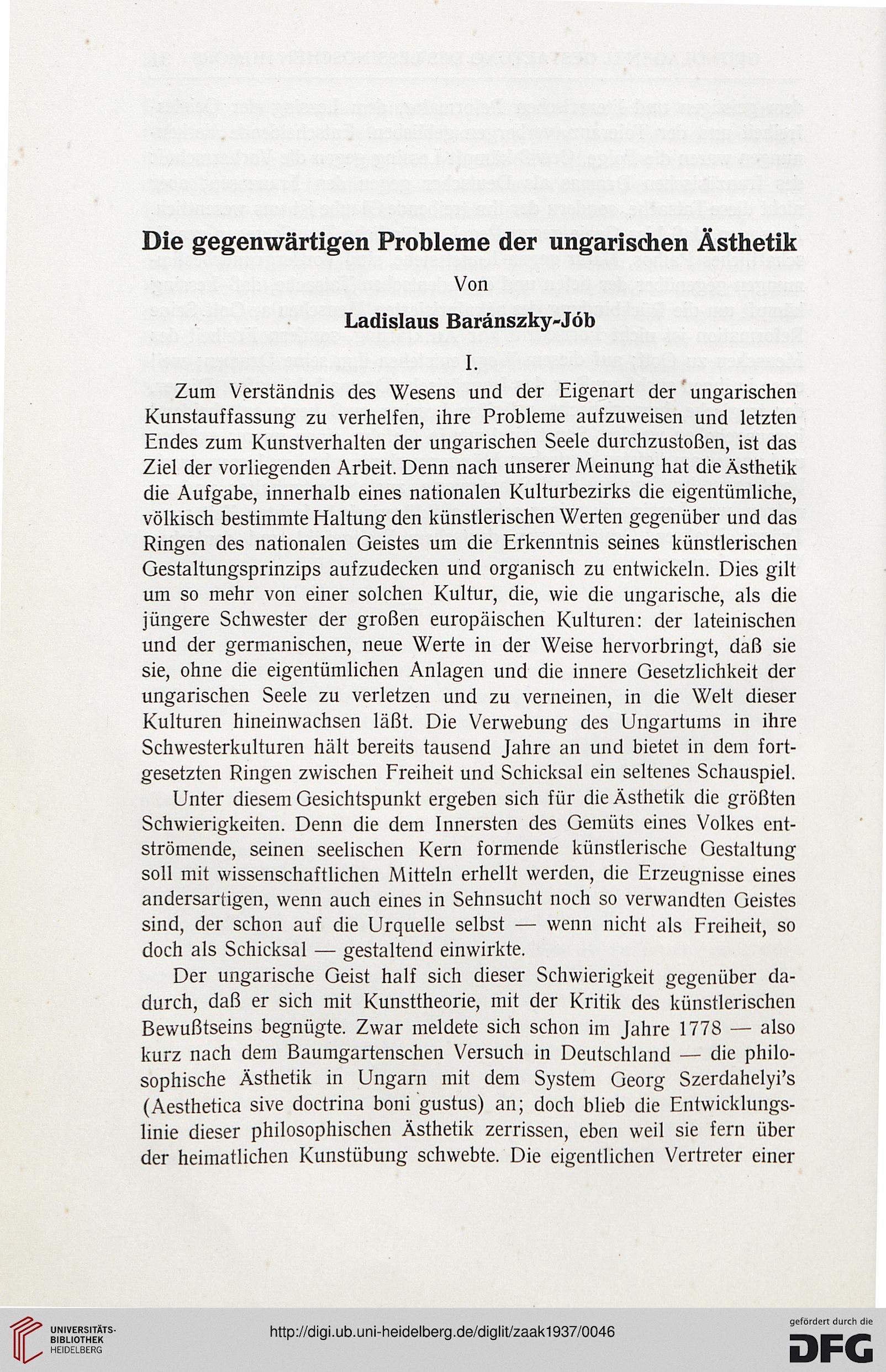Die gegenwärtigen Probleme der ungarischen Ästhetik
Von
Ladislaus Baränszky-Jöb
I.
Zum Verständnis des Wesens und der Eigenart der' ungarischen
Kunstauffassung zu verhelfen, ihre Probleme aufzuweisen und letzten
Endes zum Kunstverhalten der ungarischen Seele durchzustoßen, ist das
Ziel der vorliegenden Arbeit. Denn nach unserer Meinung hat die Ästhetik
die Aufgabe, innerhalb eines nationalen Kulturbezirks die eigentümliche,
völkisch bestimmte Haltung den künstlerischen Werten gegenüber und das
Ringen des nationalen Geistes um die Erkenntnis seines künstlerischen
Gestaltungsprinzips aufzudecken und organisch zu entwickeln. Dies gilt
um so mehr von einer solchen Kultur, die, wie die ungarische, als die
jüngere Schwester der großen europäischen Kulturen: der lateinischen
und der germanischen, neue Werte in der Weise hervorbringt, daß sie
sie, ohne die eigentümlichen Anlagen und die innere Gesetzlichkeit der
ungarischen Seele zu verletzen und zu verneinen, in die Welt dieser
Kulturen hineinwachsen läßt. Die Verwebung des Ungartums in ihre
Schwesterkulturen hält bereits tausend Jahre an und bietet in dem fort-
gesetzten Ringen zwischen Freiheit und Schicksal ein seltenes Schauspiel.
Unter diesem Gesichtspunkt ergeben sich für die Ästhetik die größten
Schwierigkeiten. Denn die dem Innersten des Gemüts eines Volkes ent-
strömende, seinen seelischen Kern formende künstlerische Gestaltung
soll mit wissenschaftlichen Mitteln erhellt werden, die Erzeugnisse eines
andersartigen, wenn auch eines in Sehnsucht noch so verwandten Geistes
sind, der schon auf die Urquelle selbst — wenn nicht als Freiheit, so
doch als Schicksal — gestaltend einwirkte.
Der ungarische Geist half sich dieser Schwierigkeit gegenüber da-
durch, daß er sich mit Kunsttheorie, mit der Kritik des künstlerischen
Bewußtseins begnügte. Zwar meldete sich schon im Jahre 1778 — also
kurz nach dem Baumgartenschen Versuch in Deutschland — die philo-
sophische Ästhetik in Ungarn mit dem System Georg Szerdahelyi's
(Aesthetica sive doctrina boni gustus) an; doch blieb die Entwicklungs-
linie dieser philosophischen Ästhetik zerrissen, eben weil sie fern über
der heimatlichen Kunstübung schwebte. Die eigentlichen Vertreter einer
Von
Ladislaus Baränszky-Jöb
I.
Zum Verständnis des Wesens und der Eigenart der' ungarischen
Kunstauffassung zu verhelfen, ihre Probleme aufzuweisen und letzten
Endes zum Kunstverhalten der ungarischen Seele durchzustoßen, ist das
Ziel der vorliegenden Arbeit. Denn nach unserer Meinung hat die Ästhetik
die Aufgabe, innerhalb eines nationalen Kulturbezirks die eigentümliche,
völkisch bestimmte Haltung den künstlerischen Werten gegenüber und das
Ringen des nationalen Geistes um die Erkenntnis seines künstlerischen
Gestaltungsprinzips aufzudecken und organisch zu entwickeln. Dies gilt
um so mehr von einer solchen Kultur, die, wie die ungarische, als die
jüngere Schwester der großen europäischen Kulturen: der lateinischen
und der germanischen, neue Werte in der Weise hervorbringt, daß sie
sie, ohne die eigentümlichen Anlagen und die innere Gesetzlichkeit der
ungarischen Seele zu verletzen und zu verneinen, in die Welt dieser
Kulturen hineinwachsen läßt. Die Verwebung des Ungartums in ihre
Schwesterkulturen hält bereits tausend Jahre an und bietet in dem fort-
gesetzten Ringen zwischen Freiheit und Schicksal ein seltenes Schauspiel.
Unter diesem Gesichtspunkt ergeben sich für die Ästhetik die größten
Schwierigkeiten. Denn die dem Innersten des Gemüts eines Volkes ent-
strömende, seinen seelischen Kern formende künstlerische Gestaltung
soll mit wissenschaftlichen Mitteln erhellt werden, die Erzeugnisse eines
andersartigen, wenn auch eines in Sehnsucht noch so verwandten Geistes
sind, der schon auf die Urquelle selbst — wenn nicht als Freiheit, so
doch als Schicksal — gestaltend einwirkte.
Der ungarische Geist half sich dieser Schwierigkeit gegenüber da-
durch, daß er sich mit Kunsttheorie, mit der Kritik des künstlerischen
Bewußtseins begnügte. Zwar meldete sich schon im Jahre 1778 — also
kurz nach dem Baumgartenschen Versuch in Deutschland — die philo-
sophische Ästhetik in Ungarn mit dem System Georg Szerdahelyi's
(Aesthetica sive doctrina boni gustus) an; doch blieb die Entwicklungs-
linie dieser philosophischen Ästhetik zerrissen, eben weil sie fern über
der heimatlichen Kunstübung schwebte. Die eigentlichen Vertreter einer