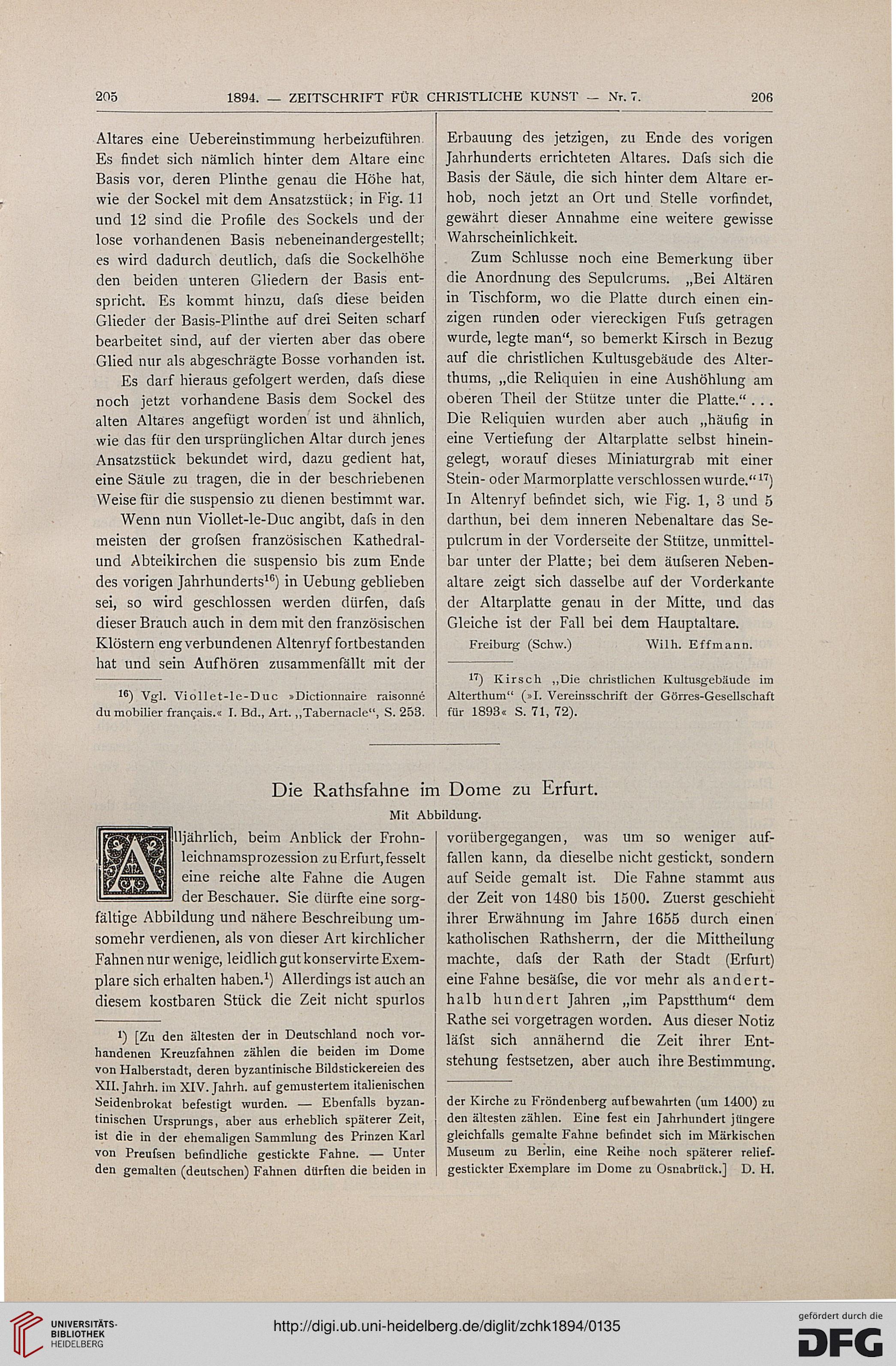205
1894. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr.'
206
Altares eine Uebereinstimmung herbeizuführen.
Es findet sich nämlich hinter dem Altare eine
Basis vor, deren Plinthe genau die Höhe hat,
wie der Sockel mit dem Ansatzstück; in Fig. 11
und 12 sind die Profile des Sockels und der
lose vorhandenen Basis nebeneinandergestellt;
es wird dadurch deutlich, dafs die Sockelhöhe
den beiden unteren Gliedern der Basis ent-
spricht. Es kommt hinzu, dafs diese beiden
Glieder der Basis-Plinthe auf drei Seiten scharf
bearbeitet sind, auf der vierten aber das obere
Glied nur als abgeschrägte Bosse vorhanden ist.
Es darf hieraus gefolgert werden, dafs diese
noch jetzt vorhandene Basis dem Sockel des
alten Altares angefügt worden ist und ähnlich,
wie das für den ursprünglichen Altar durch jenes
Ansatzstück bekundet wird, dazu gedient hat,
eine Säule zu tragen, die in der beschriebenen
Weise für die suspensio zu dienen bestimmt war.
Wenn nun Viollet-le-Duc angibt, dafs in den
meisten der grofsen französischen Kathedral-
und Abteikirchen die suspensio bis zum Ende
des vorigen Jahrhunderts16) in Uebung geblieben
sei, so wird geschlossen werden dürfen, dafs
dieser Brauch auch in dem mit den französischen
Klöstern eng verbundenen Altenryf fortbestanden
hat und sein Aufhören zusammenfällt mit der
16) Vgl. Viollet-le-Duc »Dictionnaire raisonne
dumobilier francais.« I. Bd., Art. „Tabernacle", S. 253.
Erbauung des jetzigen, zu Ende des vorigen
Jahrhunderts errichteten Altares. Dafs sich die
Basis der Säule, die sich hinter dem Altare er-
hob, noch jetzt an Ort und Stelle vorfindet,
gewährt dieser Annahme eine weitere gewisse
Wahrscheinlichkeit.
Zum Schlüsse noch eine Bemerkung über
die Anordnung des Sepulcrums. „Bei Altären
in Tischform, wo die Platte durch einen ein-
zigen runden oder viereckigen Fufs getragen
wurde, legte man", so bemerkt Kirsch in Bezug
auf die christlichen Kultusgebäude des Alter-
thums, „die Reliquien in eine Aushöhlung am
oberen Theil der Stütze unter die Platte." . . .
Die Reliquien wurden aber auch „häufig in
eine Vertiefung der Altarplatte selbst hinein-
gelegt, worauf dieses Miniaturgrab mit einer
Stein- oder Marmorplatte verschlossen wurde."17)
In Altenryf befindet sich, wie Fig. 1, 3 und 5
darthun, bei dem inneren Nebenaltare das Se-
pulcrum in der Vorderseite der Stütze, unmittel-
bar unter der Platte; bei dem äufseren Neben-
altare zeigt sich dasselbe auf der Vorderkante
der Altarplatte genau in der Mitte, und das
Gleiche ist der Fall bei dem Hauptaltare.
Freiburg (Schw.) Wilh. Effmann.
17) Kirsch „Die christlichen Kultusgebäude im
Alterthum" (»I. Vereinsschrift der Görres-Gesellschaft
für 1893« S. 71, 72).
Die Rathsfahne im Dome zu Erfurt.
Mit Abbildung.
lljährlich, beim Anblick der Frohn-
leichnamsprozession zu Erfurt, fesselt
eine reiche alte Fahne die Augen
der Beschauer. Sie dürfte eine sorg-
fältige Abbildung und nähere Beschreibung um-
somehr verdienen, als von dieser Art kirchlicher
Fahnen nur wenige, leidlich gut konservirte Exem-
plare sich erhalten haben.1) Allerdings ist auch an
diesem kostbaren Stück die Zeit nicht spurlos
l) [Zu den ältesten der in Deutschland noch vor-
handenen Kreuzfahnen zählen die beiden im Dome
von Halberstadt, deren byzantinische Bildstickereien des
XII. Jahrh. im XIV. Jahrh. auf gemustertem italienischen
Seidenbrokat befestigt wurden. — Ebenfalls byzan-
tinischen Ursprungs, aber aus erheblich späterer Zeit,
ist die in der ehemaligen Sammlung des Prinzen Karl
von Preufsen befindliche gestickte Fahne. — Unter
den gemalten (deutschen) Fahnen dürften die beiden in
vorübergegangen, was um so weniger auf-
fallen kann, da dieselbe nicht gestickt, sondern
auf Seide gemalt ist. Die Fahne stammt aus
der Zeit von 1480 bis 1500. Zuerst geschieht
ihrer Erwähnung im Jahre 1655 durch einen
katholischen Rathsherrn, der die Mittheilung
machte, dafs der Rath der Stadt (Erfurt)
eine Fahne besäfse, die vor mehr als andert-
halb hundert Jahren „im Papstthum" dem
Rathe sei vorgetragen worden. Aus dieser Notiz
läfst sich annähernd die Zeit ihrer Ent-
stehung festsetzen, aber auch ihre Bestimmung.
der Kirche zu Fröndenberg aufbewahrten (um 1400) zu
den ältesten zählen. Eine fest ein Jahrhundert jüngere
gleichfalls gemalte Fahne befindet sich im Märkischen
Museum zu Berlin, eine Reihe noch späterer relief-
gestickter Exemplare im Dome zu Osnabrück.] D. H.
1894. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr.'
206
Altares eine Uebereinstimmung herbeizuführen.
Es findet sich nämlich hinter dem Altare eine
Basis vor, deren Plinthe genau die Höhe hat,
wie der Sockel mit dem Ansatzstück; in Fig. 11
und 12 sind die Profile des Sockels und der
lose vorhandenen Basis nebeneinandergestellt;
es wird dadurch deutlich, dafs die Sockelhöhe
den beiden unteren Gliedern der Basis ent-
spricht. Es kommt hinzu, dafs diese beiden
Glieder der Basis-Plinthe auf drei Seiten scharf
bearbeitet sind, auf der vierten aber das obere
Glied nur als abgeschrägte Bosse vorhanden ist.
Es darf hieraus gefolgert werden, dafs diese
noch jetzt vorhandene Basis dem Sockel des
alten Altares angefügt worden ist und ähnlich,
wie das für den ursprünglichen Altar durch jenes
Ansatzstück bekundet wird, dazu gedient hat,
eine Säule zu tragen, die in der beschriebenen
Weise für die suspensio zu dienen bestimmt war.
Wenn nun Viollet-le-Duc angibt, dafs in den
meisten der grofsen französischen Kathedral-
und Abteikirchen die suspensio bis zum Ende
des vorigen Jahrhunderts16) in Uebung geblieben
sei, so wird geschlossen werden dürfen, dafs
dieser Brauch auch in dem mit den französischen
Klöstern eng verbundenen Altenryf fortbestanden
hat und sein Aufhören zusammenfällt mit der
16) Vgl. Viollet-le-Duc »Dictionnaire raisonne
dumobilier francais.« I. Bd., Art. „Tabernacle", S. 253.
Erbauung des jetzigen, zu Ende des vorigen
Jahrhunderts errichteten Altares. Dafs sich die
Basis der Säule, die sich hinter dem Altare er-
hob, noch jetzt an Ort und Stelle vorfindet,
gewährt dieser Annahme eine weitere gewisse
Wahrscheinlichkeit.
Zum Schlüsse noch eine Bemerkung über
die Anordnung des Sepulcrums. „Bei Altären
in Tischform, wo die Platte durch einen ein-
zigen runden oder viereckigen Fufs getragen
wurde, legte man", so bemerkt Kirsch in Bezug
auf die christlichen Kultusgebäude des Alter-
thums, „die Reliquien in eine Aushöhlung am
oberen Theil der Stütze unter die Platte." . . .
Die Reliquien wurden aber auch „häufig in
eine Vertiefung der Altarplatte selbst hinein-
gelegt, worauf dieses Miniaturgrab mit einer
Stein- oder Marmorplatte verschlossen wurde."17)
In Altenryf befindet sich, wie Fig. 1, 3 und 5
darthun, bei dem inneren Nebenaltare das Se-
pulcrum in der Vorderseite der Stütze, unmittel-
bar unter der Platte; bei dem äufseren Neben-
altare zeigt sich dasselbe auf der Vorderkante
der Altarplatte genau in der Mitte, und das
Gleiche ist der Fall bei dem Hauptaltare.
Freiburg (Schw.) Wilh. Effmann.
17) Kirsch „Die christlichen Kultusgebäude im
Alterthum" (»I. Vereinsschrift der Görres-Gesellschaft
für 1893« S. 71, 72).
Die Rathsfahne im Dome zu Erfurt.
Mit Abbildung.
lljährlich, beim Anblick der Frohn-
leichnamsprozession zu Erfurt, fesselt
eine reiche alte Fahne die Augen
der Beschauer. Sie dürfte eine sorg-
fältige Abbildung und nähere Beschreibung um-
somehr verdienen, als von dieser Art kirchlicher
Fahnen nur wenige, leidlich gut konservirte Exem-
plare sich erhalten haben.1) Allerdings ist auch an
diesem kostbaren Stück die Zeit nicht spurlos
l) [Zu den ältesten der in Deutschland noch vor-
handenen Kreuzfahnen zählen die beiden im Dome
von Halberstadt, deren byzantinische Bildstickereien des
XII. Jahrh. im XIV. Jahrh. auf gemustertem italienischen
Seidenbrokat befestigt wurden. — Ebenfalls byzan-
tinischen Ursprungs, aber aus erheblich späterer Zeit,
ist die in der ehemaligen Sammlung des Prinzen Karl
von Preufsen befindliche gestickte Fahne. — Unter
den gemalten (deutschen) Fahnen dürften die beiden in
vorübergegangen, was um so weniger auf-
fallen kann, da dieselbe nicht gestickt, sondern
auf Seide gemalt ist. Die Fahne stammt aus
der Zeit von 1480 bis 1500. Zuerst geschieht
ihrer Erwähnung im Jahre 1655 durch einen
katholischen Rathsherrn, der die Mittheilung
machte, dafs der Rath der Stadt (Erfurt)
eine Fahne besäfse, die vor mehr als andert-
halb hundert Jahren „im Papstthum" dem
Rathe sei vorgetragen worden. Aus dieser Notiz
läfst sich annähernd die Zeit ihrer Ent-
stehung festsetzen, aber auch ihre Bestimmung.
der Kirche zu Fröndenberg aufbewahrten (um 1400) zu
den ältesten zählen. Eine fest ein Jahrhundert jüngere
gleichfalls gemalte Fahne befindet sich im Märkischen
Museum zu Berlin, eine Reihe noch späterer relief-
gestickter Exemplare im Dome zu Osnabrück.] D. H.