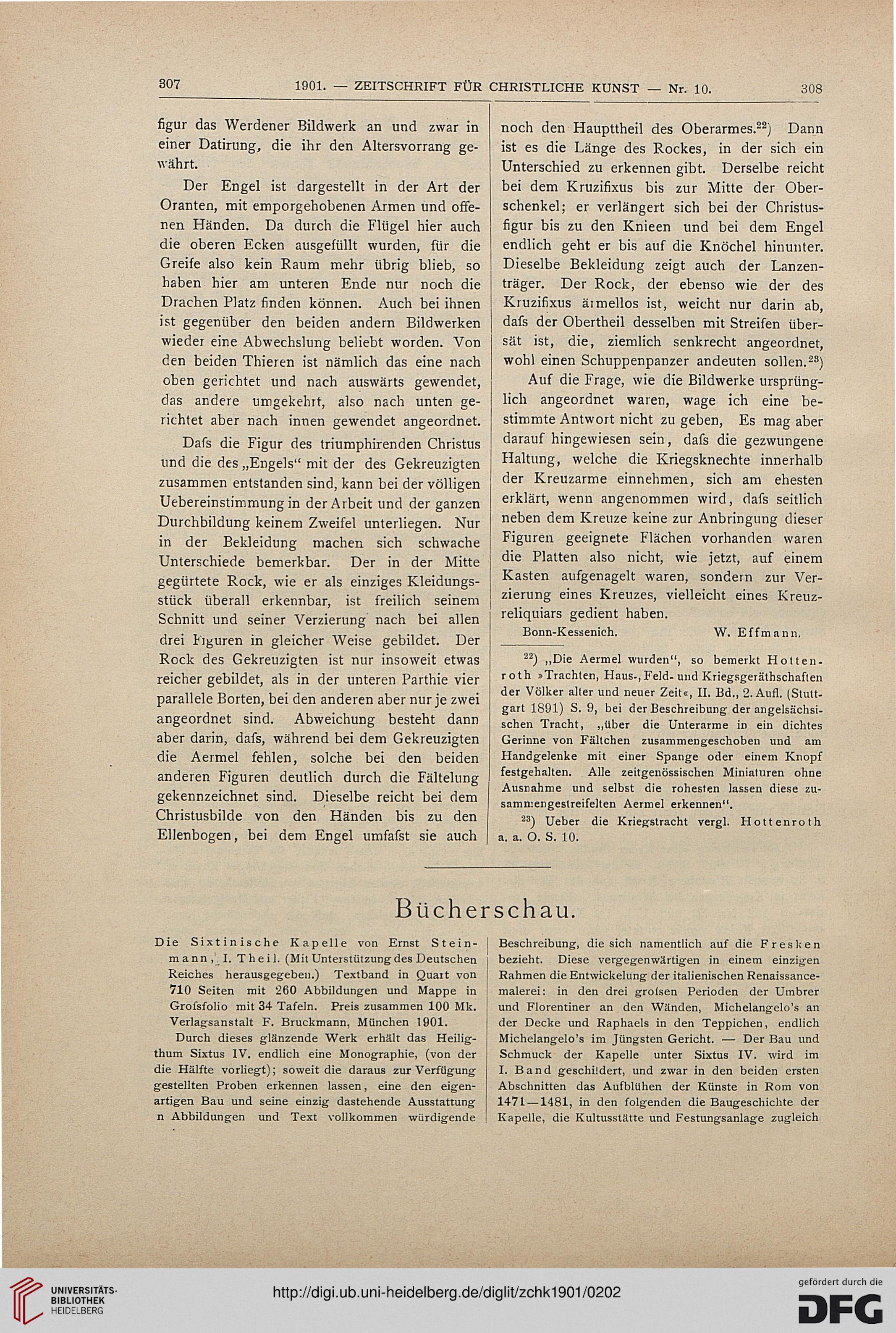307
1901.
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 10.
308
figur das Werdener Bildwerk an und zwar in
einer Datirung, die ihr den Altersvorrang ge-
währt.
Der Engel ist dargestellt in der Art der
Oranten, mit emporgehobenen Armen und offe-
nen Händen. Da durch die Flügel hier auch
die oberen Ecken ausgefüllt wurden, für die
Greife also kein Raum mehr übrig blieb, so
haben hier am unteren Ende nur noch die
Drachen Platz finden können. Auch bei ihnen
ist gegenüber den beiden andern Bildwerken
wieder eine Abwechslung beliebt worden. Von
den beiden Thieren ist nämlich das eine nach
oben gerichtet und nach auswärts gewendet,
das andere umgekehrt, also nach unten ge-
richtet aber nach innen gewendet angeordnet.
Dafs die Figur des triumphirenden Christus
und die des „Engels" mit der des Gekreuzigten
zusammen entstanden sind, kann bei der völligen
Uebereinstimmung in der Arbeit und der ganzen
Durchbildung keinem Zweifel unterliegen. Nur
in der Bekleidung machen sich schwache
Unterschiede bemerkbar. Der in der Mitte
gegürtete Rock, wie er als einziges Kleidungs-
stück überall erkennbar, ist freilich seinem
Schnitt und seiner Verzierung nach bei allen
drei Figuren in gleicher Weise gebildet. Der
Rock des Gekreuzigten ist nur insoweit etwas
reicher gebildet, als in der unteren Parthie vier
parallele Borten, bei den anderen aber nur je zwei
angeordnet sind. Abweichung besteht dann
aber darin, dafs, während bei dem Gekreuzigten
die Aermel fehlen, solche bei den beiden
anderen Figuren deutlich durch die Fältelung
gekennzeichnet sind. Dieselbe reicht bei dem
Christusbilde von den Händen bis zu den
Ellenbogen, bei dem Engel umfafst sie auch
noch den Haupttheil des Oberarmes.22) Dann
ist es die Länge des Rockes, in der sich ein
Unterschied zu erkennen gibt. Derselbe reicht
bei dem Kruzifixus bis zur Mitte der Ober-
schenkel; er verlängert sich bei der Christus-
figur bis zu den Knieen und bei dem Engel
endlich geht er bis auf die Knöchel hinunter.
Dieselbe Bekleidung zeigt auch der Lanzen-
träger. Der Rock, der ebenso wie der des
Kruzifixus äimellos ist, weicht nur darin ab,
dafs der Obertheil desselben mit Streifen über-
sät ist, die, ziemlich senkrecht angeordnet,
wohl einen Schuppenpanzer andeuten sollen.28)
Auf die Frage, wie die Bildwerke ursprüng-
lich angeordnet waren, wage ich eine be-
stimmte Antwort nicht zu geben, Es mag aber
darauf hingewiesen sein, dafs die gezwungene
Haltung, welche die Kriegsknechte innerhalb
der Kreuzarme einnehmen, sich am ehesten
erklärt, wenn angenommen wird, dafs seitlich
neben dem Kreuze keine zur Anbringung dieser
Figuren geeignete Flächen vorhanden waren
die Platten also nicht, wie jetzt, auf einem
Kasten aufgenagelt waren, sondern zur Ver-
zierung eines Kreuzes, vielleicht eines Kreuz-
reliquiars gedient haben.
Bonn-Kessenich. W. Effmann.
22) „Die Aermel wurden", so bemerkt Hotten-
roth »Trachten, Haus-,Feld- und Kriegsgeräthschaften
der Völker alter und neuer Zeit«, II. Bd., 2. Aufl. (Stutt-
gart 1891) S. 9, bei der Beschreibung der angelsächsi-
schen Tracht, „über die Unterarme in ein dichtes
Gerinne von Fältchen zusammengeschoben und am
Handgelenke mit einer Spange oder einem Knopf
festgehalten. Alle zeitgenössischen Miniaturen ohne
Ausnahme und selbst die rohesten lassen diese zu-
sammengestreifelten Aermel erkennen".
23) Ueber die Kriegstracht vergl. Hottenroth
a. a. O. S. 10.
Bücherschau.
Die Sixtinische Kapelle von Ernst Stein-
mann, \I. Theil. (Mit Unterstützung des Deutschen
Reiches herausgegeben.) Textband in Quart von
710 Seiten mit 260 Abbildungen und Mappe in
Grofsfolio mit 34 Tafeln. Preis zusammen 100 Mk.
Verlagsanstalt F. Bruckmann, München 1901.
Durch dieses glänzende Werk erhält das Heilig-
thum Sixtus IV. endlich eine Monographie, (von der
die Hälfte vorliegt); soweit die daraus zur Verfügung
gestellten Proben erkennen lassen, eine den eigen-
artigen Bau und seine einzig dastehende Ausstattung
n Abbildungen und Text vollkommen würdigende
Beschreibung, die sich namentlich auf die Fresken
bezieht. Diese vergegenwärtigen in einem einzigen
Rahmen die Entwickelung der italienischen Renaissance-
malerei: in den drei grolsen Perioden der Umbrer
und Florentiner an den Wänden, Michelangelo's an
der Decke und Raphaels in den Teppichen, endlich
Michelangelo's im Jüngsten Gericht. — Der Bau und
Schmuck der Kapelle unter Sixtus IV. wird im
I. Band geschildert, und zwar in den beiden ersten
Abschnitten das Aufblühen der Künste in Rom von
1471—1481, in den folgenden die Baugeschichte der
Kapelle, die Kultusstätte und Festungsanlage zugleich
1901.
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 10.
308
figur das Werdener Bildwerk an und zwar in
einer Datirung, die ihr den Altersvorrang ge-
währt.
Der Engel ist dargestellt in der Art der
Oranten, mit emporgehobenen Armen und offe-
nen Händen. Da durch die Flügel hier auch
die oberen Ecken ausgefüllt wurden, für die
Greife also kein Raum mehr übrig blieb, so
haben hier am unteren Ende nur noch die
Drachen Platz finden können. Auch bei ihnen
ist gegenüber den beiden andern Bildwerken
wieder eine Abwechslung beliebt worden. Von
den beiden Thieren ist nämlich das eine nach
oben gerichtet und nach auswärts gewendet,
das andere umgekehrt, also nach unten ge-
richtet aber nach innen gewendet angeordnet.
Dafs die Figur des triumphirenden Christus
und die des „Engels" mit der des Gekreuzigten
zusammen entstanden sind, kann bei der völligen
Uebereinstimmung in der Arbeit und der ganzen
Durchbildung keinem Zweifel unterliegen. Nur
in der Bekleidung machen sich schwache
Unterschiede bemerkbar. Der in der Mitte
gegürtete Rock, wie er als einziges Kleidungs-
stück überall erkennbar, ist freilich seinem
Schnitt und seiner Verzierung nach bei allen
drei Figuren in gleicher Weise gebildet. Der
Rock des Gekreuzigten ist nur insoweit etwas
reicher gebildet, als in der unteren Parthie vier
parallele Borten, bei den anderen aber nur je zwei
angeordnet sind. Abweichung besteht dann
aber darin, dafs, während bei dem Gekreuzigten
die Aermel fehlen, solche bei den beiden
anderen Figuren deutlich durch die Fältelung
gekennzeichnet sind. Dieselbe reicht bei dem
Christusbilde von den Händen bis zu den
Ellenbogen, bei dem Engel umfafst sie auch
noch den Haupttheil des Oberarmes.22) Dann
ist es die Länge des Rockes, in der sich ein
Unterschied zu erkennen gibt. Derselbe reicht
bei dem Kruzifixus bis zur Mitte der Ober-
schenkel; er verlängert sich bei der Christus-
figur bis zu den Knieen und bei dem Engel
endlich geht er bis auf die Knöchel hinunter.
Dieselbe Bekleidung zeigt auch der Lanzen-
träger. Der Rock, der ebenso wie der des
Kruzifixus äimellos ist, weicht nur darin ab,
dafs der Obertheil desselben mit Streifen über-
sät ist, die, ziemlich senkrecht angeordnet,
wohl einen Schuppenpanzer andeuten sollen.28)
Auf die Frage, wie die Bildwerke ursprüng-
lich angeordnet waren, wage ich eine be-
stimmte Antwort nicht zu geben, Es mag aber
darauf hingewiesen sein, dafs die gezwungene
Haltung, welche die Kriegsknechte innerhalb
der Kreuzarme einnehmen, sich am ehesten
erklärt, wenn angenommen wird, dafs seitlich
neben dem Kreuze keine zur Anbringung dieser
Figuren geeignete Flächen vorhanden waren
die Platten also nicht, wie jetzt, auf einem
Kasten aufgenagelt waren, sondern zur Ver-
zierung eines Kreuzes, vielleicht eines Kreuz-
reliquiars gedient haben.
Bonn-Kessenich. W. Effmann.
22) „Die Aermel wurden", so bemerkt Hotten-
roth »Trachten, Haus-,Feld- und Kriegsgeräthschaften
der Völker alter und neuer Zeit«, II. Bd., 2. Aufl. (Stutt-
gart 1891) S. 9, bei der Beschreibung der angelsächsi-
schen Tracht, „über die Unterarme in ein dichtes
Gerinne von Fältchen zusammengeschoben und am
Handgelenke mit einer Spange oder einem Knopf
festgehalten. Alle zeitgenössischen Miniaturen ohne
Ausnahme und selbst die rohesten lassen diese zu-
sammengestreifelten Aermel erkennen".
23) Ueber die Kriegstracht vergl. Hottenroth
a. a. O. S. 10.
Bücherschau.
Die Sixtinische Kapelle von Ernst Stein-
mann, \I. Theil. (Mit Unterstützung des Deutschen
Reiches herausgegeben.) Textband in Quart von
710 Seiten mit 260 Abbildungen und Mappe in
Grofsfolio mit 34 Tafeln. Preis zusammen 100 Mk.
Verlagsanstalt F. Bruckmann, München 1901.
Durch dieses glänzende Werk erhält das Heilig-
thum Sixtus IV. endlich eine Monographie, (von der
die Hälfte vorliegt); soweit die daraus zur Verfügung
gestellten Proben erkennen lassen, eine den eigen-
artigen Bau und seine einzig dastehende Ausstattung
n Abbildungen und Text vollkommen würdigende
Beschreibung, die sich namentlich auf die Fresken
bezieht. Diese vergegenwärtigen in einem einzigen
Rahmen die Entwickelung der italienischen Renaissance-
malerei: in den drei grolsen Perioden der Umbrer
und Florentiner an den Wänden, Michelangelo's an
der Decke und Raphaels in den Teppichen, endlich
Michelangelo's im Jüngsten Gericht. — Der Bau und
Schmuck der Kapelle unter Sixtus IV. wird im
I. Band geschildert, und zwar in den beiden ersten
Abschnitten das Aufblühen der Künste in Rom von
1471—1481, in den folgenden die Baugeschichte der
Kapelle, die Kultusstätte und Festungsanlage zugleich