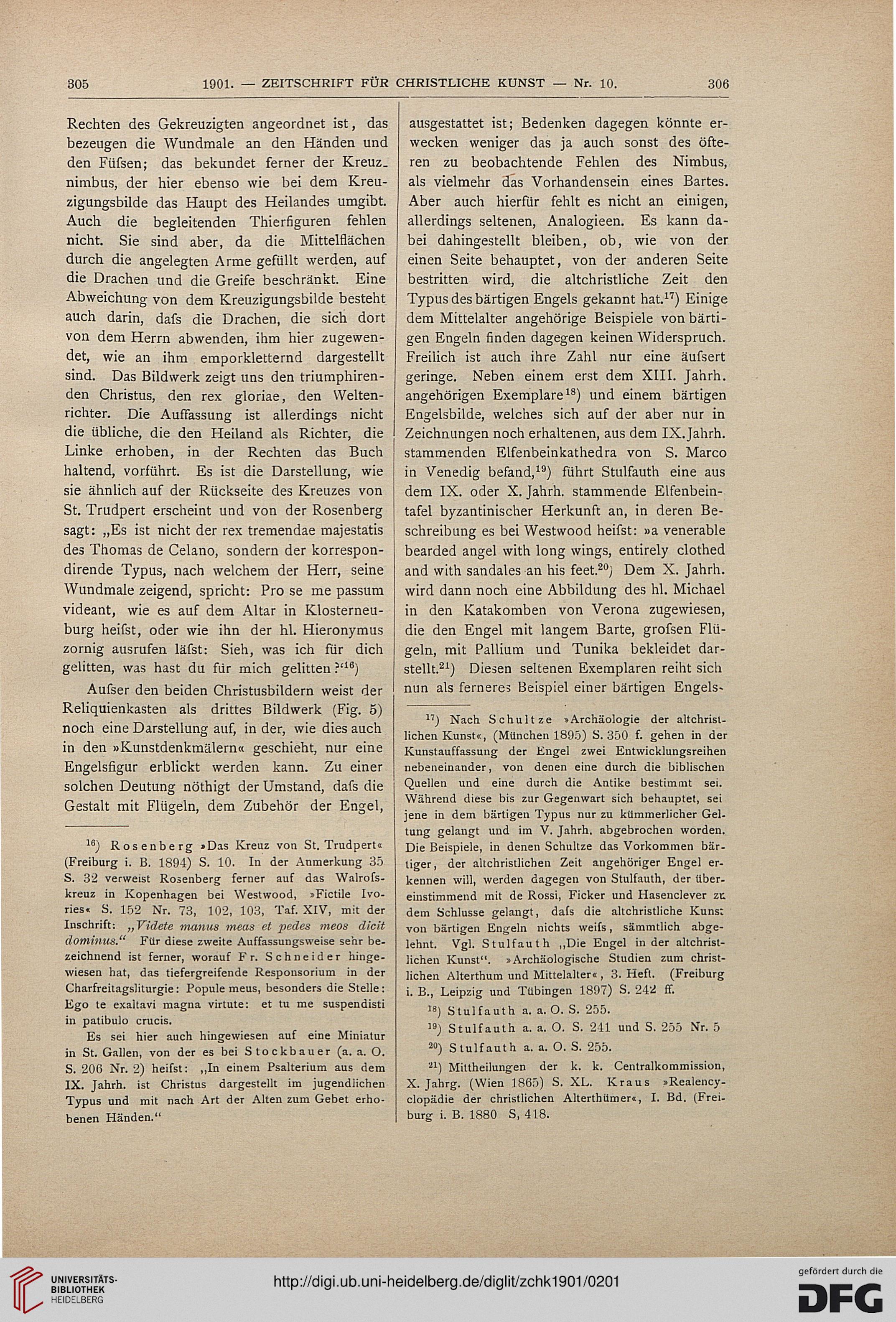305
1901. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 10.
306
Rechten des Gekreuzigten angeordnet ist, das
bezeugen die Wundmale an den Händen und
den Füfsen; das bekundet ferner der Kreuz,
nimbus, der hier ebenso wie bei dem Kreu-
zigungsbilde das Haupt des Heilandes umgibt.
Auch die begleitenden Thierfiguren fehlen
nicht. Sie sind aber, da die Mittelflächen
durch die angelegten Arme gefüllt werden, auf
die Drachen und die Greife beschränkt. Eine
Abweichung von dem Kreuzigungsbilde besteht
auch darin, dafs die Drachen, die sich dort
von dem Herrn abwenden, ihm hier zugewen-
det, wie an ihm emporkletternd dargestellt
sind. Das Bildwerk zeigt uns den triumphiren-
den Christus, den rex gloriae, den Welten-
richter. Die Auffassung ist allerdings nicht
die übliche, die den Heiland als Richter, die
Linke erhoben, in der Rechten das Buch
haltend, vorführt. Es ist die Darstellung, wie
sie ähnlich auf der Rückseite des Kreuzes von
St. Trudpert erscheint und von der Rosenberg
sagt: „Es ist nicht der rex tremendae majestatis
des Thomas de Celano, sondern der korrespon-
dirende Typus, nach welchem der Herr, seine
Wundmale zeigend, spricht: Pro se me passum
videant, wie es auf dem Altar in Klosterneu-
burg heifst, oder wie ihn der hl. Hieronymus
zornig ausrufen läfst: Sieh, was ich für dich
gelitten, was hast du für mich gelitten?'16)
Aufser den beiden Christusbildern weist der
Reliquienkasten als drittes Bildwerk (Fig. 5)
noch eine Darstellung auf, in der, wie dies auch
in den »Kunstdenkmälern« geschieht, nur eine
Engelsfigur erblickt werden kann. Zu einer
solchen Deutung nöthigt der Umstand, dafs die
Gestalt mit Flügeln, dem Zubehör der Engel,
16) Rosenberg »Das Kreuz von St. Trudpert«
(Freiburg i. B. 1894) S. 10. In der Anmerkung 35
S. 32 verweist Rosenberg ferner auf das Walrofs-
kreuz in Kopenhagen bei Westwood, »Fictile Ivo-
ries« S. 152 Nr. 73, 102, 103, Taf. XIV, mit der
Inschrift: „Videte manus meas et pedes meos dicit
dominus." Für diese zweite Auffassungsweise sehr be-
zeichnend ist ferner, worauf Fr. Schneider hinge-
wiesen hat, das tiefergreifende Responsorium in der
Charfreitagsliturgie: Popule meus, besonders die Stelle:
Ego te exaltavi magna virtute: et tu me suspendisti
in patibulo crucis.
Es sei hier auch hingewiesen auf eine Miniatur
in St. Gallen, von der es bei Stockbauer (a. a. O.
S. 206 Nr. 2) heifst: „In einem Psalterium aus dem
IX. Jahrh. ist Christus dargestellt im jugendlichen
Typus und mit nach Art der Alten zum Gebet erho-
benen Händen."
ausgestattet ist; Bedenken dagegen könnte er-
wecken weniger das ja auch sonst des öfte-
ren zu beobachtende Fehlen des Nimbus,
als vielmehr das Vorhandensein eines Bartes.
Aber auch hierfür fehlt es nicht an einigen,
allerdings seltenen, Analogieen. Es kann da-
bei dahingestellt bleiben, ob, wie von der
einen Seite behauptet, von der anderen Seite
bestritten wird, die altchristliche Zeit den
Typus des bärtigen Engels gekannt hat.17) Einige
dem Mittelalter angehörige Beispiele von bärti-
gen Engeln finden dagegen keinen Widerspruch.
Freilich ist auch ihre Zahl nur eine äufsert
geringe. Neben einem erst dem XIII. Jahrh.
angehörigen Exemplare18) und einem bärtigen
Engelsbilde, welches sich auf der aber nur in
Zeichnungen noch erhaltenen, aus dem IX. Jahrh.
stammenden Elfenbeinkathedra von S. Marco
in Venedig befand,19) führt Stulfauth eine aus
dem IX. oder X. Jahrh. stammende Elfenbein-
tafel byzantinischer Herkunft an, in deren Be-
schreibung es bei Westwood heifst: »a venerable
bearded angel with long wings, entirely clothed
and with sandales an his feet.20) Dem X. Jahrh.
wird dann noch eine Abbildung des hl. Michael
in den Katakomben von Verona zugewiesen,
die den Engel mit langem Barte, grofsen Flü-
geln, mit Pallium und Tunika bekleidet dar-
stellt.21) Diesen seltenen Exemplaren reiht sich
nun als ferneres Beispiel einer bärtigen Engels-
I7) Nach Schult ze »Archäologie der alt christ-
lichen Kunst«, (München 1895) S. 350 f. gehen in der
Kunstauffassung der Engel zwei Entwicklungsreihen
nebeneinander, von denen eine durch die biblischen
Quellen und eine durch die Antike bestimmt sei.
Während diese bis zur Gegenwart sich behauptet, sei
jene in dem bärtigen Typus nur zu kümmerlicher Gel-
tung gelangt und im V. Jahrh. abgebrochen worden.
Die Beispiele, in denen Schultze das Vorkommen bär-
tiger, der altchristlichen Zeit angehöriger Engel er-
kennen will, werden dagegen von Stulfauth, der über-
einstimmend mit de Rossi, Ficker und Hasenclever zr.
dem Schlüsse gelangt, dafs die altchristliche Kuns:
von bärtigen Engeln nichts weifs, sämmtlich abge-
lehnt. Vgl. Stulfauth „Die Engel in der altchrist-
lichen Kunst". »Archäologische Studien zum christ-
lichen Alterthum und Mittelalter« , 3. Heft. (Freiburg
i. B., Leipzig und Tübingen 1897) S. 242 ff.
aa) Stulfauth a. a. O. S. 255.
19) Stulfauth a. a. O. S. 241 und S. 255 Nr. 5
20) Stulfauth a. a. O. S. 255.
al) Mittheilungen der k. k. Centralkommission,
X. Jahrg. (Wien 1865) S. XL. Kraus »Realency-
clopädie der christlichen Alterthümer«, I. Bd. (Frei-
burg i. B. 1880 S, 418.
1901. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 10.
306
Rechten des Gekreuzigten angeordnet ist, das
bezeugen die Wundmale an den Händen und
den Füfsen; das bekundet ferner der Kreuz,
nimbus, der hier ebenso wie bei dem Kreu-
zigungsbilde das Haupt des Heilandes umgibt.
Auch die begleitenden Thierfiguren fehlen
nicht. Sie sind aber, da die Mittelflächen
durch die angelegten Arme gefüllt werden, auf
die Drachen und die Greife beschränkt. Eine
Abweichung von dem Kreuzigungsbilde besteht
auch darin, dafs die Drachen, die sich dort
von dem Herrn abwenden, ihm hier zugewen-
det, wie an ihm emporkletternd dargestellt
sind. Das Bildwerk zeigt uns den triumphiren-
den Christus, den rex gloriae, den Welten-
richter. Die Auffassung ist allerdings nicht
die übliche, die den Heiland als Richter, die
Linke erhoben, in der Rechten das Buch
haltend, vorführt. Es ist die Darstellung, wie
sie ähnlich auf der Rückseite des Kreuzes von
St. Trudpert erscheint und von der Rosenberg
sagt: „Es ist nicht der rex tremendae majestatis
des Thomas de Celano, sondern der korrespon-
dirende Typus, nach welchem der Herr, seine
Wundmale zeigend, spricht: Pro se me passum
videant, wie es auf dem Altar in Klosterneu-
burg heifst, oder wie ihn der hl. Hieronymus
zornig ausrufen läfst: Sieh, was ich für dich
gelitten, was hast du für mich gelitten?'16)
Aufser den beiden Christusbildern weist der
Reliquienkasten als drittes Bildwerk (Fig. 5)
noch eine Darstellung auf, in der, wie dies auch
in den »Kunstdenkmälern« geschieht, nur eine
Engelsfigur erblickt werden kann. Zu einer
solchen Deutung nöthigt der Umstand, dafs die
Gestalt mit Flügeln, dem Zubehör der Engel,
16) Rosenberg »Das Kreuz von St. Trudpert«
(Freiburg i. B. 1894) S. 10. In der Anmerkung 35
S. 32 verweist Rosenberg ferner auf das Walrofs-
kreuz in Kopenhagen bei Westwood, »Fictile Ivo-
ries« S. 152 Nr. 73, 102, 103, Taf. XIV, mit der
Inschrift: „Videte manus meas et pedes meos dicit
dominus." Für diese zweite Auffassungsweise sehr be-
zeichnend ist ferner, worauf Fr. Schneider hinge-
wiesen hat, das tiefergreifende Responsorium in der
Charfreitagsliturgie: Popule meus, besonders die Stelle:
Ego te exaltavi magna virtute: et tu me suspendisti
in patibulo crucis.
Es sei hier auch hingewiesen auf eine Miniatur
in St. Gallen, von der es bei Stockbauer (a. a. O.
S. 206 Nr. 2) heifst: „In einem Psalterium aus dem
IX. Jahrh. ist Christus dargestellt im jugendlichen
Typus und mit nach Art der Alten zum Gebet erho-
benen Händen."
ausgestattet ist; Bedenken dagegen könnte er-
wecken weniger das ja auch sonst des öfte-
ren zu beobachtende Fehlen des Nimbus,
als vielmehr das Vorhandensein eines Bartes.
Aber auch hierfür fehlt es nicht an einigen,
allerdings seltenen, Analogieen. Es kann da-
bei dahingestellt bleiben, ob, wie von der
einen Seite behauptet, von der anderen Seite
bestritten wird, die altchristliche Zeit den
Typus des bärtigen Engels gekannt hat.17) Einige
dem Mittelalter angehörige Beispiele von bärti-
gen Engeln finden dagegen keinen Widerspruch.
Freilich ist auch ihre Zahl nur eine äufsert
geringe. Neben einem erst dem XIII. Jahrh.
angehörigen Exemplare18) und einem bärtigen
Engelsbilde, welches sich auf der aber nur in
Zeichnungen noch erhaltenen, aus dem IX. Jahrh.
stammenden Elfenbeinkathedra von S. Marco
in Venedig befand,19) führt Stulfauth eine aus
dem IX. oder X. Jahrh. stammende Elfenbein-
tafel byzantinischer Herkunft an, in deren Be-
schreibung es bei Westwood heifst: »a venerable
bearded angel with long wings, entirely clothed
and with sandales an his feet.20) Dem X. Jahrh.
wird dann noch eine Abbildung des hl. Michael
in den Katakomben von Verona zugewiesen,
die den Engel mit langem Barte, grofsen Flü-
geln, mit Pallium und Tunika bekleidet dar-
stellt.21) Diesen seltenen Exemplaren reiht sich
nun als ferneres Beispiel einer bärtigen Engels-
I7) Nach Schult ze »Archäologie der alt christ-
lichen Kunst«, (München 1895) S. 350 f. gehen in der
Kunstauffassung der Engel zwei Entwicklungsreihen
nebeneinander, von denen eine durch die biblischen
Quellen und eine durch die Antike bestimmt sei.
Während diese bis zur Gegenwart sich behauptet, sei
jene in dem bärtigen Typus nur zu kümmerlicher Gel-
tung gelangt und im V. Jahrh. abgebrochen worden.
Die Beispiele, in denen Schultze das Vorkommen bär-
tiger, der altchristlichen Zeit angehöriger Engel er-
kennen will, werden dagegen von Stulfauth, der über-
einstimmend mit de Rossi, Ficker und Hasenclever zr.
dem Schlüsse gelangt, dafs die altchristliche Kuns:
von bärtigen Engeln nichts weifs, sämmtlich abge-
lehnt. Vgl. Stulfauth „Die Engel in der altchrist-
lichen Kunst". »Archäologische Studien zum christ-
lichen Alterthum und Mittelalter« , 3. Heft. (Freiburg
i. B., Leipzig und Tübingen 1897) S. 242 ff.
aa) Stulfauth a. a. O. S. 255.
19) Stulfauth a. a. O. S. 241 und S. 255 Nr. 5
20) Stulfauth a. a. O. S. 255.
al) Mittheilungen der k. k. Centralkommission,
X. Jahrg. (Wien 1865) S. XL. Kraus »Realency-
clopädie der christlichen Alterthümer«, I. Bd. (Frei-
burg i. B. 1880 S, 418.