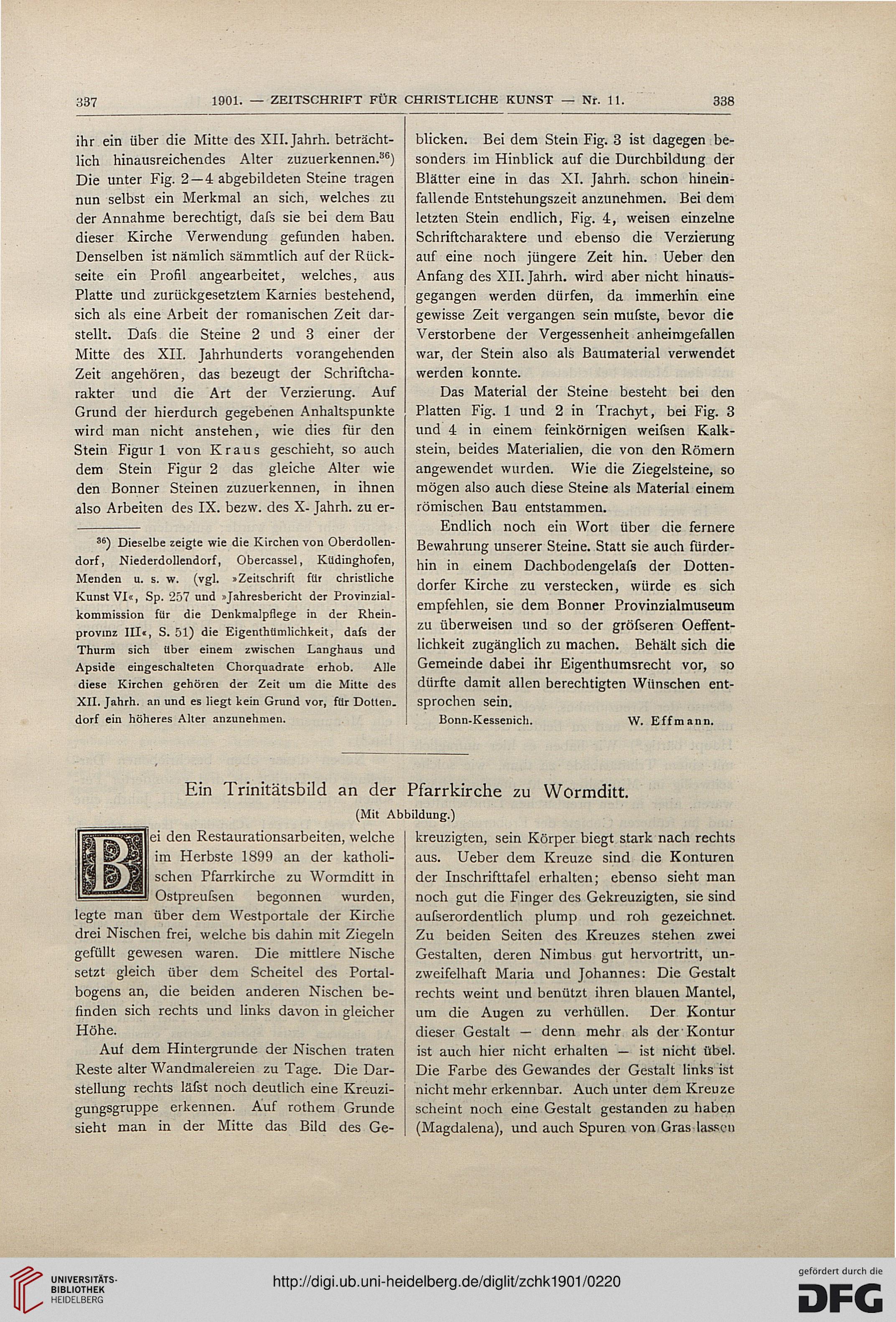337
1901.
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 11.
338
ihr ein über die Mitte des XILJahrh. beträcht-
lich hinausreichendes Alter zuzuerkennen.86)
Die unter Fig. 2—4 abgebildeten Steine tragen
nun selbst ein Merkmal an sich, welches zu
der Annahme berechtigt, dafs sie bei dem Bau
dieser Kirche Verwendung gefunden haben.
Denselben ist nämlich sämmtlich auf der Rück-
seite ein Profil angearbeitet, welches, aus
Platte und zurückgesetztem Karnies bestehend,
sich als eine Arbeit der romanischen Zeit dar-
stellt. Dafs die Steine 2 und 3 einer der
Mitte des XII. Jahrhunderts vorangehenden
Zeit angehören, das bezeugt der Schriftcha-
rakter und die Art der Verzierung. Auf
Grund der hierdurch gegebenen Anhaltspunkte
wird man nicht anstehen, wie dies für den
Stein Figur 1 von Kraus geschieht, so auch
dem Stein Figur 2 das gleiche Alter wie
den Bonner Steinen zuzuerkennen, in ihnen
also Arbeiten des IX. bezw. des X- Jahrh. zu er-
36) Dieselbe zeigte wie die Kirchen von Oberdollen-
dorf, Niederdollendorf, Obercassel, Küdinghofen,
Menden u. s. w. (vgl. »Zeitschrift fttr christliche
Kunst VI«, Sp. 257 und »Jahresbericht der Provinzial-
kommission für die Denkmalpflege in der Rhein-
provinz III«, S. 51) die Eigenthümlichkeit, dafs der
Thurm sich über einem zwischen Langhaus und
Apside eingeschalteten Chorquadrate erhob. Alle
diese Kirchen gehören der Zeit um die Mitte des
XII. Jahrh. an und es liegt kein Grund vor, für Dotter,
dorf ein höheres Alter anzunehmen.
blicken. Bei dem Stein Fig. 3 ist dagegen be-
sonders im Hinblick auf die Durchbildung der
Blätter eine in das XI. Jahrh. schon hinein-
fallende Entstehungszeit anzunehmen. Bei dem
letzten Stein endlich, Fig. 4, weisen einzelne
Schriftcharaktere und ebenso die Verzierung
auf eine noch jüngere Zeit hin. Ueber den
Anfang des XII. Jahrh. wird aber nicht hinaus-
gegangen werden dürfen, da immerhin eine
gewisse Zeit vergangen sein mufste, bevor die
Verstorbene der Vergessenheit anheimgefallen
war, der Stein also als Baumaterial verwendet
werden konnte.
Das Material der Steine besteht bei den
Platten Fig. 1 und 2 in Trachyt, bei Fig. 3
und 4 in einem feinkörnigen weifsen Kalk-
stein, beides Materialien, die von den Römern
angewendet wurden. Wie die Ziegelsteine, so
mögen also auch diese Steine als Material einem
römischen Bau entstammen.
Endlich noch ein Wort über die fernere
Bewahrung unserer Steine. Statt sie auch fürder-
hin in einem Dachbodengelafs der Dotten-
dorfer Kirche zu verstecken, würde es sich
empfehlen, sie dem Bonner Provinzialmuseum
zu überweisen und so der gröfseren Oeffent-
lichkeit zugänglich zu machen. Behält sich die
Gemeinde dabei ihr Eigenthumsrecht vor, so
dürfte damit allen berechtigten Wünschen ent-
sprochen sein.
Bonn-Kessenich. W. Effmann.
Ein Trinitätsbild an der Pfarrkirche zu Wormditt.
(Mit Abbildung.)
ei den Restaurationsarbeiten, welche
im Herbste 1899 an der katholi-
schen Pfarrkirche zu Wormditt in
Ostpreufsen begonnen wurden,
legte man über dem Westportale der Kirche
drei Nischen frei, welche bis dahin mit Ziegeln
gefüllt gewesen waren. Die mittlere Nische
setzt gleich über dem Scheitel des Portal-
bogens an, die beiden anderen Nischen be-
finden sich rechts und links davon in gleicher
Höhe.
Auf dem Hintergrunde der Nischen traten
Reste alter Wandmalereien zu Tage. Die Dar-
stellung rechts läfst noch deutlich eine Kreuzi-
gungsgruppe erkennen. Auf rothem Grunde
sieht man in der Mitte das Bild des Ge-
kreuzigten, sein Körper biegt stark nach rechts
aus. Ueber dem Kreuze sind die Konturen
der Inschrifttafel erhalten; ebenso sieht man
noch gut die Finger des Gekreuzigten, sie sind
aufserordentlich plump und roh gezeichnet.
Zu beiden Seiten des Kreuzes stehen zwei
Gestalten, deren Nimbus gut hervortritt, un-
zweifelhaft Maria und Johannes: Die Gestalt
rechts weint und benützt ihren blauen Mantel,
um die Augen zu verhüllen. Der Kontur
dieser Gestalt — denn mehr als der Kontur
ist auch hier nicht erhalten — ist nicht übel.
Die Farbe des Gewandes der Gestalt links ist
nicht mehr erkennbar. Auch unter dem Kreuze
scheint noch eine Gestalt gestanden zu haben
(Magdalena), und auch Spuren von Gras lassen
1901.
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 11.
338
ihr ein über die Mitte des XILJahrh. beträcht-
lich hinausreichendes Alter zuzuerkennen.86)
Die unter Fig. 2—4 abgebildeten Steine tragen
nun selbst ein Merkmal an sich, welches zu
der Annahme berechtigt, dafs sie bei dem Bau
dieser Kirche Verwendung gefunden haben.
Denselben ist nämlich sämmtlich auf der Rück-
seite ein Profil angearbeitet, welches, aus
Platte und zurückgesetztem Karnies bestehend,
sich als eine Arbeit der romanischen Zeit dar-
stellt. Dafs die Steine 2 und 3 einer der
Mitte des XII. Jahrhunderts vorangehenden
Zeit angehören, das bezeugt der Schriftcha-
rakter und die Art der Verzierung. Auf
Grund der hierdurch gegebenen Anhaltspunkte
wird man nicht anstehen, wie dies für den
Stein Figur 1 von Kraus geschieht, so auch
dem Stein Figur 2 das gleiche Alter wie
den Bonner Steinen zuzuerkennen, in ihnen
also Arbeiten des IX. bezw. des X- Jahrh. zu er-
36) Dieselbe zeigte wie die Kirchen von Oberdollen-
dorf, Niederdollendorf, Obercassel, Küdinghofen,
Menden u. s. w. (vgl. »Zeitschrift fttr christliche
Kunst VI«, Sp. 257 und »Jahresbericht der Provinzial-
kommission für die Denkmalpflege in der Rhein-
provinz III«, S. 51) die Eigenthümlichkeit, dafs der
Thurm sich über einem zwischen Langhaus und
Apside eingeschalteten Chorquadrate erhob. Alle
diese Kirchen gehören der Zeit um die Mitte des
XII. Jahrh. an und es liegt kein Grund vor, für Dotter,
dorf ein höheres Alter anzunehmen.
blicken. Bei dem Stein Fig. 3 ist dagegen be-
sonders im Hinblick auf die Durchbildung der
Blätter eine in das XI. Jahrh. schon hinein-
fallende Entstehungszeit anzunehmen. Bei dem
letzten Stein endlich, Fig. 4, weisen einzelne
Schriftcharaktere und ebenso die Verzierung
auf eine noch jüngere Zeit hin. Ueber den
Anfang des XII. Jahrh. wird aber nicht hinaus-
gegangen werden dürfen, da immerhin eine
gewisse Zeit vergangen sein mufste, bevor die
Verstorbene der Vergessenheit anheimgefallen
war, der Stein also als Baumaterial verwendet
werden konnte.
Das Material der Steine besteht bei den
Platten Fig. 1 und 2 in Trachyt, bei Fig. 3
und 4 in einem feinkörnigen weifsen Kalk-
stein, beides Materialien, die von den Römern
angewendet wurden. Wie die Ziegelsteine, so
mögen also auch diese Steine als Material einem
römischen Bau entstammen.
Endlich noch ein Wort über die fernere
Bewahrung unserer Steine. Statt sie auch fürder-
hin in einem Dachbodengelafs der Dotten-
dorfer Kirche zu verstecken, würde es sich
empfehlen, sie dem Bonner Provinzialmuseum
zu überweisen und so der gröfseren Oeffent-
lichkeit zugänglich zu machen. Behält sich die
Gemeinde dabei ihr Eigenthumsrecht vor, so
dürfte damit allen berechtigten Wünschen ent-
sprochen sein.
Bonn-Kessenich. W. Effmann.
Ein Trinitätsbild an der Pfarrkirche zu Wormditt.
(Mit Abbildung.)
ei den Restaurationsarbeiten, welche
im Herbste 1899 an der katholi-
schen Pfarrkirche zu Wormditt in
Ostpreufsen begonnen wurden,
legte man über dem Westportale der Kirche
drei Nischen frei, welche bis dahin mit Ziegeln
gefüllt gewesen waren. Die mittlere Nische
setzt gleich über dem Scheitel des Portal-
bogens an, die beiden anderen Nischen be-
finden sich rechts und links davon in gleicher
Höhe.
Auf dem Hintergrunde der Nischen traten
Reste alter Wandmalereien zu Tage. Die Dar-
stellung rechts läfst noch deutlich eine Kreuzi-
gungsgruppe erkennen. Auf rothem Grunde
sieht man in der Mitte das Bild des Ge-
kreuzigten, sein Körper biegt stark nach rechts
aus. Ueber dem Kreuze sind die Konturen
der Inschrifttafel erhalten; ebenso sieht man
noch gut die Finger des Gekreuzigten, sie sind
aufserordentlich plump und roh gezeichnet.
Zu beiden Seiten des Kreuzes stehen zwei
Gestalten, deren Nimbus gut hervortritt, un-
zweifelhaft Maria und Johannes: Die Gestalt
rechts weint und benützt ihren blauen Mantel,
um die Augen zu verhüllen. Der Kontur
dieser Gestalt — denn mehr als der Kontur
ist auch hier nicht erhalten — ist nicht übel.
Die Farbe des Gewandes der Gestalt links ist
nicht mehr erkennbar. Auch unter dem Kreuze
scheint noch eine Gestalt gestanden zu haben
(Magdalena), und auch Spuren von Gras lassen