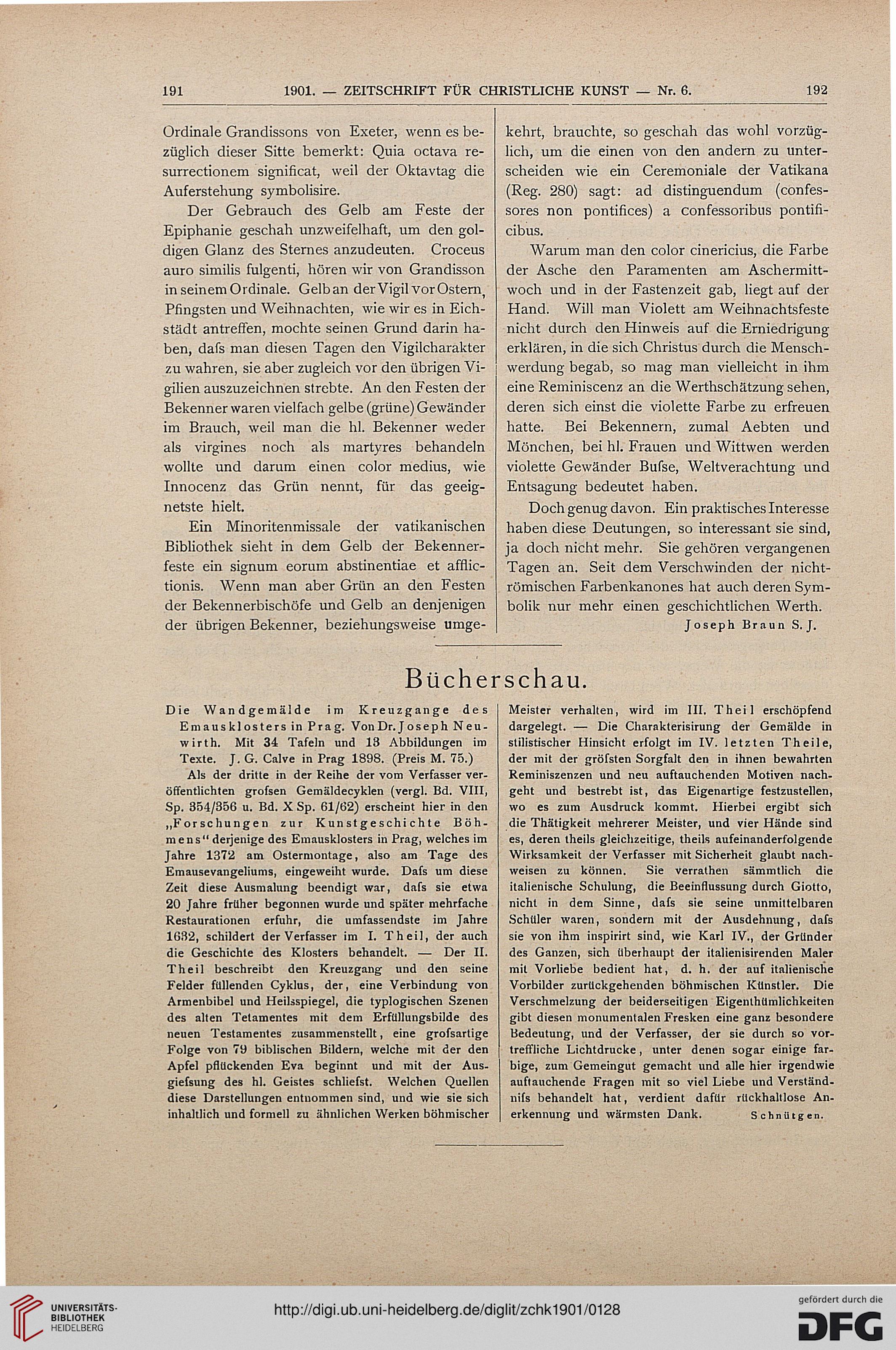191
1901. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST
Nr. 6.
192
Ordinale Grandissons von Exeter, wenn es be-
züglich dieser Sitte bemerkt: Quia octava re-
surrectionem significat, weil der Oktavtag die
Auferstehung symbolisire.
Der Gebrauch des Gelb am Feste der
Epiphanie geschah unzweifelhaft, um den gol-
digen Glanz des Sternes anzudeuten. Croceus
auro similis fulgenti, hören wir von Grandisson
in seinem Ordinale. Gelban der Vigil vor Ostern,
Pfingsten und Weihnachten, wie wir es in Eich-
städt antreffen, mochte seinen Grund darin ha-
ben, dafs man diesen Tagen den Vigilcharakter
zu wahren, sie aber zugleich vor den übrigen Vi-
gilien auszuzeichnen strebte. An den Festen der
Bekenner waren vielfach gelbe (grüne) Gewänder
im Brauch, weil man die hl. Bekenner weder
als virgines noch als martyres behandeln
wollte und darum einen color medius, wie
Innocenz das Grün nennt, für das geeig-
netste hielt.
Ein Minoritenmissale der vatikanischen
Bibliothek sieht in dem Gelb der Bekenner-
feste ein Signum eorum abstinentiae et afflic-
tionis. Wenn man aber Grün an den Festen
der Bekennerbischöfe und Gelb an denjenigen
der übrigen Bekenner, beziehungsweise umge-
kehrt, brauchte, so geschah das wohl vorzüg-
lich, um die einen von den andern zu unter-
scheiden wie ein Ceremoniale der Vatikana
(Reg. 280) sagt: ad distinguendum (confes-
sores non pontifices) a confessoribus pontifi-
cibus.
Warum man den color cinericius, die Farbe
der Asche den Paramenten am Aschermitt-
woch und in der Fastenzeit gab, liegt auf der
Hand. Will man Violett am Weihnachtsfeste
nicht durch den Hinweis auf die Erniedrigung
erklären, in die sich Christus durch die Mensch-
werdung begab, so mag man vielleicht in ihm
eine Reminiscenz an die Werthschätzung sehen,
deren sich einst die violette Farbe zu erfreuen
hatte. Bei Bekennern, zumal Aebten und
Mönchen, bei hl. Frauen und Wittwen werden
violette Gewänder Bufse, Weltverachtung und
Entsagung bedeutet haben.
Doch genug davon. Ein praktisches Interesse
haben diese Deutungen, so interessant sie sind,
ja doch nicht mehr. Sie gehören vergangenen
Tagen an. Seit dem Verschwinden der nicht-
römischen Farbenkanones hat auch deren Sym-
bolik nur mehr einen geschichtlichen Werth.
Joseph Braun S. J.
Bücherschau.
Die Wandgemälde im Kreuzgange des
Emausklosters in Prag. Von Dr. Joseph Neu-
wirt h. Mit 34 Tafeln und 13 Abbildungen im
Texte. J. G. Calve in Prag 1898. (Preis M. 75.)
Als der dritte in der Reihe der vom Verfasser ver-
öffentlichten grofsen Gemäldecyklen (vergl. Bd. VIII,
Sp. 354/356 u. Bd. X Sp. 61/62) erscheint hier in den
„Forschungen zur Kunstgeschichte Böh-
mens" derjenige des Emausklosters in Prag, welches im
Jahre 1372 am Ostermontage, also am Tage des
Emausevangeliums, eingeweiht wurde. Dafs um diese
Zeit diese Ausmalung beendigt war, dafs sie etwa
20 Jahre früher begonnen wurde und später mehrfache
Restaurationen erfuhr, die umfassendste im Jahre
1632, schildert der Verfasser im I. Theil, der auch
die Geschichte des Klosters behandelt. — Der II.
Theil beschreibt den Kreuzgang und den seine
Felder füllenden Cyklus, der, eine Verbindung von
Armenbibel und Heilsspiegel, die typlogischen Szenen
des alten Tetamentes mit dem Erfüllungsbilde des
neuen Testamentes zusammenstellt, eine grofsartige
Folge von 79 biblischen Bildern, welche mit der den
Apfel pflückenden Eva beginnt und mit der Aus-
giefsung des hl. Geistes schliefst. Welchen Quellen
diese Darstellungen entnommen sind, und wie sie sich
inhaltlich und formell zu ähnlichen Werken böhmischer
Meister verhalten, wird im III. Theil erschöpfend
dargelegt. — Die Charakterisirung der Gemälde in
stilistischer Hinsicht erfolgt im IV. letzten Theile,
der mit der gröfsten Sorgfalt den in ihnen bewahrten
Reminiszenzen und neu auftauchenden Motiven nach-
geht und bestrebt ist, das Eigenartige festzustellen,
wo es zum Ausdruck kommt. Hierbei ergibt sich
die Thätigkeit mehrerer Meister, und vier Hände sind
es, deren theils gleichzeitige, theils aufeinanderfolgende
Wirksamkeit der Verfasser mit Sicherheit glaubt nach-
weisen zu können. Sie verrathen sämmtlich die
italienische Schulung, die Beeinflussung durch Giotto,
nicht in dem Sinne, dafs sie seine unmittelbaren
Schüler waren, sondern mit der Ausdehnung, dafs
sie von ihm inspirirt sind, wie Karl IV., der Gründer
des Ganzen, sich überhaupt der italienisirenden Maler
mit Vorliebe bedient hat, d. h. der auf italienische
Vorbilder zurückgehenden böhmischen Künstler. Die
Verschmelzung der beiderseitigen Eigenlhümlichkeiten
gibt diesen monumentalen Fresken eine ganz besondere
Bedeutung, und der Verfasser, der sie durch so vor-
treffliche Lichtdrucke, unter denen sogar einige far-
bige, zum Gemeingut gemacht und alle hier irgendwie
auftauchende Fragen mit so viel Liebe und Verständ-
nifs behandelt hat, verdient dafür rückhaltlose An-
erkennung und wärmsten Dank. Schniltgen.
1901. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST
Nr. 6.
192
Ordinale Grandissons von Exeter, wenn es be-
züglich dieser Sitte bemerkt: Quia octava re-
surrectionem significat, weil der Oktavtag die
Auferstehung symbolisire.
Der Gebrauch des Gelb am Feste der
Epiphanie geschah unzweifelhaft, um den gol-
digen Glanz des Sternes anzudeuten. Croceus
auro similis fulgenti, hören wir von Grandisson
in seinem Ordinale. Gelban der Vigil vor Ostern,
Pfingsten und Weihnachten, wie wir es in Eich-
städt antreffen, mochte seinen Grund darin ha-
ben, dafs man diesen Tagen den Vigilcharakter
zu wahren, sie aber zugleich vor den übrigen Vi-
gilien auszuzeichnen strebte. An den Festen der
Bekenner waren vielfach gelbe (grüne) Gewänder
im Brauch, weil man die hl. Bekenner weder
als virgines noch als martyres behandeln
wollte und darum einen color medius, wie
Innocenz das Grün nennt, für das geeig-
netste hielt.
Ein Minoritenmissale der vatikanischen
Bibliothek sieht in dem Gelb der Bekenner-
feste ein Signum eorum abstinentiae et afflic-
tionis. Wenn man aber Grün an den Festen
der Bekennerbischöfe und Gelb an denjenigen
der übrigen Bekenner, beziehungsweise umge-
kehrt, brauchte, so geschah das wohl vorzüg-
lich, um die einen von den andern zu unter-
scheiden wie ein Ceremoniale der Vatikana
(Reg. 280) sagt: ad distinguendum (confes-
sores non pontifices) a confessoribus pontifi-
cibus.
Warum man den color cinericius, die Farbe
der Asche den Paramenten am Aschermitt-
woch und in der Fastenzeit gab, liegt auf der
Hand. Will man Violett am Weihnachtsfeste
nicht durch den Hinweis auf die Erniedrigung
erklären, in die sich Christus durch die Mensch-
werdung begab, so mag man vielleicht in ihm
eine Reminiscenz an die Werthschätzung sehen,
deren sich einst die violette Farbe zu erfreuen
hatte. Bei Bekennern, zumal Aebten und
Mönchen, bei hl. Frauen und Wittwen werden
violette Gewänder Bufse, Weltverachtung und
Entsagung bedeutet haben.
Doch genug davon. Ein praktisches Interesse
haben diese Deutungen, so interessant sie sind,
ja doch nicht mehr. Sie gehören vergangenen
Tagen an. Seit dem Verschwinden der nicht-
römischen Farbenkanones hat auch deren Sym-
bolik nur mehr einen geschichtlichen Werth.
Joseph Braun S. J.
Bücherschau.
Die Wandgemälde im Kreuzgange des
Emausklosters in Prag. Von Dr. Joseph Neu-
wirt h. Mit 34 Tafeln und 13 Abbildungen im
Texte. J. G. Calve in Prag 1898. (Preis M. 75.)
Als der dritte in der Reihe der vom Verfasser ver-
öffentlichten grofsen Gemäldecyklen (vergl. Bd. VIII,
Sp. 354/356 u. Bd. X Sp. 61/62) erscheint hier in den
„Forschungen zur Kunstgeschichte Böh-
mens" derjenige des Emausklosters in Prag, welches im
Jahre 1372 am Ostermontage, also am Tage des
Emausevangeliums, eingeweiht wurde. Dafs um diese
Zeit diese Ausmalung beendigt war, dafs sie etwa
20 Jahre früher begonnen wurde und später mehrfache
Restaurationen erfuhr, die umfassendste im Jahre
1632, schildert der Verfasser im I. Theil, der auch
die Geschichte des Klosters behandelt. — Der II.
Theil beschreibt den Kreuzgang und den seine
Felder füllenden Cyklus, der, eine Verbindung von
Armenbibel und Heilsspiegel, die typlogischen Szenen
des alten Tetamentes mit dem Erfüllungsbilde des
neuen Testamentes zusammenstellt, eine grofsartige
Folge von 79 biblischen Bildern, welche mit der den
Apfel pflückenden Eva beginnt und mit der Aus-
giefsung des hl. Geistes schliefst. Welchen Quellen
diese Darstellungen entnommen sind, und wie sie sich
inhaltlich und formell zu ähnlichen Werken böhmischer
Meister verhalten, wird im III. Theil erschöpfend
dargelegt. — Die Charakterisirung der Gemälde in
stilistischer Hinsicht erfolgt im IV. letzten Theile,
der mit der gröfsten Sorgfalt den in ihnen bewahrten
Reminiszenzen und neu auftauchenden Motiven nach-
geht und bestrebt ist, das Eigenartige festzustellen,
wo es zum Ausdruck kommt. Hierbei ergibt sich
die Thätigkeit mehrerer Meister, und vier Hände sind
es, deren theils gleichzeitige, theils aufeinanderfolgende
Wirksamkeit der Verfasser mit Sicherheit glaubt nach-
weisen zu können. Sie verrathen sämmtlich die
italienische Schulung, die Beeinflussung durch Giotto,
nicht in dem Sinne, dafs sie seine unmittelbaren
Schüler waren, sondern mit der Ausdehnung, dafs
sie von ihm inspirirt sind, wie Karl IV., der Gründer
des Ganzen, sich überhaupt der italienisirenden Maler
mit Vorliebe bedient hat, d. h. der auf italienische
Vorbilder zurückgehenden böhmischen Künstler. Die
Verschmelzung der beiderseitigen Eigenlhümlichkeiten
gibt diesen monumentalen Fresken eine ganz besondere
Bedeutung, und der Verfasser, der sie durch so vor-
treffliche Lichtdrucke, unter denen sogar einige far-
bige, zum Gemeingut gemacht und alle hier irgendwie
auftauchende Fragen mit so viel Liebe und Verständ-
nifs behandelt hat, verdient dafür rückhaltlose An-
erkennung und wärmsten Dank. Schniltgen.