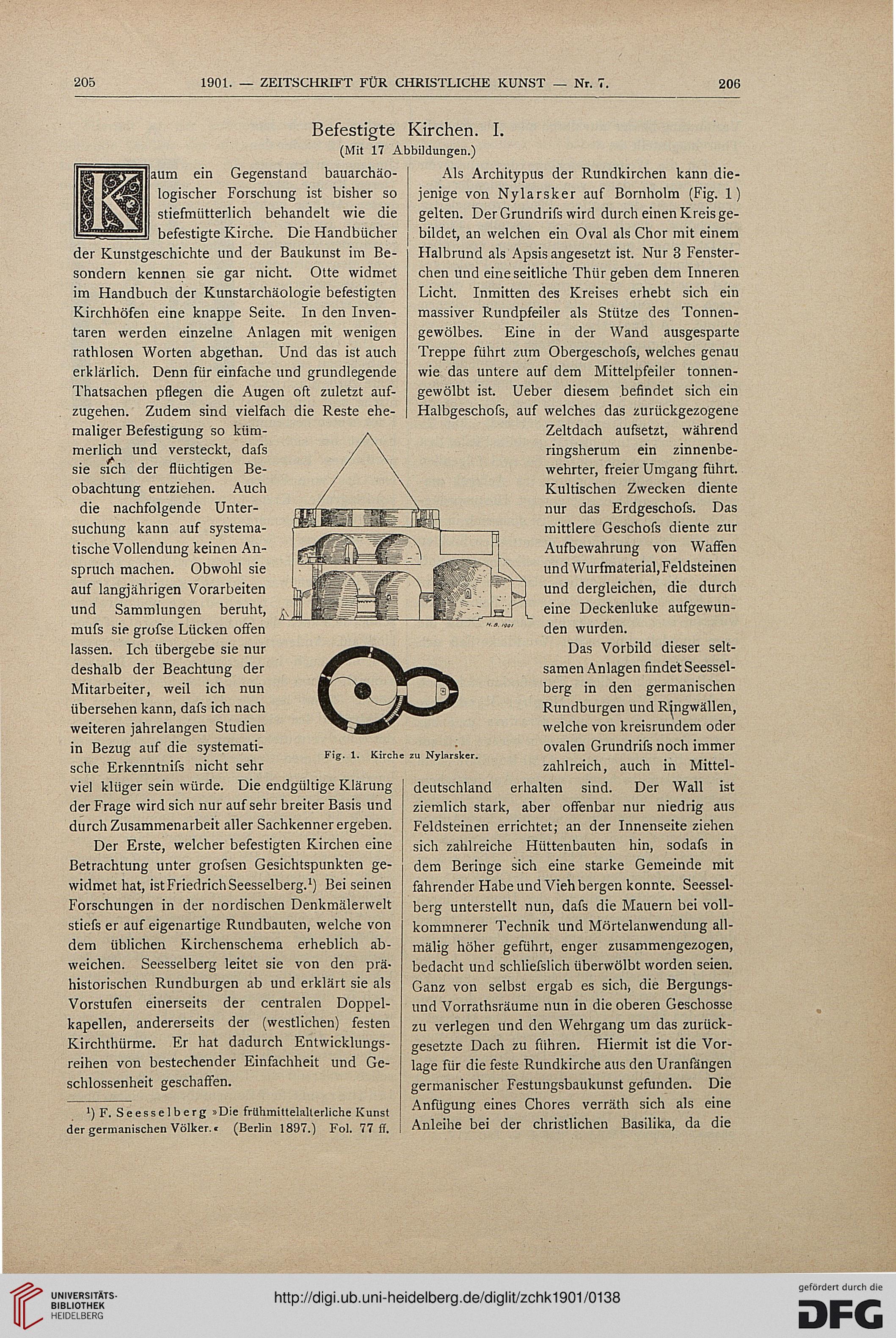205
1901.
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 7.
206
Befestigte Kirchen.
(Mit 17 Abbildungen.)
I.
merlich
sie sich
aum ein Gegenstand bauarchäo-
logischer Forschung ist bisher so
stiefmütterlich behandelt wie die
befestigte Kirche. Die Handbücher
der Kunstgeschichte und der Baukunst im Be-
sondern kennen sie gar nicht. Otte widmet
im Handbuch der Kunstarchäologie befestigten
Kirchhöfen eine knappe Seite. In den Inven-
taren werden einzelne Anlagen mit wenigen
rathlosen Worten abgethan. Und das ist auch
erklärlich. Denn für einfache und grundlegende
Thatsachen pflegen die Augen oft zuletzt auf-
zugehen. Zudem sind vielfach die Reste ehe-
maliger Befestigung so kiim-
und versteckt, dafs
der flüchtigen Be-
obachtung entziehen. Auch
die nachfolgende Unter-
suchung kann auf systema-
tische Vollendung keinen An-
spruch machen. Obwohl sie
auf langjährigen Vorarbeiten
und Sammlungen beruht,
mufs sie grofse Lücken offen
lassen. Ich übergebe sie nur
deshalb der Beachtung der
Mitarbeiter, weil ich nun
übersehen kann, dafs ich nach
weiteren jahrelangen Studien
in Bezug auf die systemati-
sche Erkenntnifs nicht sehr
viel klüger sein würde. Die endgültige Klärung
der Frage wird sich nur auf sehr breiter Basis und
durch Zusammenarbeit aller Sachkenner ergeben.
Der Erste, welcher befestigten Kirchen eine
Betrachtung unter grofsen Gesichtspunkten ge-
widmet hat, ist Friedrich Seesselberg.1) Bei seinen
Forschungen in der nordischen Denkmälerwelt
stiefs er auf eigenartige Rundbauten, welche von
dem üblichen Kirchenschema erheblich ab-
weichen. Seesselberg leitet sie von den prä-
historischen Rundburgen ab und erklärt sie als
Vorstufen einerseits der centralen Doppel-
kapellen, andererseits der (westlichen) festen
Kirchthürme. Er hat dadurch Entwicklungs-
reihen von bestechender Einfachheit und Ge-
schlossenheit geschaffen.
Fig. 1. Kirche zu Nylarsker.
') F. Seesselberg »Die frühmittelalterliche Kunst
der germanischen Völker.« (Berlin 1897.) Fol. 77 ff.
Als Architypus der Rundkirchen kann die-
jenige von Nylarsker auf Bornholm (Fig. 1)
gelten. Der Grundrifs wird durch einen Kreis ge-
bildet, an welchen ein Oval als Chor mit einem
Halbrund als Apsis angesetzt ist. Nur 3 Fenster-
chen und eine seitliche Thür geben dem Inneren
Licht. Inmitten des Kreises erhebt sich ein
massiver Rundpfeiler als Stütze des Tonnen-
gewölbes. Eine in der Wand ausgesparte
Treppe führt zum Obergeschofs, welches genau
wie das untere auf dem Mittelpfeiler tonnen-
gewölbt ist. Ueber diesem befindet sich ein
Halbgeschofs, auf welches das zurückgezogene
Zeltdach aufsetzt, während
ringsherum ein zinnenbe-
wehrter, freier Umgang führt.
Kultischen Zwecken diente
nur das Erdgeschofs. Das
mittlere Geschofs diente zur
Aufbewahrung von Waffen
und Wurfmaterial, Feldsteinen
und dergleichen, die durch
eine Deckenluke aufgewun-
den wurden.
Das Vorbild dieser selt-
samen Anlagen findet Seessel-
berg in den germanischen
Rundburgen und R^ngwällen,
welche von kreisrundem oder
ovalen Grundrifs noch immer
zahlreich, auch in Mittel-
deutschland erhalten sind. Der Wall ist
ziemlich stark, aber offenbar nur niedrig aus
Feldsteinen errichtet; an der Innenseite ziehen
sich zahlreiche Hüttenbauten hin, sodafs in
dem Beringe sich eine starke Gemeinde mit
fahrender Habe und Vieh bergen konnte. Seessel-
berg unterstellt nun, dafs die Mauern bei voll-
kommnerer Technik und Mörtelanwendung all-
mälig höher geführt, enger zusammengezogen,
bedacht und schliefslich überwölbt worden seien.
Ganz von selbst ergab es sich, die Bergungs-
und Vorrathsräume nun in die oberen Geschosse
zu verlegen und den Wehrgang um das zurück-
gesetzte Dach zu führen. Hiermit ist die Vor-
lage für die feste Rundkirche aus den Uranfängen
germanischer Festungsbaukunst gefunden. Die
Anfügung eines Chores verräth sich als eine
Anleihe bei der christlichen Basilika, da die
1901.
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 7.
206
Befestigte Kirchen.
(Mit 17 Abbildungen.)
I.
merlich
sie sich
aum ein Gegenstand bauarchäo-
logischer Forschung ist bisher so
stiefmütterlich behandelt wie die
befestigte Kirche. Die Handbücher
der Kunstgeschichte und der Baukunst im Be-
sondern kennen sie gar nicht. Otte widmet
im Handbuch der Kunstarchäologie befestigten
Kirchhöfen eine knappe Seite. In den Inven-
taren werden einzelne Anlagen mit wenigen
rathlosen Worten abgethan. Und das ist auch
erklärlich. Denn für einfache und grundlegende
Thatsachen pflegen die Augen oft zuletzt auf-
zugehen. Zudem sind vielfach die Reste ehe-
maliger Befestigung so kiim-
und versteckt, dafs
der flüchtigen Be-
obachtung entziehen. Auch
die nachfolgende Unter-
suchung kann auf systema-
tische Vollendung keinen An-
spruch machen. Obwohl sie
auf langjährigen Vorarbeiten
und Sammlungen beruht,
mufs sie grofse Lücken offen
lassen. Ich übergebe sie nur
deshalb der Beachtung der
Mitarbeiter, weil ich nun
übersehen kann, dafs ich nach
weiteren jahrelangen Studien
in Bezug auf die systemati-
sche Erkenntnifs nicht sehr
viel klüger sein würde. Die endgültige Klärung
der Frage wird sich nur auf sehr breiter Basis und
durch Zusammenarbeit aller Sachkenner ergeben.
Der Erste, welcher befestigten Kirchen eine
Betrachtung unter grofsen Gesichtspunkten ge-
widmet hat, ist Friedrich Seesselberg.1) Bei seinen
Forschungen in der nordischen Denkmälerwelt
stiefs er auf eigenartige Rundbauten, welche von
dem üblichen Kirchenschema erheblich ab-
weichen. Seesselberg leitet sie von den prä-
historischen Rundburgen ab und erklärt sie als
Vorstufen einerseits der centralen Doppel-
kapellen, andererseits der (westlichen) festen
Kirchthürme. Er hat dadurch Entwicklungs-
reihen von bestechender Einfachheit und Ge-
schlossenheit geschaffen.
Fig. 1. Kirche zu Nylarsker.
') F. Seesselberg »Die frühmittelalterliche Kunst
der germanischen Völker.« (Berlin 1897.) Fol. 77 ff.
Als Architypus der Rundkirchen kann die-
jenige von Nylarsker auf Bornholm (Fig. 1)
gelten. Der Grundrifs wird durch einen Kreis ge-
bildet, an welchen ein Oval als Chor mit einem
Halbrund als Apsis angesetzt ist. Nur 3 Fenster-
chen und eine seitliche Thür geben dem Inneren
Licht. Inmitten des Kreises erhebt sich ein
massiver Rundpfeiler als Stütze des Tonnen-
gewölbes. Eine in der Wand ausgesparte
Treppe führt zum Obergeschofs, welches genau
wie das untere auf dem Mittelpfeiler tonnen-
gewölbt ist. Ueber diesem befindet sich ein
Halbgeschofs, auf welches das zurückgezogene
Zeltdach aufsetzt, während
ringsherum ein zinnenbe-
wehrter, freier Umgang führt.
Kultischen Zwecken diente
nur das Erdgeschofs. Das
mittlere Geschofs diente zur
Aufbewahrung von Waffen
und Wurfmaterial, Feldsteinen
und dergleichen, die durch
eine Deckenluke aufgewun-
den wurden.
Das Vorbild dieser selt-
samen Anlagen findet Seessel-
berg in den germanischen
Rundburgen und R^ngwällen,
welche von kreisrundem oder
ovalen Grundrifs noch immer
zahlreich, auch in Mittel-
deutschland erhalten sind. Der Wall ist
ziemlich stark, aber offenbar nur niedrig aus
Feldsteinen errichtet; an der Innenseite ziehen
sich zahlreiche Hüttenbauten hin, sodafs in
dem Beringe sich eine starke Gemeinde mit
fahrender Habe und Vieh bergen konnte. Seessel-
berg unterstellt nun, dafs die Mauern bei voll-
kommnerer Technik und Mörtelanwendung all-
mälig höher geführt, enger zusammengezogen,
bedacht und schliefslich überwölbt worden seien.
Ganz von selbst ergab es sich, die Bergungs-
und Vorrathsräume nun in die oberen Geschosse
zu verlegen und den Wehrgang um das zurück-
gesetzte Dach zu führen. Hiermit ist die Vor-
lage für die feste Rundkirche aus den Uranfängen
germanischer Festungsbaukunst gefunden. Die
Anfügung eines Chores verräth sich als eine
Anleihe bei der christlichen Basilika, da die