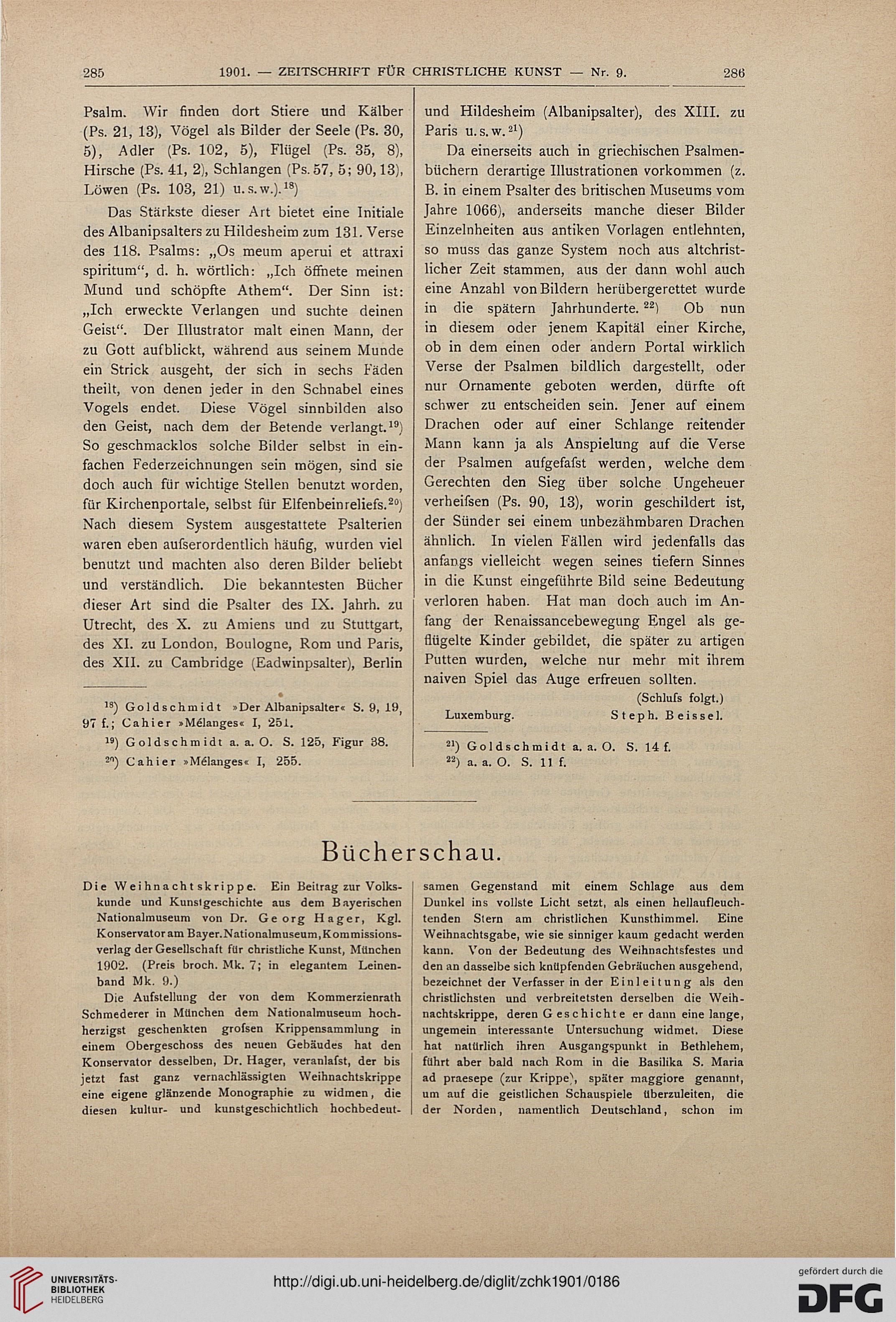285
1901.
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST
Nr. 9.
286
Psalm. Wir finden dort Stiere und Kälber
(Ps. 21, 13), Vögel als Bilder der Seele (Ps. 30,
5), Adler (Ps. 102, 5), Flügel (Ps. 35, 8),
Hirsche (Ps. 41, 2), Schlangen (Ps.57, 5; 90,13),
Löwen (Ps. 103, 21) u.s.w.).18)
Das Stärkste dieser Art bietet eine Initiale
des Albanipsalters zu Hildesheim zum 131. Verse
des 118. Psalms: „Os meum aperui et attraxi
spiritum", d. h. wörtlich: „Ich öffnete meinen
Mund und schöpfte Athem". Der Sinn ist:
„Ich erweckte Verlangen und suchte deinen
Geist". Der Illustrator malt einen Mann, der
zu Gott aufblickt, während aus seinem Munde
ein Strick ausgeht, der sich in sechs Fäden
theilt, von denen jeder in den Schnabel eines
Vogels endet. Diese Vögel sinnbilden also
den Geist, nach dem der Betende verlangt.10)
So geschmacklos solche Bilder selbst in ein-
fachen Federzeichnungen sein mögen, sind sie
doch auch für wichtige Stellen benutzt worden,
für Kirchenportale, selbst für Elfenbeinreliefs.20)
Nach diesem System ausgestattete Psalterien
waren eben aufserordentlich häufig, wurden viel
benutzt und machten also deren Bilder beliebt
und verständlich. Die bekanntesten Bücher
dieser Art sind die Psalter des IX. Jahrh. zu
Utrecht, des X. zu Amiens und zu Stuttgart,
des XI. zu London, Boulogne, Rom und Paris,
des XII. zu Cambridge (Eadwinpsalter), Berlin
") Goldschmidt »Der Albanipsalter« S. 9, 19,
97 f.; Cahier »Melanges« I, 251.
19) Goldschmidt a. a. O. S. 125, Figur 38.
20) Cahier »Melanges« I, 255.
und Hildesheim (Albanipsalter), des XIII. zu
Paris u.s.w.21)
Da einerseits auch in griechischen Psalmen-
büchern derartige Illustrationen vorkommen (z.
B. in einem Psalter des britischen Museums vom
Jahre 1066), anderseits manche dieser Bilder
Einzelnheiten aus antiken Vorlagen entlehnten,
so muss das ganze System noch aus altchrist-
licher Zeit stammen, aus der dann wohl auch
eine Anzahl von Bildern herübergerettet wurde
in die spätem Jahrhunderte. 221 Ob nun
in diesem oder jenem Kapital einer Kirche,
ob in dem einen oder andern Portal wirklich
Verse der Psalmen bildlich dargestellt, oder
nur Ornamente geboten werden, dürfte oft
schwer zu entscheiden sein. Jener auf einem
Drachen oder auf einer Schlange reitender
Mann kann ja als Anspielung auf die Verse
der Psalmen aufgefafst werden, welche dem
Gerechten den Sieg über solche Ungeheuer
verheifsen (Ps. 90, 13), worin geschildert ist,
der Sünder sei einem unbezähmbaren Drachen
ähnlich. In vielen Fällen wird jedenfalls das
anfangs vielleicht wegen seines tiefern Sinnes
in die Kunst eingeführte Bild seine Bedeutung
verloren haben. Hat man doch auch im An-
fang der Renaissancebewegung Engel als ge-
flügelte Kinder gebildet, die später zu artigen
Putten wurden, welche nur mehr mit ihrem
naiven Spiel das Auge erfreuen sollten.
(Schlufs folgt.)
Luxemburg. Steph. Beisse 1.
21) Goldschmidt a. a. O. S. 14 f.
22) a. a. O. S. 11 f.
Bücherschau.
Die Weihnachtskrippe. Ein Beilrag zur Volks-
kunde und Kunstgeschichte aus dem Bayerischen
Nationalmuseum von Dr. Georg Hager, Kgl.
Konservator am Bayer.Nationalmuseum, Kommissions-
verlag der Gesellschaft für christliche Kunst, München
1902. (Preis broch. Mk. 7; in elegantem Leinen-
band Mk. 9.)
Die Aufstellung der von dem Kommerzienrath
Schmederer in München dem Nationalmuseum hoch-
herzigst geschenkten grofsen Krippensammlung in
einem Obergeschoss des neuen Gebäudes hat den
Konservator desselben, Dr. Hager, veranlafst, der bis
jetzt fast ganz vernachlässigten Weihnachtskrippe
eine eigene glänzende Monographie zu widmen, die
diesen kultur- und kunstgeschichtlich hochbedeut-
samen Gegenstand mit einem Schlage aus dem
Dunkel ins vollste Licht setzt, als einen hellaufleuch-
tenden Stern am christlichen Kunsthimmel. Eine
Weihnachtsgabe, wie sie sinniger kaum gedacht werden
kann. Von der Bedeutung des Weihnachtsfestes und
den an dasselbe sich knüpfenden Gebräuchen ausgehend,
bezeichnet der Verfasser in der Einleitung als den
christlichsten und verbreitetsten derselben die Weih-
nachtskrippe, deren Geschichte er dann eine lange,
ungemein interessante Untersuchung widmet. Diese
hat natürlich ihren Ausgangspunkt in Bethlehem,
führt aber bald nach Rom in die Basilika S. Maria
ad praesepe (zur Krippe), später maggiore genannt,
um auf die geistlichen Schauspiele überzuleiten, die
der Norden, namentlich Deutschland, schon im
1901.
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST
Nr. 9.
286
Psalm. Wir finden dort Stiere und Kälber
(Ps. 21, 13), Vögel als Bilder der Seele (Ps. 30,
5), Adler (Ps. 102, 5), Flügel (Ps. 35, 8),
Hirsche (Ps. 41, 2), Schlangen (Ps.57, 5; 90,13),
Löwen (Ps. 103, 21) u.s.w.).18)
Das Stärkste dieser Art bietet eine Initiale
des Albanipsalters zu Hildesheim zum 131. Verse
des 118. Psalms: „Os meum aperui et attraxi
spiritum", d. h. wörtlich: „Ich öffnete meinen
Mund und schöpfte Athem". Der Sinn ist:
„Ich erweckte Verlangen und suchte deinen
Geist". Der Illustrator malt einen Mann, der
zu Gott aufblickt, während aus seinem Munde
ein Strick ausgeht, der sich in sechs Fäden
theilt, von denen jeder in den Schnabel eines
Vogels endet. Diese Vögel sinnbilden also
den Geist, nach dem der Betende verlangt.10)
So geschmacklos solche Bilder selbst in ein-
fachen Federzeichnungen sein mögen, sind sie
doch auch für wichtige Stellen benutzt worden,
für Kirchenportale, selbst für Elfenbeinreliefs.20)
Nach diesem System ausgestattete Psalterien
waren eben aufserordentlich häufig, wurden viel
benutzt und machten also deren Bilder beliebt
und verständlich. Die bekanntesten Bücher
dieser Art sind die Psalter des IX. Jahrh. zu
Utrecht, des X. zu Amiens und zu Stuttgart,
des XI. zu London, Boulogne, Rom und Paris,
des XII. zu Cambridge (Eadwinpsalter), Berlin
") Goldschmidt »Der Albanipsalter« S. 9, 19,
97 f.; Cahier »Melanges« I, 251.
19) Goldschmidt a. a. O. S. 125, Figur 38.
20) Cahier »Melanges« I, 255.
und Hildesheim (Albanipsalter), des XIII. zu
Paris u.s.w.21)
Da einerseits auch in griechischen Psalmen-
büchern derartige Illustrationen vorkommen (z.
B. in einem Psalter des britischen Museums vom
Jahre 1066), anderseits manche dieser Bilder
Einzelnheiten aus antiken Vorlagen entlehnten,
so muss das ganze System noch aus altchrist-
licher Zeit stammen, aus der dann wohl auch
eine Anzahl von Bildern herübergerettet wurde
in die spätem Jahrhunderte. 221 Ob nun
in diesem oder jenem Kapital einer Kirche,
ob in dem einen oder andern Portal wirklich
Verse der Psalmen bildlich dargestellt, oder
nur Ornamente geboten werden, dürfte oft
schwer zu entscheiden sein. Jener auf einem
Drachen oder auf einer Schlange reitender
Mann kann ja als Anspielung auf die Verse
der Psalmen aufgefafst werden, welche dem
Gerechten den Sieg über solche Ungeheuer
verheifsen (Ps. 90, 13), worin geschildert ist,
der Sünder sei einem unbezähmbaren Drachen
ähnlich. In vielen Fällen wird jedenfalls das
anfangs vielleicht wegen seines tiefern Sinnes
in die Kunst eingeführte Bild seine Bedeutung
verloren haben. Hat man doch auch im An-
fang der Renaissancebewegung Engel als ge-
flügelte Kinder gebildet, die später zu artigen
Putten wurden, welche nur mehr mit ihrem
naiven Spiel das Auge erfreuen sollten.
(Schlufs folgt.)
Luxemburg. Steph. Beisse 1.
21) Goldschmidt a. a. O. S. 14 f.
22) a. a. O. S. 11 f.
Bücherschau.
Die Weihnachtskrippe. Ein Beilrag zur Volks-
kunde und Kunstgeschichte aus dem Bayerischen
Nationalmuseum von Dr. Georg Hager, Kgl.
Konservator am Bayer.Nationalmuseum, Kommissions-
verlag der Gesellschaft für christliche Kunst, München
1902. (Preis broch. Mk. 7; in elegantem Leinen-
band Mk. 9.)
Die Aufstellung der von dem Kommerzienrath
Schmederer in München dem Nationalmuseum hoch-
herzigst geschenkten grofsen Krippensammlung in
einem Obergeschoss des neuen Gebäudes hat den
Konservator desselben, Dr. Hager, veranlafst, der bis
jetzt fast ganz vernachlässigten Weihnachtskrippe
eine eigene glänzende Monographie zu widmen, die
diesen kultur- und kunstgeschichtlich hochbedeut-
samen Gegenstand mit einem Schlage aus dem
Dunkel ins vollste Licht setzt, als einen hellaufleuch-
tenden Stern am christlichen Kunsthimmel. Eine
Weihnachtsgabe, wie sie sinniger kaum gedacht werden
kann. Von der Bedeutung des Weihnachtsfestes und
den an dasselbe sich knüpfenden Gebräuchen ausgehend,
bezeichnet der Verfasser in der Einleitung als den
christlichsten und verbreitetsten derselben die Weih-
nachtskrippe, deren Geschichte er dann eine lange,
ungemein interessante Untersuchung widmet. Diese
hat natürlich ihren Ausgangspunkt in Bethlehem,
führt aber bald nach Rom in die Basilika S. Maria
ad praesepe (zur Krippe), später maggiore genannt,
um auf die geistlichen Schauspiele überzuleiten, die
der Norden, namentlich Deutschland, schon im