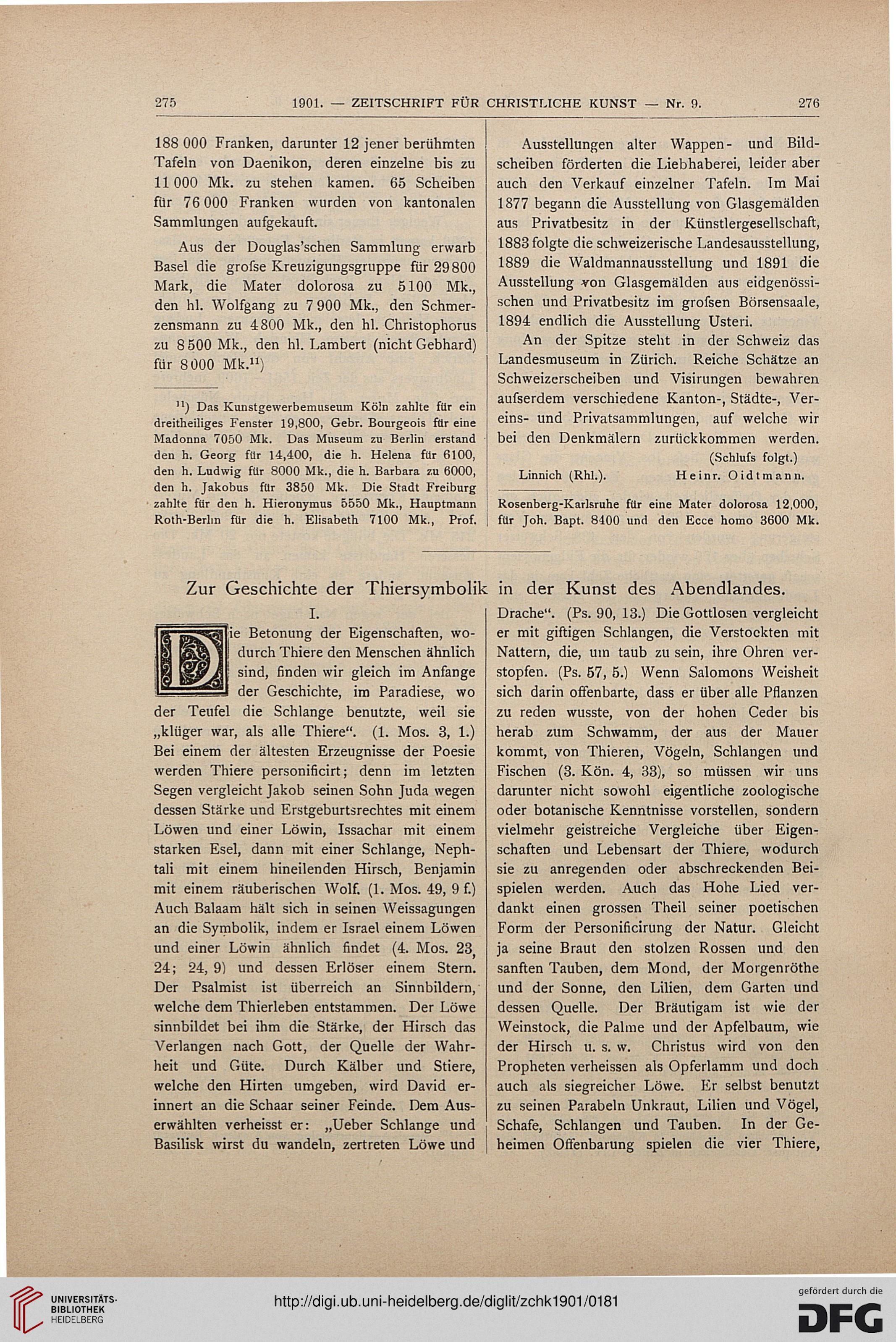275
1901. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 9.
276
188 000 Franken, darunter 12 jener berühmten
Tafeln von Daenikon, deren einzelne bis zu
11000 Mk. zu stehen kamen. 65 Scheiben
für 76 000 Franken wurden von kantonalen
Sammlungen aufgekauft.
Aus der Douglas'schen Sammlung erwarb
Basel die grofse Kreuzigungsgruppe für 29800
Mark, die Mater dolorosa zu 5100 Mk.,
den hl. Wolfgang zu 7 900 Mk., den Schmer-
zensmann zu 4800 Mk., den hl. Christophorus
zu 8 500 Mk., den hl. Lambert (nicht Gebhard)
für 8000 Mk.11)
") Das Kunstgewerbemuseum Köln zahlte für ein
dreitheiliges Fenster 19,800, Gebr. Bourgeois für eine
Madonna 7050 Mk. Das Museum zu Berlin erstand
den h. Georg für 14,400, die h. Helena für 6100,
den h. Ludwig für 8000 Mk., die h. Barbara zu 6000,
den h. Jakobus für 3850 Mk. Die Stadt Freiburg
zahlte für den h. Hieronymus 5550 Mk., Hauptmann
Roth-Berlin für die h. Elisabeth 7100 Mk., Prof.
Ausstellungen alter Wappen- und Bild-
scheiben förderten die Liebhaberei, leider aber
auch den Verkauf einzelner Tafeln. Im Mai
1877 begann die Ausstellung von Glasgemälden
aus Privatbesitz in der Künstlergesellschaft,
1883 folgte die schweizerische Landesausstellung,
1889 die Waldmannausstellung und 1891 die
Ausstellung von Glasgemälden aus eidgenössi-
schen und Privatbesitz im grofsen Börsensaale,
1894 endlich die Ausstellung Usteri.
An der Spitze steht in der Schweiz das
Landesmuseum in Zürich. Reiche Schätze an
Schweizerscheiben und Visirungen bewahren
aufserdem verschiedene Kanton-, Städte-, Ver-
eins- und Privatsammlungen, auf welche wir
bei den Denkmälern zurückkommen werden.
(Schlufs folgt.)
Linnich (Rbl.). Heinr. Oidtmann.
Rosenberg-Karlsruhe für eine Mater dolorosa 12,000,
für Joh. Bapt. 8400 und den Ecce homo 3600 Mk.
Zur Geschichte der Thiersymbolik
I.
ie Betonung der Eigenschaften, wo-
durch Thiere den Menschen ähnlich
sind, finden wir gleich im Anfange
SJ der Geschichte, im Paradiese, wo
der Teufel die Schlange benutzte, weil sie
„klüger war, als alle Thiere". (1. Mos. 3, 1.)
Bei einem der ältesten Erzeugnisse der Poesie
werden Thiere personificirt; denn im letzten
Segen vergleicht Jakob seinen Sohn Juda wegen
dessen Stärke und Erstgeburtsrechtes mit einem
Löwen und einer Löwin, Issachar mit einem
starken Esel, dann mit einer Schlange, Neph-
tali mit einem hineilenden Hirsch, Benjamin
mit einem räuberischen Wolf. (1. Mos. 49, 9 f.)
Auch Balaam hält sich in seinen Weissagungen
an die Symbolik, indem er Israel einem Löwen
und einer Löwin ähnlich findet (4. Mos. 23
24; 24, 9) und dessen Erlöser einem Stern.
Der Psalmist ist überreich an Sinnbildern,
welche dem Thierleben entstammen. Der Löwe
sinnbildet bei ihm die Stärke, der Hirsch das
Verlangen nach Gott, der Quelle der Wahr-
heit und Güte. Durch Kälber und Stiere,
welche den Hirten umgeben, wird David er-
innert an die Schaar seiner Feinde. Dem Aus-
erwählten verheisst er: „Ueber Schlange und
Basilisk wirst du wandeln, zertreten Löwe und
in der Kunst des Abendlandes.
Drache". (Ps. 90, 13.) Die Gottlosen vergleicht
er mit giftigen Schlangen, die Verstockten mit
Nattern, die, um taub zu sein, ihre Ohren ver-
stopfen. (Ps. 57, 5.) Wenn Salomons Weisheit
sich darin offenbarte, dass er über alle Pflanzen
zu reden wusste, von der hohen Ceder bis
herab zum Schwamm, der aus der Mauer
kommt, von Thieren, Vögeln, Schlangen und
Fischen (3. Kön. 4, 33), so müssen wir uns
darunter nicht sowohl eigentliche zoologische
oder botanische Kenntnisse vorstellen, sondern
vielmehr geistreiche Vergleiche über Eigen-
schaften und Lebensart der Thiere, wodurch
sie zu anregenden oder abschreckenden Bei-
spielen werden. Auch das Hohe Lied ver-
dankt einen grossen Theil seiner poetischen
Form der Personificirung der Natur. Gleicht
ja seine Braut den stolzen Rossen und den
sanften Tauben, dem Mond, der Morgenröthe
und der Sonne, den Lilien, dem Garten und
dessen Quelle. Der Bräutigam ist wie der
Weinstock, die Palme und der Apfelbaum, wie
der Hirsch u. s. w. Christus wird von den
Propheten verheissen als Opferlamm und doch
auch als siegreicher Löwe. Er selbst benutzt
zu seinen Parabeln Unkraut, Lilien und Vögel,
Schafe, Schlangen und Tauben. In der Ge-
heimen Offenbarung spielen die vier Thiere,
1901. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 9.
276
188 000 Franken, darunter 12 jener berühmten
Tafeln von Daenikon, deren einzelne bis zu
11000 Mk. zu stehen kamen. 65 Scheiben
für 76 000 Franken wurden von kantonalen
Sammlungen aufgekauft.
Aus der Douglas'schen Sammlung erwarb
Basel die grofse Kreuzigungsgruppe für 29800
Mark, die Mater dolorosa zu 5100 Mk.,
den hl. Wolfgang zu 7 900 Mk., den Schmer-
zensmann zu 4800 Mk., den hl. Christophorus
zu 8 500 Mk., den hl. Lambert (nicht Gebhard)
für 8000 Mk.11)
") Das Kunstgewerbemuseum Köln zahlte für ein
dreitheiliges Fenster 19,800, Gebr. Bourgeois für eine
Madonna 7050 Mk. Das Museum zu Berlin erstand
den h. Georg für 14,400, die h. Helena für 6100,
den h. Ludwig für 8000 Mk., die h. Barbara zu 6000,
den h. Jakobus für 3850 Mk. Die Stadt Freiburg
zahlte für den h. Hieronymus 5550 Mk., Hauptmann
Roth-Berlin für die h. Elisabeth 7100 Mk., Prof.
Ausstellungen alter Wappen- und Bild-
scheiben förderten die Liebhaberei, leider aber
auch den Verkauf einzelner Tafeln. Im Mai
1877 begann die Ausstellung von Glasgemälden
aus Privatbesitz in der Künstlergesellschaft,
1883 folgte die schweizerische Landesausstellung,
1889 die Waldmannausstellung und 1891 die
Ausstellung von Glasgemälden aus eidgenössi-
schen und Privatbesitz im grofsen Börsensaale,
1894 endlich die Ausstellung Usteri.
An der Spitze steht in der Schweiz das
Landesmuseum in Zürich. Reiche Schätze an
Schweizerscheiben und Visirungen bewahren
aufserdem verschiedene Kanton-, Städte-, Ver-
eins- und Privatsammlungen, auf welche wir
bei den Denkmälern zurückkommen werden.
(Schlufs folgt.)
Linnich (Rbl.). Heinr. Oidtmann.
Rosenberg-Karlsruhe für eine Mater dolorosa 12,000,
für Joh. Bapt. 8400 und den Ecce homo 3600 Mk.
Zur Geschichte der Thiersymbolik
I.
ie Betonung der Eigenschaften, wo-
durch Thiere den Menschen ähnlich
sind, finden wir gleich im Anfange
SJ der Geschichte, im Paradiese, wo
der Teufel die Schlange benutzte, weil sie
„klüger war, als alle Thiere". (1. Mos. 3, 1.)
Bei einem der ältesten Erzeugnisse der Poesie
werden Thiere personificirt; denn im letzten
Segen vergleicht Jakob seinen Sohn Juda wegen
dessen Stärke und Erstgeburtsrechtes mit einem
Löwen und einer Löwin, Issachar mit einem
starken Esel, dann mit einer Schlange, Neph-
tali mit einem hineilenden Hirsch, Benjamin
mit einem räuberischen Wolf. (1. Mos. 49, 9 f.)
Auch Balaam hält sich in seinen Weissagungen
an die Symbolik, indem er Israel einem Löwen
und einer Löwin ähnlich findet (4. Mos. 23
24; 24, 9) und dessen Erlöser einem Stern.
Der Psalmist ist überreich an Sinnbildern,
welche dem Thierleben entstammen. Der Löwe
sinnbildet bei ihm die Stärke, der Hirsch das
Verlangen nach Gott, der Quelle der Wahr-
heit und Güte. Durch Kälber und Stiere,
welche den Hirten umgeben, wird David er-
innert an die Schaar seiner Feinde. Dem Aus-
erwählten verheisst er: „Ueber Schlange und
Basilisk wirst du wandeln, zertreten Löwe und
in der Kunst des Abendlandes.
Drache". (Ps. 90, 13.) Die Gottlosen vergleicht
er mit giftigen Schlangen, die Verstockten mit
Nattern, die, um taub zu sein, ihre Ohren ver-
stopfen. (Ps. 57, 5.) Wenn Salomons Weisheit
sich darin offenbarte, dass er über alle Pflanzen
zu reden wusste, von der hohen Ceder bis
herab zum Schwamm, der aus der Mauer
kommt, von Thieren, Vögeln, Schlangen und
Fischen (3. Kön. 4, 33), so müssen wir uns
darunter nicht sowohl eigentliche zoologische
oder botanische Kenntnisse vorstellen, sondern
vielmehr geistreiche Vergleiche über Eigen-
schaften und Lebensart der Thiere, wodurch
sie zu anregenden oder abschreckenden Bei-
spielen werden. Auch das Hohe Lied ver-
dankt einen grossen Theil seiner poetischen
Form der Personificirung der Natur. Gleicht
ja seine Braut den stolzen Rossen und den
sanften Tauben, dem Mond, der Morgenröthe
und der Sonne, den Lilien, dem Garten und
dessen Quelle. Der Bräutigam ist wie der
Weinstock, die Palme und der Apfelbaum, wie
der Hirsch u. s. w. Christus wird von den
Propheten verheissen als Opferlamm und doch
auch als siegreicher Löwe. Er selbst benutzt
zu seinen Parabeln Unkraut, Lilien und Vögel,
Schafe, Schlangen und Tauben. In der Ge-
heimen Offenbarung spielen die vier Thiere,