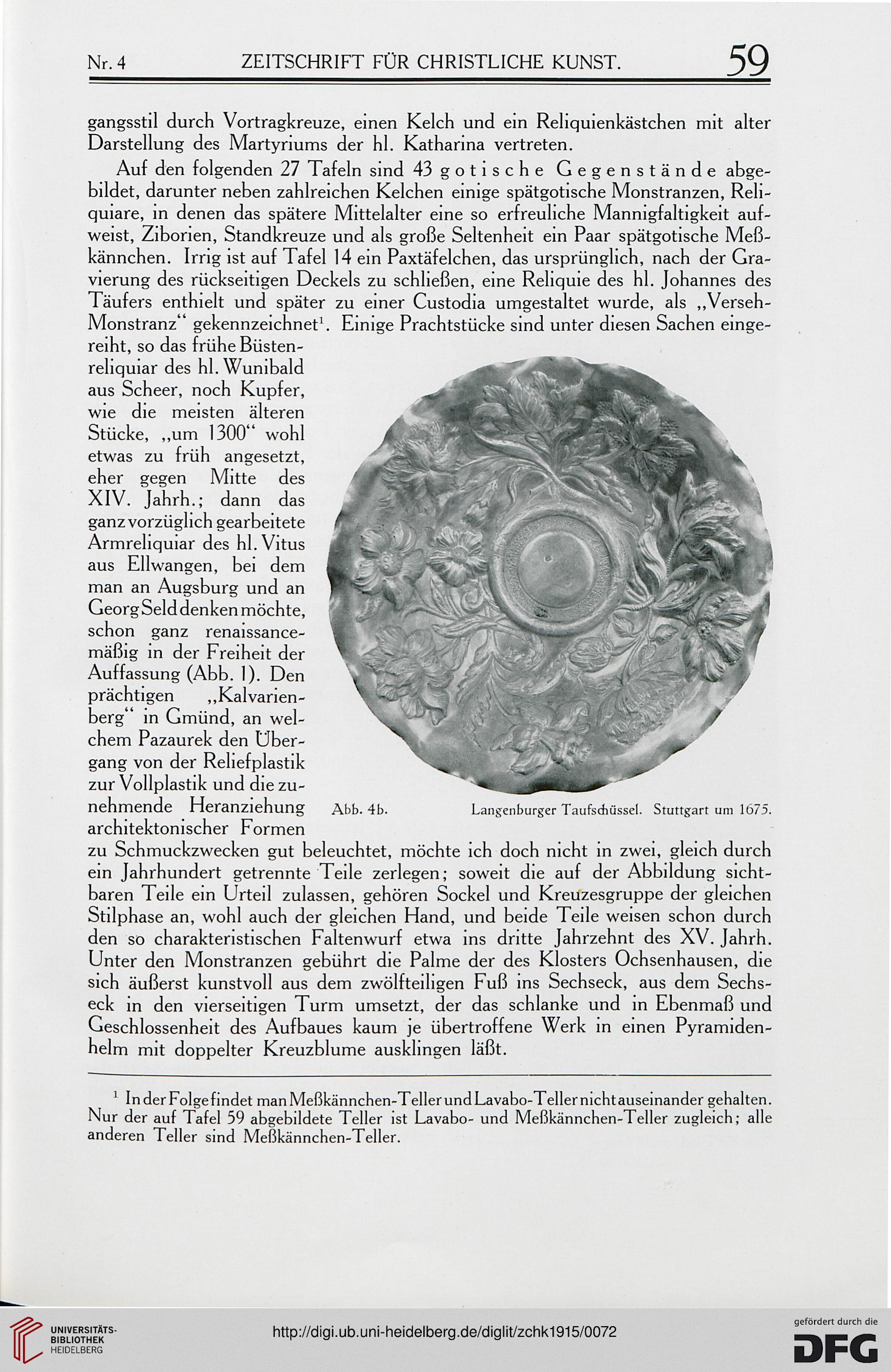Nr. 4
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST.
59
gangsstil durch Vortragkreuze, einen Kelch und ein Reliquienkästchen mit alter
Darstellung des Martyriums der hl. Katharina vertreten.
Auf den folgenden 27 Tafeln sind 43 gotische Gegenstände abge-
bildet, darunter neben zahlreichen Kelchen einige spätgotische Monstranzen, Reh-
quiare, in denen das spätere Mittelalter eine so erfreuliche Mannigfaltigkeit auf-
weist, Ziborien, Standkreuze und als große Seltenheit ein Paar spätgotische Meß-
kännchen. Irrig ist auf Tafel 14 ein Paxtäfelchen, das ursprünglich, nach der Gra-
vierung des rückseitigen Deckels zu schließen, eine Reliquie des hl. Johannes des
Täufers enthielt und später zu einer Custodia umgestaltet wurde, als „Verseh-
Monstranz" gekennzeichnet1. Einige Prachtstücke sind unter diesen Sachen einge-
reiht, so das frühe Büsten-
rehquiar des hl. Wunibald
aus Scheer, noch Kupfer,
wie die meisten älteren
Stücke, „um 1300" wohl
etwas zu früh angesetzt,
eher gegen Mitte des
XIV. Jahrh.; dann das
ganz vorzüglich gearbeitete
Armrehquiar des hl.Vitus
aus Ellwangen, bei dem
man an Augsburg und an
GeorgSelddenken möchte,
schon ganz renaissance-
mäßig in der Freiheit der
Auffassung (Abb. 1). Den
prächtigen „Kalvarien-
berg" in Gmünd, an wel-
chem Pazaurek den Über-
gang von der Reliefplastik
zur Vollplastik und die zu-
nehmende Heranziehung
architektonischer Formen
zu Schmuckzwecken gut beleuchtet, möchte ich doch nicht in zwei, gleich durch
ein Jahrhundert getrennte Teile zerlegen; soweit die auf der Abbildung sicht-
baren Teile ein Urteil zulassen, gehören Sockel und Kreuzesgruppe der gleichen
Stilphase an, wohl auch der gleichen Hand, und beide Teile weisen schon durch
den so charakteristischen Faltenwurf etwa ins dritte Jahrzehnt des XV. Jahrh.
Unter den Monstranzen gebührt die Palme der des Klosters Ochsenhausen, die
sich äußerst kunstvoll aus dem zwölfteiligen Fuß ins Sechseck, aus dem Sechs-
eck in den vierseitigen Turm umsetzt, der das schlanke und in Ebenmaß und
Geschlossenheit des Aufbaues kaum je übertroffene Werk in einen Pyramiden-
helm mit doppelter Kreuzblume ausklingen läßt.
Abb. 4b.
Langenburger Taufschüssel. Stuttgart um 1675.
1 Inder Folgefindet manMeßkännchen-TellerundLavabo-Tellernichtauseinander gehalten.
Nur der auf Tafel 59 abgebildete Teller ist Lavabo- und Meßkännchen-Teller zugleich; alle
anderen Teller sind Meßkännchen-Teller.
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST.
59
gangsstil durch Vortragkreuze, einen Kelch und ein Reliquienkästchen mit alter
Darstellung des Martyriums der hl. Katharina vertreten.
Auf den folgenden 27 Tafeln sind 43 gotische Gegenstände abge-
bildet, darunter neben zahlreichen Kelchen einige spätgotische Monstranzen, Reh-
quiare, in denen das spätere Mittelalter eine so erfreuliche Mannigfaltigkeit auf-
weist, Ziborien, Standkreuze und als große Seltenheit ein Paar spätgotische Meß-
kännchen. Irrig ist auf Tafel 14 ein Paxtäfelchen, das ursprünglich, nach der Gra-
vierung des rückseitigen Deckels zu schließen, eine Reliquie des hl. Johannes des
Täufers enthielt und später zu einer Custodia umgestaltet wurde, als „Verseh-
Monstranz" gekennzeichnet1. Einige Prachtstücke sind unter diesen Sachen einge-
reiht, so das frühe Büsten-
rehquiar des hl. Wunibald
aus Scheer, noch Kupfer,
wie die meisten älteren
Stücke, „um 1300" wohl
etwas zu früh angesetzt,
eher gegen Mitte des
XIV. Jahrh.; dann das
ganz vorzüglich gearbeitete
Armrehquiar des hl.Vitus
aus Ellwangen, bei dem
man an Augsburg und an
GeorgSelddenken möchte,
schon ganz renaissance-
mäßig in der Freiheit der
Auffassung (Abb. 1). Den
prächtigen „Kalvarien-
berg" in Gmünd, an wel-
chem Pazaurek den Über-
gang von der Reliefplastik
zur Vollplastik und die zu-
nehmende Heranziehung
architektonischer Formen
zu Schmuckzwecken gut beleuchtet, möchte ich doch nicht in zwei, gleich durch
ein Jahrhundert getrennte Teile zerlegen; soweit die auf der Abbildung sicht-
baren Teile ein Urteil zulassen, gehören Sockel und Kreuzesgruppe der gleichen
Stilphase an, wohl auch der gleichen Hand, und beide Teile weisen schon durch
den so charakteristischen Faltenwurf etwa ins dritte Jahrzehnt des XV. Jahrh.
Unter den Monstranzen gebührt die Palme der des Klosters Ochsenhausen, die
sich äußerst kunstvoll aus dem zwölfteiligen Fuß ins Sechseck, aus dem Sechs-
eck in den vierseitigen Turm umsetzt, der das schlanke und in Ebenmaß und
Geschlossenheit des Aufbaues kaum je übertroffene Werk in einen Pyramiden-
helm mit doppelter Kreuzblume ausklingen läßt.
Abb. 4b.
Langenburger Taufschüssel. Stuttgart um 1675.
1 Inder Folgefindet manMeßkännchen-TellerundLavabo-Tellernichtauseinander gehalten.
Nur der auf Tafel 59 abgebildete Teller ist Lavabo- und Meßkännchen-Teller zugleich; alle
anderen Teller sind Meßkännchen-Teller.