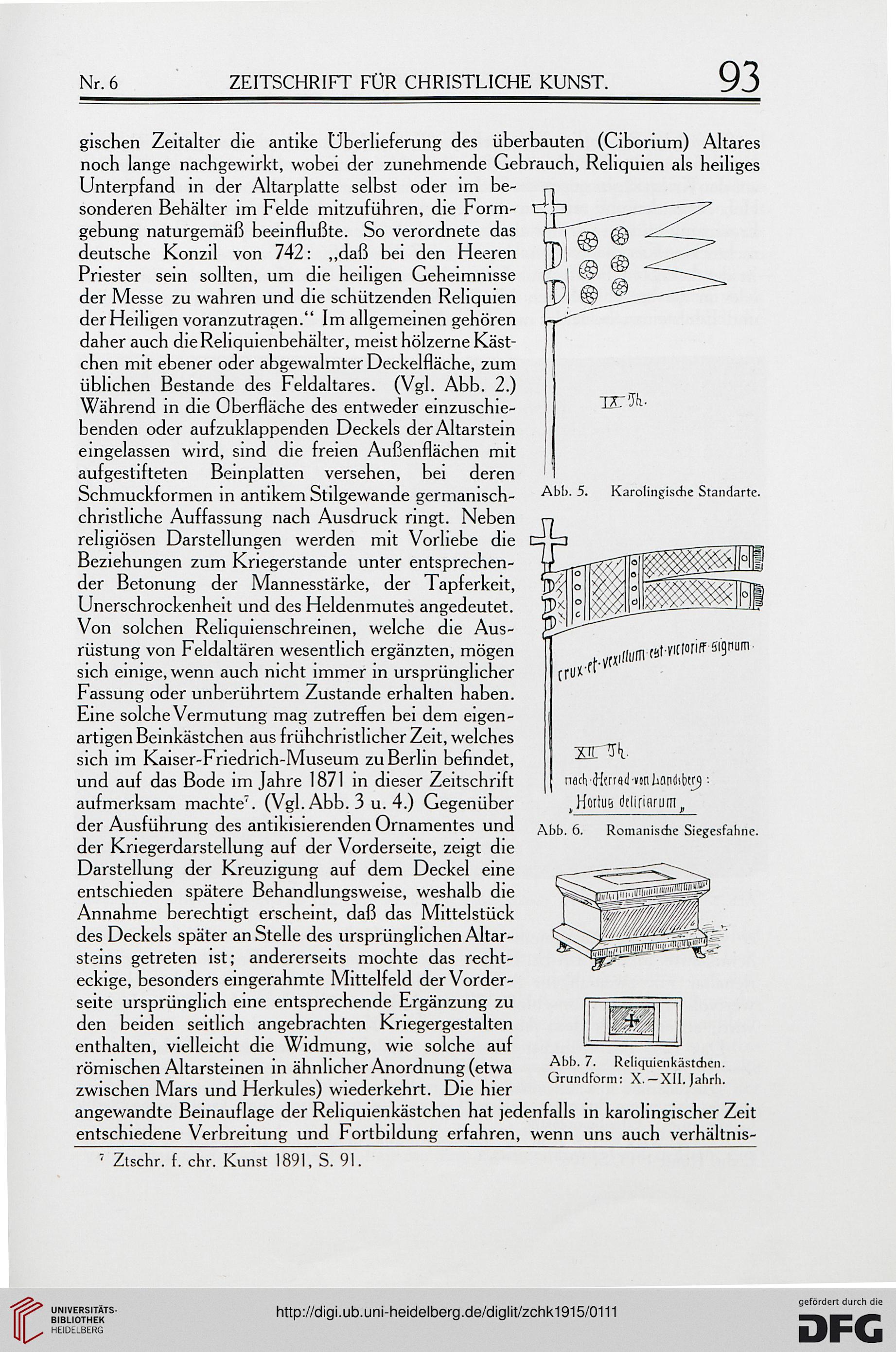Nr. 6
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST.
93
Abi). 5. Karolingisrhe Standarte.
gischen Zeitalter die antike Überlieferung des überbauten (Ciborium) Altares
noch lange nachgewirkt, wobei der zunehmende Gebrauch, Reliquien als heiliges
Unterpfand in der Altarplatte selbst oder im be-
sonderen Behälter im Felde mitzuführen, die Form-
gebung naturgemäß beeinflußte. So verordnete das
deutsche Konzil von 742: „daß bei den Heeren
Priester sein sollten, um die heiligen Geheimnisse
der Messe zu wahren und die schützenden Reliquien
der Heiligen voranzutragen." Im allgemeinen gehören
daher auch die Reliquienbehälter, meist hölzerne Käst-
chen mit ebener oder abgewalmter Deckelfläche, zum
üblichen Bestände des Feldaltares. (Vgl. Abb. 2.)
Während in die Oberfläche des entweder einzuschie-
benden oder aufzuklappenden Deckels der Altarstein
eingelassen wird, sind die freien Außenflächen mit
aufgestifteten Beinplatten versehen, bei deren
Schmuckformen in antikem Stilgewande germanisch-
christliche Auffassung nach Ausdruck ringt. Neben
religiösen Darstellungen werden mit Vorliebe die
Beziehungen zum Kriegerstande unter entsprechen-
der Betonung der Mannesstärke, der Tapferkeit,
Unerschrockenheit und des Heldenmutes angedeutet.
Von solchen Reliquienschreinen, welche die Aus-
rüstung von Feldaltären wesentlich ergänzten, mögen
sich einige, wenn auch nicht immer in ursprünglicher
Fassung oder unberührtem Zustande erhalten haben.
Eine solche Vermutung mag zutreffen bei dem eigen-
artigen Beinkästchen aus frühchristlicher Zeit, welches
sich im Kaiser-Fnednch-Museum zu Berlin befindet,
und auf das Bode im Jahre 1871 in dieser Zeitschrift
aufmerksam machte7. (Vgl. Abb. 3 u. 4.) Gegenüber
der Ausführung des antikisierenden Ornamentes und
der Kriegerdarstellung auf der Vorderseite, zeigt die
Darstellung der Kreuzigung auf dem Deckel eine
entschieden spätere Behandlungsweise, weshalb die
Annahme berechtigt erscheint, daß das Mittelstück
des Deckels später an Stelle des ursprünglichen Altar-
steins getreten ist; andererseits mochte das recht-
eckige, besonders eingerahmte Mittelfeld der Vorder-
seite ursprünglich eine entsprechende Ergänzung zu
den beiden seitlich angebrachten Kriegergestalten
enthalten, vielleicht die Widmung, wie solche auf
römischen Altarsteinen in ähnlicher Anordnung (etwa
zwischen Mars und Herkules) wiederkehrt. Die hier
angev/andte Beinauflage der Reliquienkästchen hat jedenfalls in karolingischer Zeit
entschiedene Verbreitung und Fortbildung erfahren, wenn uns auch verhältnis-
7 Ztschr. f. ehr. Kunst 1891, S. 91.
cru*
.ff.v«'»"fn
fBfvicfonrr Signum
Eni
nach <H«rrad-¥onhan(iit)cy ;
Hortue dtliriflrum „
Abb, 6. Romanische Siegesfahne.
Ht
1
Abi). 7. Relk|uienkästchen.
Grundform: X. —XII. Jahrb.
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST.
93
Abi). 5. Karolingisrhe Standarte.
gischen Zeitalter die antike Überlieferung des überbauten (Ciborium) Altares
noch lange nachgewirkt, wobei der zunehmende Gebrauch, Reliquien als heiliges
Unterpfand in der Altarplatte selbst oder im be-
sonderen Behälter im Felde mitzuführen, die Form-
gebung naturgemäß beeinflußte. So verordnete das
deutsche Konzil von 742: „daß bei den Heeren
Priester sein sollten, um die heiligen Geheimnisse
der Messe zu wahren und die schützenden Reliquien
der Heiligen voranzutragen." Im allgemeinen gehören
daher auch die Reliquienbehälter, meist hölzerne Käst-
chen mit ebener oder abgewalmter Deckelfläche, zum
üblichen Bestände des Feldaltares. (Vgl. Abb. 2.)
Während in die Oberfläche des entweder einzuschie-
benden oder aufzuklappenden Deckels der Altarstein
eingelassen wird, sind die freien Außenflächen mit
aufgestifteten Beinplatten versehen, bei deren
Schmuckformen in antikem Stilgewande germanisch-
christliche Auffassung nach Ausdruck ringt. Neben
religiösen Darstellungen werden mit Vorliebe die
Beziehungen zum Kriegerstande unter entsprechen-
der Betonung der Mannesstärke, der Tapferkeit,
Unerschrockenheit und des Heldenmutes angedeutet.
Von solchen Reliquienschreinen, welche die Aus-
rüstung von Feldaltären wesentlich ergänzten, mögen
sich einige, wenn auch nicht immer in ursprünglicher
Fassung oder unberührtem Zustande erhalten haben.
Eine solche Vermutung mag zutreffen bei dem eigen-
artigen Beinkästchen aus frühchristlicher Zeit, welches
sich im Kaiser-Fnednch-Museum zu Berlin befindet,
und auf das Bode im Jahre 1871 in dieser Zeitschrift
aufmerksam machte7. (Vgl. Abb. 3 u. 4.) Gegenüber
der Ausführung des antikisierenden Ornamentes und
der Kriegerdarstellung auf der Vorderseite, zeigt die
Darstellung der Kreuzigung auf dem Deckel eine
entschieden spätere Behandlungsweise, weshalb die
Annahme berechtigt erscheint, daß das Mittelstück
des Deckels später an Stelle des ursprünglichen Altar-
steins getreten ist; andererseits mochte das recht-
eckige, besonders eingerahmte Mittelfeld der Vorder-
seite ursprünglich eine entsprechende Ergänzung zu
den beiden seitlich angebrachten Kriegergestalten
enthalten, vielleicht die Widmung, wie solche auf
römischen Altarsteinen in ähnlicher Anordnung (etwa
zwischen Mars und Herkules) wiederkehrt. Die hier
angev/andte Beinauflage der Reliquienkästchen hat jedenfalls in karolingischer Zeit
entschiedene Verbreitung und Fortbildung erfahren, wenn uns auch verhältnis-
7 Ztschr. f. ehr. Kunst 1891, S. 91.
cru*
.ff.v«'»"fn
fBfvicfonrr Signum
Eni
nach <H«rrad-¥onhan(iit)cy ;
Hortue dtliriflrum „
Abb, 6. Romanische Siegesfahne.
Ht
1
Abi). 7. Relk|uienkästchen.
Grundform: X. —XII. Jahrb.