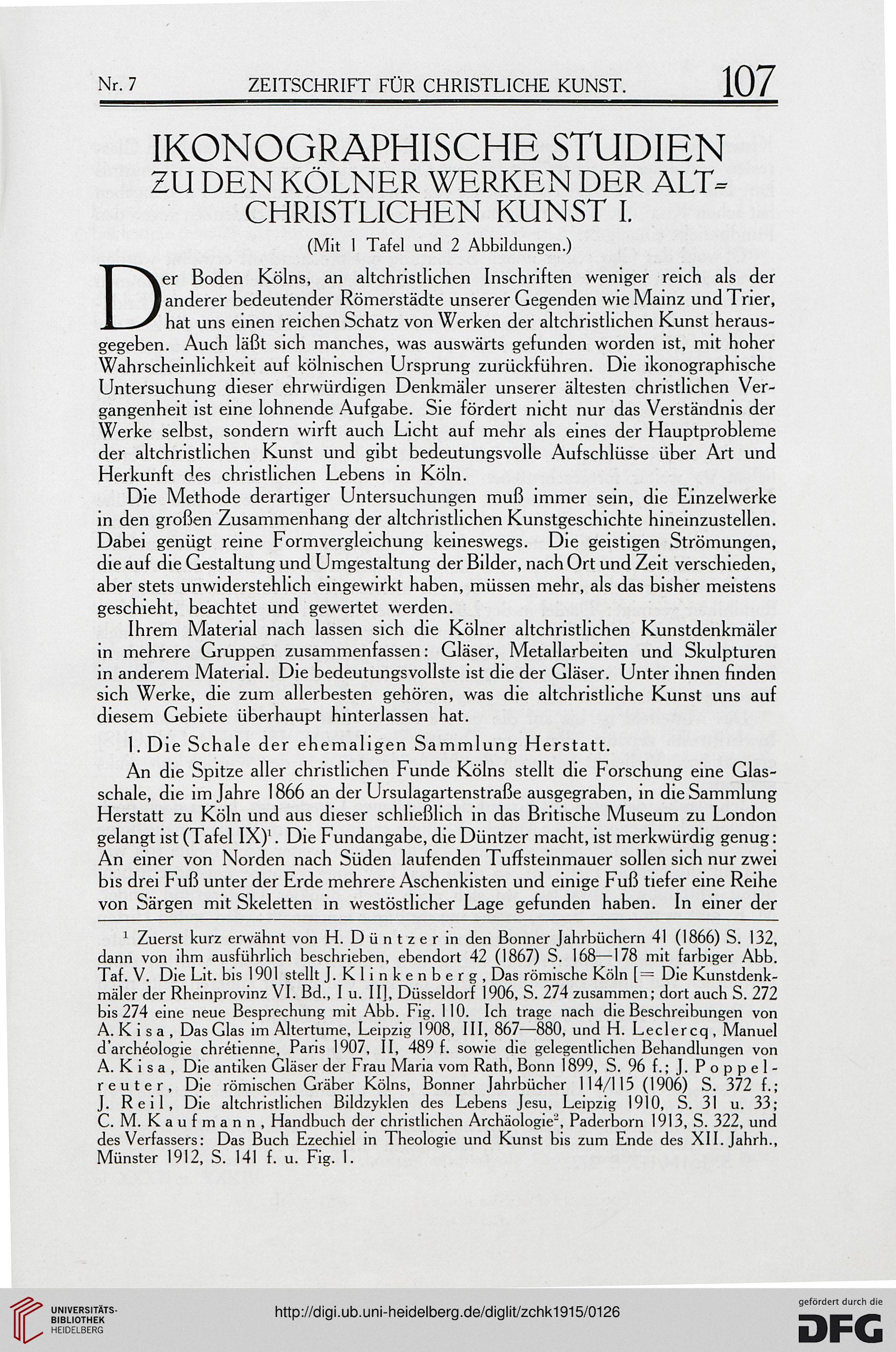Nr. 7____________ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST.__________jQ7
IKONOGRAPHISCHE STUDIEN
ZU DEN KÖLNER WERKEN DER ALT^
CHRISTLICHEN KUNST I.
(Mit 1 Tafel und 2 Abbildungen.)
Der Boden Kölns, an altchristlichen Inschriften weniger reich als der
anderer bedeutender Römerstädte unserer Gegenden wie Mainz und Trier,
hat uns einen reichen Schatz von Werken der altchristlichen Kunst heraus-
gegeben. Auch läßt sich manches, was auswärts gefunden worden ist, mit hoher
Wahrscheinlichkeit auf kölnischen Ursprung zurückführen. Die ikonographische
Untersuchung dieser ehrwürdigen Denkmäler unserer ältesten christlichen Ver-
gangenheit ist eine lohnende Aufgabe. Sie fördert nicht nur das Verständnis der
Werke selbst, sondern wirft auch Licht auf mehr als eines der Hauptprobleme
der altchristlichen Kunst und gibt bedeutungsvolle Aufschlüsse über Art und
Herkunft des christlichen Lebens in Köln.
Die Methode derartiger Untersuchungen muß immer sein, die Einzelwerke
in den großen Zusammenhang der altchnsthchen Kunstgeschichte hineinzustellen.
Dabei genügt reine Formvergleichung keineswegs. Die geistigen Strömungen,
die auf die Gestaltung und Umgestaltung der Bilder, nach Ort und Zeit verschieden,
aber stets unwiderstehlich eingewirkt haben, müssen mehr, als das bisher meistens
geschieht, beachtet und gewertet werden.
Ihrem Material nach lassen sich die Kölner altchristlichen Kunstdenkmäler
in mehrere Gruppen zusammenfassen: Gläser, Metallarbeiten und Skulpturen
in anderem Material. Die bedeutungsvollste ist die der Gläser. Unter ihnen finden
sich Werke, die zum allerbesten gehören, was die altchristliche Kunst uns auf
diesem Gebiete überhaupt hinterlassen hat.
1. Die Schale der ehemaligen Sammlung Herstatt.
An die Spitze aller christlichen Funde Kölns stellt die Forschung eine Glas-
schale, die im Jahre 1866 an der Ursulagartenstraße ausgegraben, in die Sammlung
Herstatt zu Köln und aus dieser schließlich in das Britische Museum zu London
gelangt ist (Tafel IX)'. Die Fundangabe, die Düntzer macht, ist merkwürdig genug:
An einer von Norden nach Süden laufenden Tuffsteinmauer sollen sich nur zwei
bis drei Fuß unter der Erde mehrere Aschenkisten und einige Fuß tiefer eine Reihe
von Särgen mit Skeletten in westöstlicher Lage gefunden haben. In einer der
1 Zuerst kurz erwähnt von H. Düntzer in den Bonner Jahrbüchern 41 (1866) S. 132,
dann von ihm ausführlich beschrieben, ebendort 42 (1867) S. 168—178 mit farbiger Abb.
Taf. V. Die Lit. bis 1901 stellt J.Klinkenberg, Das römische Köln [= Die Kunstdenk-
mäler der Rheinprovinz VI. Bd., I u. II], Düsseldorf 1906, S. 274 zusammen; dort auch S. 272
bis 274 eine neue Besprechung mit Abb. Fig. 110. Ich trage nach die Beschreibungen von
A. Kisa, Das Glas im Altertume, Leipzig 1908, III, 867—880, und H. Leclercq, Manuel
d'archeologie chretienne, Paris 1907, II, 489 f. sowie die gelegentlichen Behandlungen von
A. K i s a , Die antiken Gläser der Frau Maria vom Rath, Bonn 1899, S. 96 f.; J. P o p p e 1 -
reuter, Die römischen Gräber Kölns, Bonner Jahrbücher 114/115 (1906) S. 372 f.;
J. Reil, Die altchnsthchen Bildzyklen des Lebens Jesu, Leipzig 1910, S. 31 u. 33;
C. M. Kaufmann, Handbuch der christlichen Archäologie", Paderborn 1913, S. 322, und
des Verfassers: Das Buch Ezechiel in Theologie und Kunst bis zum Ende des XH.Jahrh.,
Münster 1912, S. 141 f. u. Fig. 1.
IKONOGRAPHISCHE STUDIEN
ZU DEN KÖLNER WERKEN DER ALT^
CHRISTLICHEN KUNST I.
(Mit 1 Tafel und 2 Abbildungen.)
Der Boden Kölns, an altchristlichen Inschriften weniger reich als der
anderer bedeutender Römerstädte unserer Gegenden wie Mainz und Trier,
hat uns einen reichen Schatz von Werken der altchristlichen Kunst heraus-
gegeben. Auch läßt sich manches, was auswärts gefunden worden ist, mit hoher
Wahrscheinlichkeit auf kölnischen Ursprung zurückführen. Die ikonographische
Untersuchung dieser ehrwürdigen Denkmäler unserer ältesten christlichen Ver-
gangenheit ist eine lohnende Aufgabe. Sie fördert nicht nur das Verständnis der
Werke selbst, sondern wirft auch Licht auf mehr als eines der Hauptprobleme
der altchristlichen Kunst und gibt bedeutungsvolle Aufschlüsse über Art und
Herkunft des christlichen Lebens in Köln.
Die Methode derartiger Untersuchungen muß immer sein, die Einzelwerke
in den großen Zusammenhang der altchnsthchen Kunstgeschichte hineinzustellen.
Dabei genügt reine Formvergleichung keineswegs. Die geistigen Strömungen,
die auf die Gestaltung und Umgestaltung der Bilder, nach Ort und Zeit verschieden,
aber stets unwiderstehlich eingewirkt haben, müssen mehr, als das bisher meistens
geschieht, beachtet und gewertet werden.
Ihrem Material nach lassen sich die Kölner altchristlichen Kunstdenkmäler
in mehrere Gruppen zusammenfassen: Gläser, Metallarbeiten und Skulpturen
in anderem Material. Die bedeutungsvollste ist die der Gläser. Unter ihnen finden
sich Werke, die zum allerbesten gehören, was die altchristliche Kunst uns auf
diesem Gebiete überhaupt hinterlassen hat.
1. Die Schale der ehemaligen Sammlung Herstatt.
An die Spitze aller christlichen Funde Kölns stellt die Forschung eine Glas-
schale, die im Jahre 1866 an der Ursulagartenstraße ausgegraben, in die Sammlung
Herstatt zu Köln und aus dieser schließlich in das Britische Museum zu London
gelangt ist (Tafel IX)'. Die Fundangabe, die Düntzer macht, ist merkwürdig genug:
An einer von Norden nach Süden laufenden Tuffsteinmauer sollen sich nur zwei
bis drei Fuß unter der Erde mehrere Aschenkisten und einige Fuß tiefer eine Reihe
von Särgen mit Skeletten in westöstlicher Lage gefunden haben. In einer der
1 Zuerst kurz erwähnt von H. Düntzer in den Bonner Jahrbüchern 41 (1866) S. 132,
dann von ihm ausführlich beschrieben, ebendort 42 (1867) S. 168—178 mit farbiger Abb.
Taf. V. Die Lit. bis 1901 stellt J.Klinkenberg, Das römische Köln [= Die Kunstdenk-
mäler der Rheinprovinz VI. Bd., I u. II], Düsseldorf 1906, S. 274 zusammen; dort auch S. 272
bis 274 eine neue Besprechung mit Abb. Fig. 110. Ich trage nach die Beschreibungen von
A. Kisa, Das Glas im Altertume, Leipzig 1908, III, 867—880, und H. Leclercq, Manuel
d'archeologie chretienne, Paris 1907, II, 489 f. sowie die gelegentlichen Behandlungen von
A. K i s a , Die antiken Gläser der Frau Maria vom Rath, Bonn 1899, S. 96 f.; J. P o p p e 1 -
reuter, Die römischen Gräber Kölns, Bonner Jahrbücher 114/115 (1906) S. 372 f.;
J. Reil, Die altchnsthchen Bildzyklen des Lebens Jesu, Leipzig 1910, S. 31 u. 33;
C. M. Kaufmann, Handbuch der christlichen Archäologie", Paderborn 1913, S. 322, und
des Verfassers: Das Buch Ezechiel in Theologie und Kunst bis zum Ende des XH.Jahrh.,
Münster 1912, S. 141 f. u. Fig. 1.