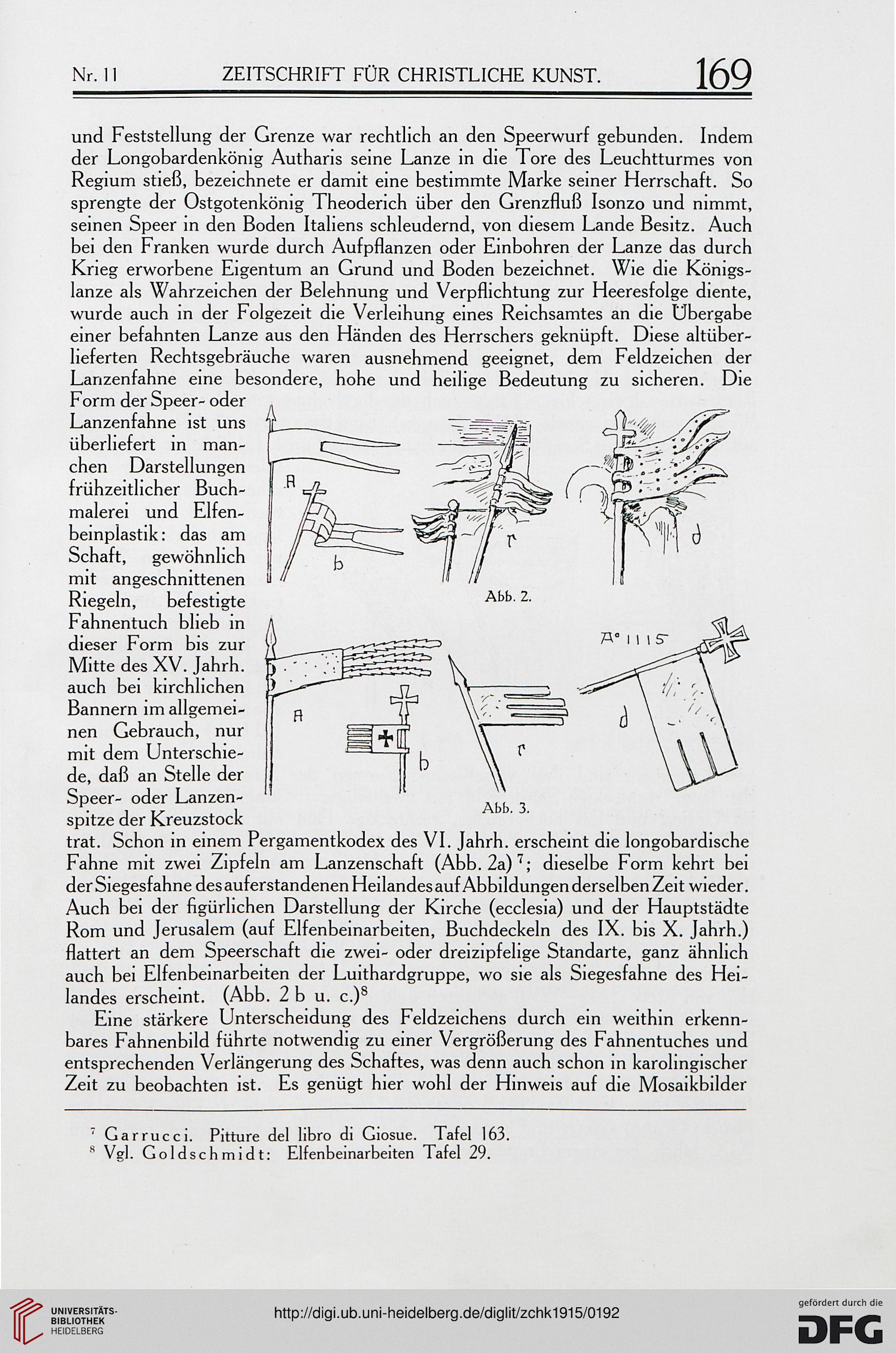Nr
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST.
169
10
Abb. 2.
und Feststellung der Grenze war rechtlich an den Speerwurf gebunden. Indem
der Longobardenkönig Authans seine Lanze in die Tore des Leuchtturmes von
Regium stieß, bezeichnete er damit eine bestimmte Marke seiner Herrschaft. So
sprengte der Ostgotenkönig Theoderich über den Grenzfluß Isonzo und nimmt,
seinen Speer in den Boden Italiens schleudernd, von diesem Lande Besitz. Auch
bei den Franken wurde durch Aufpflanzen oder Einbohren der Lanze das durch
Krieg erworbene Eigentum an Grund und Boden bezeichnet. Wie die Königs-
lanze als Wahrzeichen der Belehnung und Verpflichtung zur Heeresfolge diente,
wurde auch in der Folgezeit die Verleihung eines Reichsamtes an die Übergabe
einer befahnten Lanze aus den Händen des Herrschers geknüpft. Diese altüber-
lieferten Rechtsgebräuche waren ausnehmend geeignet, dem Feldzeichen der
Lanzenfahne eine besondere, hohe und heilige Bedeutung zu sicheren. Di
Form der Speer- oder
Lanzenfahne ist uns
überliefert in man-
chen Darstellungen
frühzeithcher Buch-
malerei und Elfen-
beinplastik: das am
Schaft, gewöhnlich
mit angeschnittenen
Riegeln, befestigte
Fahnentuch blieb in
dieser Form bis zur
Mitte des XV. Jahrh.
auch bei kirchlichen
Bannern im allgemei-
nen Gebrauch, nur
mit dem Unterschie-
de, daß an Stelle der
Speer- oder Lanzen-
spitze der Kreuzstock
trat. Schon in einem Pergamentkodex des VI. Jahrh. erscheint die longobardische
Fahne mit zwei Zipfeln am Lanzenschaft (Abb. 2a)7; dieselbe Form kehrt bei
der Siegesfahne des auferstandenen Heilandes auf Abbildungen derselben Zeit wieder.
Auch bei der figürlichen Darstellung der Kirche (ecclesia) und der Hauptstädte
Rom und Jerusalem (auf Elfenbeinarbeiten, Buchdeckeln des IX. bis X. Jahrh.)
flattert an dem Speerschaft die zwei- oder dreizipfelige Standarte, ganz ähnlich
auch bei Elfenbeinarbeiten der Luithardgruppe, wo sie als Siegesfahne des Hei-
landes erscheint. (Abb. 2 b u. c.)8
Eine stärkere Unterscheidung des Feldzeichens durch ein weithin erkenn-
bares Fahnenbild führte notwendig zu einer Vergrößerung des Fahnentuches und
entsprechenden Verlängerung des Schaftes, was denn auch schon in karolingischer
Zeit zu beobachten ist. Es genügt hier wohl der Hinweis auf die Mosaikbilder
Abb. 3.
7 Garrucci. Pitture del libro di Giosue. Tafel 163.
8 Vgl. Goldschmidt: Elfenbeinarbeiten Tafel 29.
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST.
169
10
Abb. 2.
und Feststellung der Grenze war rechtlich an den Speerwurf gebunden. Indem
der Longobardenkönig Authans seine Lanze in die Tore des Leuchtturmes von
Regium stieß, bezeichnete er damit eine bestimmte Marke seiner Herrschaft. So
sprengte der Ostgotenkönig Theoderich über den Grenzfluß Isonzo und nimmt,
seinen Speer in den Boden Italiens schleudernd, von diesem Lande Besitz. Auch
bei den Franken wurde durch Aufpflanzen oder Einbohren der Lanze das durch
Krieg erworbene Eigentum an Grund und Boden bezeichnet. Wie die Königs-
lanze als Wahrzeichen der Belehnung und Verpflichtung zur Heeresfolge diente,
wurde auch in der Folgezeit die Verleihung eines Reichsamtes an die Übergabe
einer befahnten Lanze aus den Händen des Herrschers geknüpft. Diese altüber-
lieferten Rechtsgebräuche waren ausnehmend geeignet, dem Feldzeichen der
Lanzenfahne eine besondere, hohe und heilige Bedeutung zu sicheren. Di
Form der Speer- oder
Lanzenfahne ist uns
überliefert in man-
chen Darstellungen
frühzeithcher Buch-
malerei und Elfen-
beinplastik: das am
Schaft, gewöhnlich
mit angeschnittenen
Riegeln, befestigte
Fahnentuch blieb in
dieser Form bis zur
Mitte des XV. Jahrh.
auch bei kirchlichen
Bannern im allgemei-
nen Gebrauch, nur
mit dem Unterschie-
de, daß an Stelle der
Speer- oder Lanzen-
spitze der Kreuzstock
trat. Schon in einem Pergamentkodex des VI. Jahrh. erscheint die longobardische
Fahne mit zwei Zipfeln am Lanzenschaft (Abb. 2a)7; dieselbe Form kehrt bei
der Siegesfahne des auferstandenen Heilandes auf Abbildungen derselben Zeit wieder.
Auch bei der figürlichen Darstellung der Kirche (ecclesia) und der Hauptstädte
Rom und Jerusalem (auf Elfenbeinarbeiten, Buchdeckeln des IX. bis X. Jahrh.)
flattert an dem Speerschaft die zwei- oder dreizipfelige Standarte, ganz ähnlich
auch bei Elfenbeinarbeiten der Luithardgruppe, wo sie als Siegesfahne des Hei-
landes erscheint. (Abb. 2 b u. c.)8
Eine stärkere Unterscheidung des Feldzeichens durch ein weithin erkenn-
bares Fahnenbild führte notwendig zu einer Vergrößerung des Fahnentuches und
entsprechenden Verlängerung des Schaftes, was denn auch schon in karolingischer
Zeit zu beobachten ist. Es genügt hier wohl der Hinweis auf die Mosaikbilder
Abb. 3.
7 Garrucci. Pitture del libro di Giosue. Tafel 163.
8 Vgl. Goldschmidt: Elfenbeinarbeiten Tafel 29.