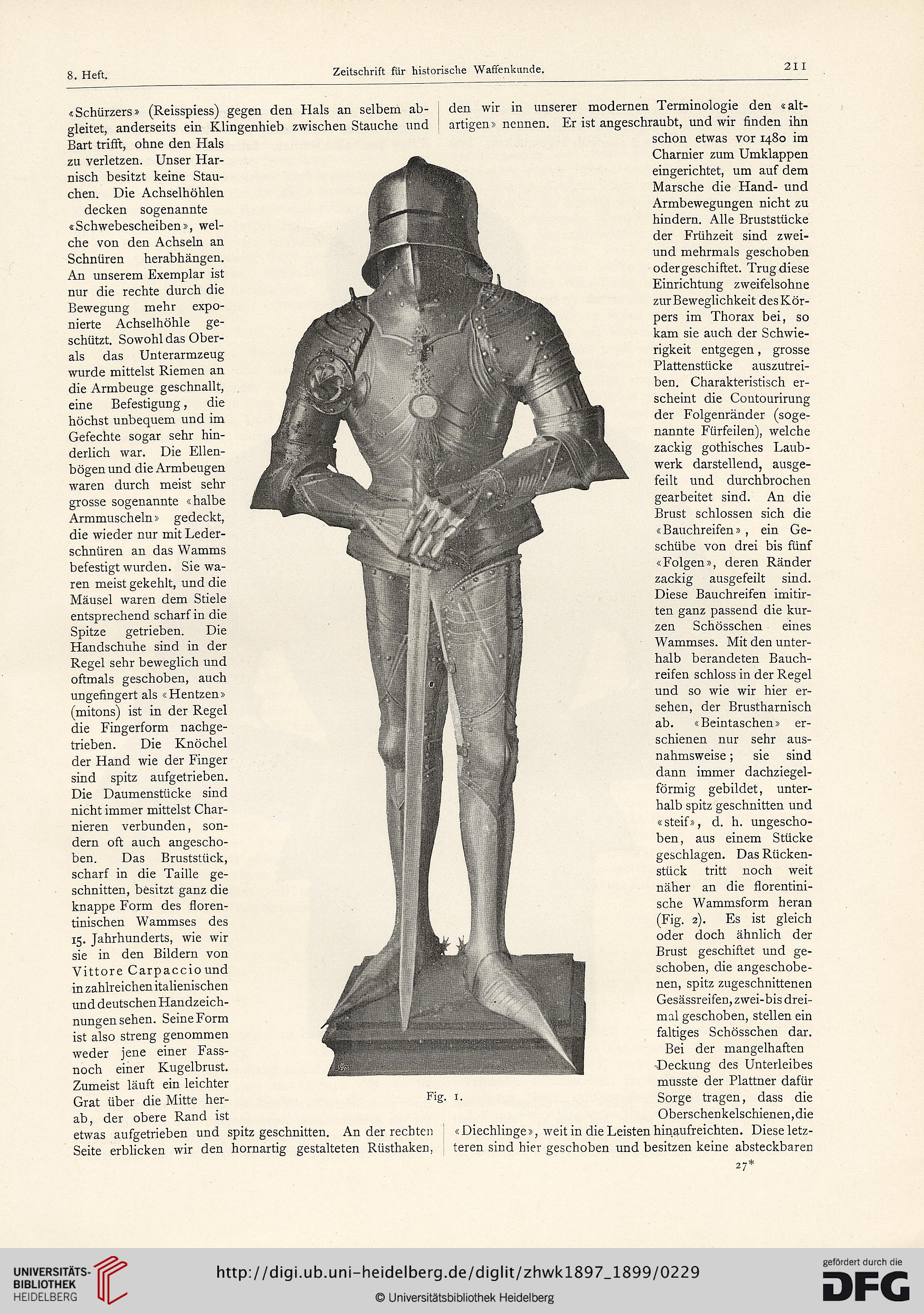8. Heft.
Zeitschrift für historische Waffenkunde.
211
«Schürzers» (Reisspiess) gegen den Hals an selbem ab-
gleitet, anderseits ein Klingenhieb zwischen Stauche und
Bart trifft, ohne den Hals
zu verletzen. Unser Har-
nisch besitzt keine Stau-
chen. Die Achselhöhlen
decken sogenannte
«Schwebescheiben», wel-
che von den Achseln an
Schnüren herabhängen.
An unserem Exemplar ist
nur die rechte durch die
Bewegung mehr expo-
nierte Achselhöhle ge-
schützt. Sowohl das Ober-
ais das Unterarmzeug
wurde mittelst Riemen an
die Armbeuge geschnallt,
eine Befestigung, die
höchst unbequem und im
Gefechte sogar sehr hin-
derlich war. Die Ellen-
bogen und die Armbeugen
waren durch meist sehr
grosse sogenannte «halbe
Armmuscheln» gedeckt,
die wieder nur mit Leder-
schnüren an das Wamms
befestigt wurden. Sie wa-
ren meist gekehlt, und die
Mäusel waren dem Stiele
entsprechend scharf in die
Spitze getrieben. Die
Handschuhe sind in der
Regel sehr beweglich und
oftmals geschoben, auch
ungefingert als «Hentzen»
(mitons) ist in der Regel
die Fingerform nachge-
trieben. Die Knöchel
der Hand wie der Finger
sind spitz aufgetrieben.
Die Daumenstücke sind
nicht immer mittelst Char-
teren verbunden, son-
dern oft auch angescho-
ben. Das Bruststück,
scharf in die Taille ge-
schnitten, besitzt ganz die
knappe Form des floren-
tinischen Wammses des
15. Jahrhunderts, wie wir
sie in den Bildern von
Vittore Carpacciound
in zahlreichen italienischen
und deutschen Handzeich-
nungen sehen. Seine Form
ist also streng genommen
weder jene einer Fass-
noch einer Kugelbrust.
Zumeist läuft ein leichter
Grat über die Mitte her- Dg-
ab, der obere Rand ist
etwas aufgetrieben und spitz geschnitten. An der rechten !
Seite erblicken wir den hornartig gestalteten Rüsthaken,
den wir in unserer modernen Terminologie den «alt-
artigen» nennen. Er ist angeschraubt, und wir finden ihn
schon etwas vor 1480 im
Charnier zum Umklappen
eingerichtet, um auf dem
Marsche die Hand- und
Armbewegungen nicht zu
hindern. Alle Bruststücke
der Frühzeit sind zwei-
und mehrmals geschoben
oder geschiftet. Trug diese
Einrichtung zweifelsohne
zur Beweglichkeit desKör-
pers im Thorax bei, so
kam sie auch der Schwie-
rigkeit entgegen, grosse
Plattenstücke auszutrei-
ben. Charakteristisch er-
scheint die Contourirung
der Folgenränder (soge-
nannte Fürfeilen), welche
zackig gothisches Laub-
werk darstellend, ausge-
feilt und durchbrochen
gearbeitet sind. An die
Brust schlossen sich die
«Bauchreifen», ein Ge-
schübe von drei bis fünf
«Folgen», deren Ränder
zackig ausgefeilt sind.
Diese Bauchreifen imitir-
ten ganz passend die kur-
zen Schösschen eines
Wammses. Mit den unter-
halb berandeten Bauch-
reifen schloss in der Regel
und so wie wir hier er-
sehen, der Brustharnisch
ab. «Beintaschen» er-
schienen nur sehr aus-
nahmsweise ; sie sind
dann immer dachziegel-
förmig gebildet, unter-
halb spitz geschnitten und
«steif», d. h. ungescho-
ben, aus einem Stücke
geschlagen. Das Rücken-
stück tritt noch weit
näher an die florentini-
sche Wammsform heran
(Fig. 2). Es ist gleich
oder doch ähnlich der
Brust geschiftet und ge-
schoben, die angeschobe-
nen, spitz zugeschnittenen
Gesässreifen, zwei-bis drei-
mal geschoben, stellen ein
faltiges Schösschen dar.
Bei der mangelhaften
■Deckung des Unterleibes
musste der Plattner dafür
l- Sorge tragen, dass die
Oberschenkelschienen,die
«Diechlinge», weit in die Leisten hinaufreichten. Diese letz-
teren sind hier geschoben und besitzen keine absteckbaren
27*
Zeitschrift für historische Waffenkunde.
211
«Schürzers» (Reisspiess) gegen den Hals an selbem ab-
gleitet, anderseits ein Klingenhieb zwischen Stauche und
Bart trifft, ohne den Hals
zu verletzen. Unser Har-
nisch besitzt keine Stau-
chen. Die Achselhöhlen
decken sogenannte
«Schwebescheiben», wel-
che von den Achseln an
Schnüren herabhängen.
An unserem Exemplar ist
nur die rechte durch die
Bewegung mehr expo-
nierte Achselhöhle ge-
schützt. Sowohl das Ober-
ais das Unterarmzeug
wurde mittelst Riemen an
die Armbeuge geschnallt,
eine Befestigung, die
höchst unbequem und im
Gefechte sogar sehr hin-
derlich war. Die Ellen-
bogen und die Armbeugen
waren durch meist sehr
grosse sogenannte «halbe
Armmuscheln» gedeckt,
die wieder nur mit Leder-
schnüren an das Wamms
befestigt wurden. Sie wa-
ren meist gekehlt, und die
Mäusel waren dem Stiele
entsprechend scharf in die
Spitze getrieben. Die
Handschuhe sind in der
Regel sehr beweglich und
oftmals geschoben, auch
ungefingert als «Hentzen»
(mitons) ist in der Regel
die Fingerform nachge-
trieben. Die Knöchel
der Hand wie der Finger
sind spitz aufgetrieben.
Die Daumenstücke sind
nicht immer mittelst Char-
teren verbunden, son-
dern oft auch angescho-
ben. Das Bruststück,
scharf in die Taille ge-
schnitten, besitzt ganz die
knappe Form des floren-
tinischen Wammses des
15. Jahrhunderts, wie wir
sie in den Bildern von
Vittore Carpacciound
in zahlreichen italienischen
und deutschen Handzeich-
nungen sehen. Seine Form
ist also streng genommen
weder jene einer Fass-
noch einer Kugelbrust.
Zumeist läuft ein leichter
Grat über die Mitte her- Dg-
ab, der obere Rand ist
etwas aufgetrieben und spitz geschnitten. An der rechten !
Seite erblicken wir den hornartig gestalteten Rüsthaken,
den wir in unserer modernen Terminologie den «alt-
artigen» nennen. Er ist angeschraubt, und wir finden ihn
schon etwas vor 1480 im
Charnier zum Umklappen
eingerichtet, um auf dem
Marsche die Hand- und
Armbewegungen nicht zu
hindern. Alle Bruststücke
der Frühzeit sind zwei-
und mehrmals geschoben
oder geschiftet. Trug diese
Einrichtung zweifelsohne
zur Beweglichkeit desKör-
pers im Thorax bei, so
kam sie auch der Schwie-
rigkeit entgegen, grosse
Plattenstücke auszutrei-
ben. Charakteristisch er-
scheint die Contourirung
der Folgenränder (soge-
nannte Fürfeilen), welche
zackig gothisches Laub-
werk darstellend, ausge-
feilt und durchbrochen
gearbeitet sind. An die
Brust schlossen sich die
«Bauchreifen», ein Ge-
schübe von drei bis fünf
«Folgen», deren Ränder
zackig ausgefeilt sind.
Diese Bauchreifen imitir-
ten ganz passend die kur-
zen Schösschen eines
Wammses. Mit den unter-
halb berandeten Bauch-
reifen schloss in der Regel
und so wie wir hier er-
sehen, der Brustharnisch
ab. «Beintaschen» er-
schienen nur sehr aus-
nahmsweise ; sie sind
dann immer dachziegel-
förmig gebildet, unter-
halb spitz geschnitten und
«steif», d. h. ungescho-
ben, aus einem Stücke
geschlagen. Das Rücken-
stück tritt noch weit
näher an die florentini-
sche Wammsform heran
(Fig. 2). Es ist gleich
oder doch ähnlich der
Brust geschiftet und ge-
schoben, die angeschobe-
nen, spitz zugeschnittenen
Gesässreifen, zwei-bis drei-
mal geschoben, stellen ein
faltiges Schösschen dar.
Bei der mangelhaften
■Deckung des Unterleibes
musste der Plattner dafür
l- Sorge tragen, dass die
Oberschenkelschienen,die
«Diechlinge», weit in die Leisten hinaufreichten. Diese letz-
teren sind hier geschoben und besitzen keine absteckbaren
27*