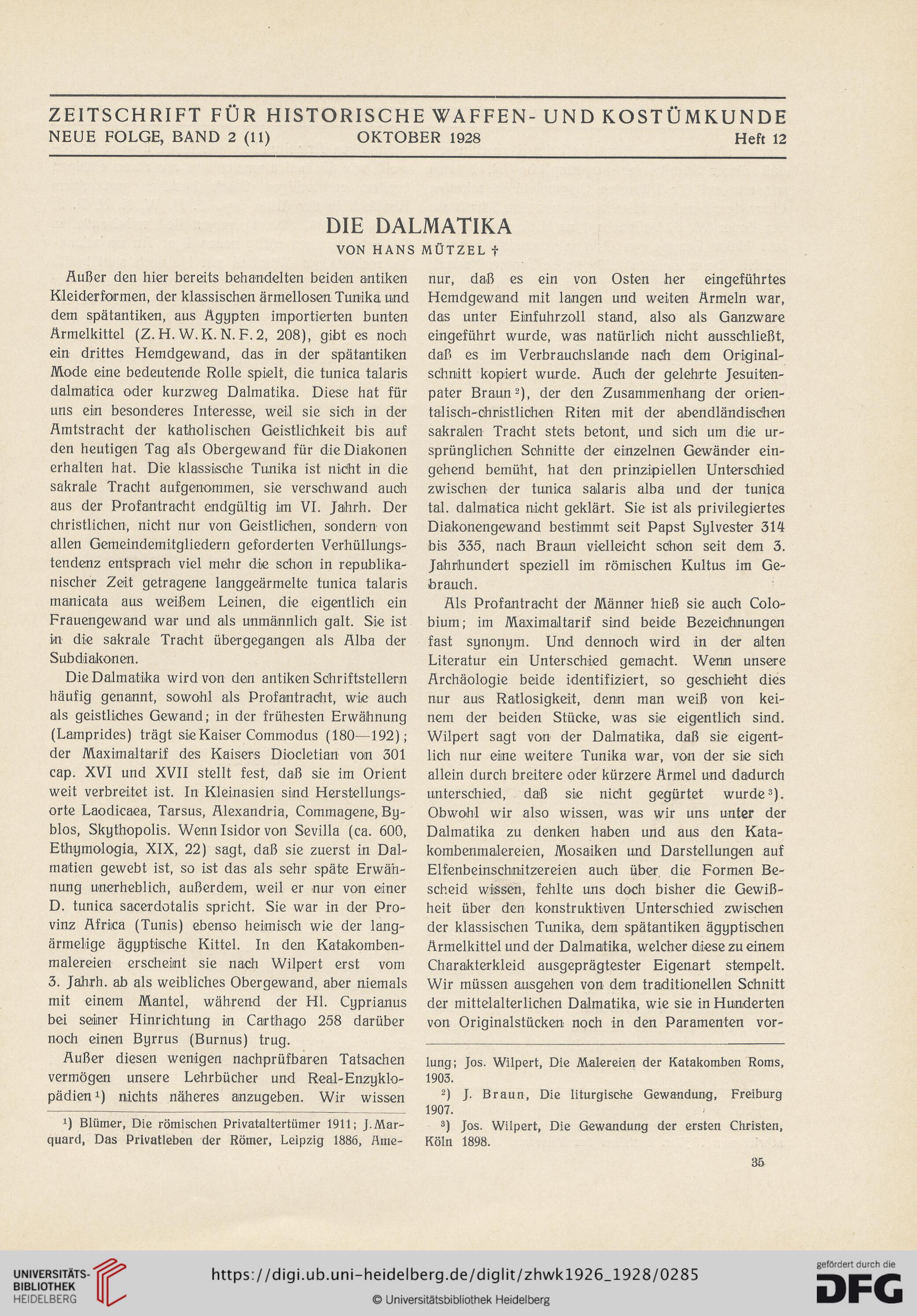ZEITSCHRIFT FÜR HISTORISCHE WAFFEN-UND KOSTÜMKUNDE
NEUE FOLGE, BAND 2 (11) OKTOBER 1928 Heft 12
DIE DALMATIKA
VON HANS MÜTZEL t
Außer den hier bereits behandelten beiden antiken
Kleiderformen, der klassischen ärmellosen Tunika und
dem spätantiken, aus Ägypten importierten bunten
Ärmelkittel (Z. H. W. K. N. F. 2, 208), gibt es noch
ein drittes Hemdgewand, das in der spätantiken
Mode eine bedeutende Rolle spielt, die tunica talaris
dalmatica oder kurzweg Dalmatika. Diese hat für
uns ein besonderes Interesse, weil sie sich in der
Amtstracht der katholischen Geistlichkeit bis auf
den heutigen Tag als Obergewand für die Diakonen
erhalten hat. Die klassische Tunika ist nicht in die
sakrale Tracht aufgenommen, sie verschwand auch
aus der Profantracht endgültig im VI. Jahrh. Der
christlichen, nicht nur von Geistlichen, sondern von
allen Gemeindemitgliedern geforderten Verhüllungs-
tendenz entsprach viel mehr die schon in republika-
nischer Zeit getragene langgeärmelte tunica talaris
manicata aus weißem Leinen, die eigentlich ein
Frauengewand war und als unmännlich galt. Sie ist
in die sakrale Tracht übergegangen als Alba der
Subdiakonen.
Die Dalmatika wird von den antiken Schriftstellern
häufig genannt, sowohl als Profantradht, wie auch
als geistliches Gewand; in der frühesten Erwähnung
(Lamprides) trägt sie Kaiser Commodus (180—192);
der Maximaltarif des Kaisers Diocletian von 301
cap. XVI und XVII stellt fest, daß sie im Orient
weit verbreitet ist. In Kleinasien sind Herstellungs-
orte Laodicaea, Tarsus, Alexandria, Commagene, By-
blos, Skythopolis. Wenn Isidor von Sevilla (ca. 600,
Ethymologia, XIX, 22) sagt, daß sie zuerst in Dal-
matien gewebt ist, so ist das als sehr späte Erwäh-
nung unerheblich, außerdem, weil er nur von einer
D. tunica sacerdotalis spricht. Sie war in der Pro-
vinz Africa (Tunis) ebenso heimisch wie der lang-
ärmelige ägyptische Kittel. In den Katakomben-
malereien erscheint sie nach Wilpert erst vom
3. Jahrh. ab als weibliches Obergewand, aber niemals
mit einem Mantel, während der Hl. Cgprianus
bei seiner Hinrichtung in Carthago 258 darüber
noch einen Byrrus (Burnus) trug.
Außer diesen wenigen nachprüfbaren Tatsachen
vermögen unsere Lehrbücher und Real-Enzyklo-
pädien1) nichts näheres anzugeben. Wir wissen
') Blütner, Die römischen Privataltertümer 1911; J.Mar-
quard, Das Privatleben der Römer, Leipzig 1886, Ame-
nur, daß es ein von Osten her eingeführtes
Hemdgewand mit langen und weiten Ärmeln war,
das unter Einfuhrzoll stand, also als Ganzware
eingeführt wurde, was natürlich nicht ausschließt,
daß es im Verbrauchslande nach dem Original-
schnitt kopiert wurde. Auch der gelehrte Jesuiten-
pater Braun2), der den Zusammenhang der orien-
talisch-christlichen Riten mit der abendländischen
sakralen Tracht stets betont, und sich um die ur-
sprünglichen Schnitte der einzelnen Gewänder ein-
gehend bemüht, hat den prinzipiellen Unterschied
zwischen der tunica salaris alba und der tunica
tat. dalmatica nicht geklärt. Sie ist als privilegiertes
Diakonengewand bestimmt seit Papst Sylvester 314
bis 335, nach Braun vielleicht schon seit dem 3.
Jahrhundert speziell im römischen Kultus im Ge-
brauch.
Als Profantracht der Männer hieß sie auch Colo-
bium; im Maximaltarif sind beide Bezeichnungen
fast synonym. Und dennoch wird in der alten
Literatur ein Unterschied gemacht. Wenn unsere
Archäologie beide identifiziert, so geschieht dies
nur aus Ratlosigkeit, denn man weiß von kei-
nem der beiden Stücke, was sie eigentlich sind.
Wilpert sagt von der Dalmatika, daß sie eigent-
lich nur eine weitere Tunika war, von der sie sich
allein durch breitere oder kürzere Ärmel und dadurch
unterschied, daß sie nicht gegürtet wurde3).
Obwohl wir also wissen, was wir uns unter der
Dalmatika zu denken haben und aus den Kata-
kombenmalereien, Mosaiken und Darstellungen auf
Elfenbeinschnitzereien auch über die Formen Be-
scheid wissen, fehlte uns doch bisher die Gewiß-
heit über den konstruktiven Unterschied zwischen
der klassischen Tunika, dem spätantiken ägyptischen
Ärmelkittel und der Dalmatika, welcher diese zu einem
Charakterkleid ausgeprägtester Eigenart stempelt.
Wir müssen ausgehen von dem traditionellen Schnitt
der mittelalterlichen Dalmatika, wie sie in Hunderten
von Originalstücken noch in den Paramenten vor-
lung; Jos. Wilpert, Die Malereien der Katakomben Roms,
1903.
2) J. Braun, Die liturgische Gewandung, Freiburg
1907.
3) Jos. Wilpert, Die Gewandung der ersten Christen,
Köln 1898.
35
NEUE FOLGE, BAND 2 (11) OKTOBER 1928 Heft 12
DIE DALMATIKA
VON HANS MÜTZEL t
Außer den hier bereits behandelten beiden antiken
Kleiderformen, der klassischen ärmellosen Tunika und
dem spätantiken, aus Ägypten importierten bunten
Ärmelkittel (Z. H. W. K. N. F. 2, 208), gibt es noch
ein drittes Hemdgewand, das in der spätantiken
Mode eine bedeutende Rolle spielt, die tunica talaris
dalmatica oder kurzweg Dalmatika. Diese hat für
uns ein besonderes Interesse, weil sie sich in der
Amtstracht der katholischen Geistlichkeit bis auf
den heutigen Tag als Obergewand für die Diakonen
erhalten hat. Die klassische Tunika ist nicht in die
sakrale Tracht aufgenommen, sie verschwand auch
aus der Profantracht endgültig im VI. Jahrh. Der
christlichen, nicht nur von Geistlichen, sondern von
allen Gemeindemitgliedern geforderten Verhüllungs-
tendenz entsprach viel mehr die schon in republika-
nischer Zeit getragene langgeärmelte tunica talaris
manicata aus weißem Leinen, die eigentlich ein
Frauengewand war und als unmännlich galt. Sie ist
in die sakrale Tracht übergegangen als Alba der
Subdiakonen.
Die Dalmatika wird von den antiken Schriftstellern
häufig genannt, sowohl als Profantradht, wie auch
als geistliches Gewand; in der frühesten Erwähnung
(Lamprides) trägt sie Kaiser Commodus (180—192);
der Maximaltarif des Kaisers Diocletian von 301
cap. XVI und XVII stellt fest, daß sie im Orient
weit verbreitet ist. In Kleinasien sind Herstellungs-
orte Laodicaea, Tarsus, Alexandria, Commagene, By-
blos, Skythopolis. Wenn Isidor von Sevilla (ca. 600,
Ethymologia, XIX, 22) sagt, daß sie zuerst in Dal-
matien gewebt ist, so ist das als sehr späte Erwäh-
nung unerheblich, außerdem, weil er nur von einer
D. tunica sacerdotalis spricht. Sie war in der Pro-
vinz Africa (Tunis) ebenso heimisch wie der lang-
ärmelige ägyptische Kittel. In den Katakomben-
malereien erscheint sie nach Wilpert erst vom
3. Jahrh. ab als weibliches Obergewand, aber niemals
mit einem Mantel, während der Hl. Cgprianus
bei seiner Hinrichtung in Carthago 258 darüber
noch einen Byrrus (Burnus) trug.
Außer diesen wenigen nachprüfbaren Tatsachen
vermögen unsere Lehrbücher und Real-Enzyklo-
pädien1) nichts näheres anzugeben. Wir wissen
') Blütner, Die römischen Privataltertümer 1911; J.Mar-
quard, Das Privatleben der Römer, Leipzig 1886, Ame-
nur, daß es ein von Osten her eingeführtes
Hemdgewand mit langen und weiten Ärmeln war,
das unter Einfuhrzoll stand, also als Ganzware
eingeführt wurde, was natürlich nicht ausschließt,
daß es im Verbrauchslande nach dem Original-
schnitt kopiert wurde. Auch der gelehrte Jesuiten-
pater Braun2), der den Zusammenhang der orien-
talisch-christlichen Riten mit der abendländischen
sakralen Tracht stets betont, und sich um die ur-
sprünglichen Schnitte der einzelnen Gewänder ein-
gehend bemüht, hat den prinzipiellen Unterschied
zwischen der tunica salaris alba und der tunica
tat. dalmatica nicht geklärt. Sie ist als privilegiertes
Diakonengewand bestimmt seit Papst Sylvester 314
bis 335, nach Braun vielleicht schon seit dem 3.
Jahrhundert speziell im römischen Kultus im Ge-
brauch.
Als Profantracht der Männer hieß sie auch Colo-
bium; im Maximaltarif sind beide Bezeichnungen
fast synonym. Und dennoch wird in der alten
Literatur ein Unterschied gemacht. Wenn unsere
Archäologie beide identifiziert, so geschieht dies
nur aus Ratlosigkeit, denn man weiß von kei-
nem der beiden Stücke, was sie eigentlich sind.
Wilpert sagt von der Dalmatika, daß sie eigent-
lich nur eine weitere Tunika war, von der sie sich
allein durch breitere oder kürzere Ärmel und dadurch
unterschied, daß sie nicht gegürtet wurde3).
Obwohl wir also wissen, was wir uns unter der
Dalmatika zu denken haben und aus den Kata-
kombenmalereien, Mosaiken und Darstellungen auf
Elfenbeinschnitzereien auch über die Formen Be-
scheid wissen, fehlte uns doch bisher die Gewiß-
heit über den konstruktiven Unterschied zwischen
der klassischen Tunika, dem spätantiken ägyptischen
Ärmelkittel und der Dalmatika, welcher diese zu einem
Charakterkleid ausgeprägtester Eigenart stempelt.
Wir müssen ausgehen von dem traditionellen Schnitt
der mittelalterlichen Dalmatika, wie sie in Hunderten
von Originalstücken noch in den Paramenten vor-
lung; Jos. Wilpert, Die Malereien der Katakomben Roms,
1903.
2) J. Braun, Die liturgische Gewandung, Freiburg
1907.
3) Jos. Wilpert, Die Gewandung der ersten Christen,
Köln 1898.
35