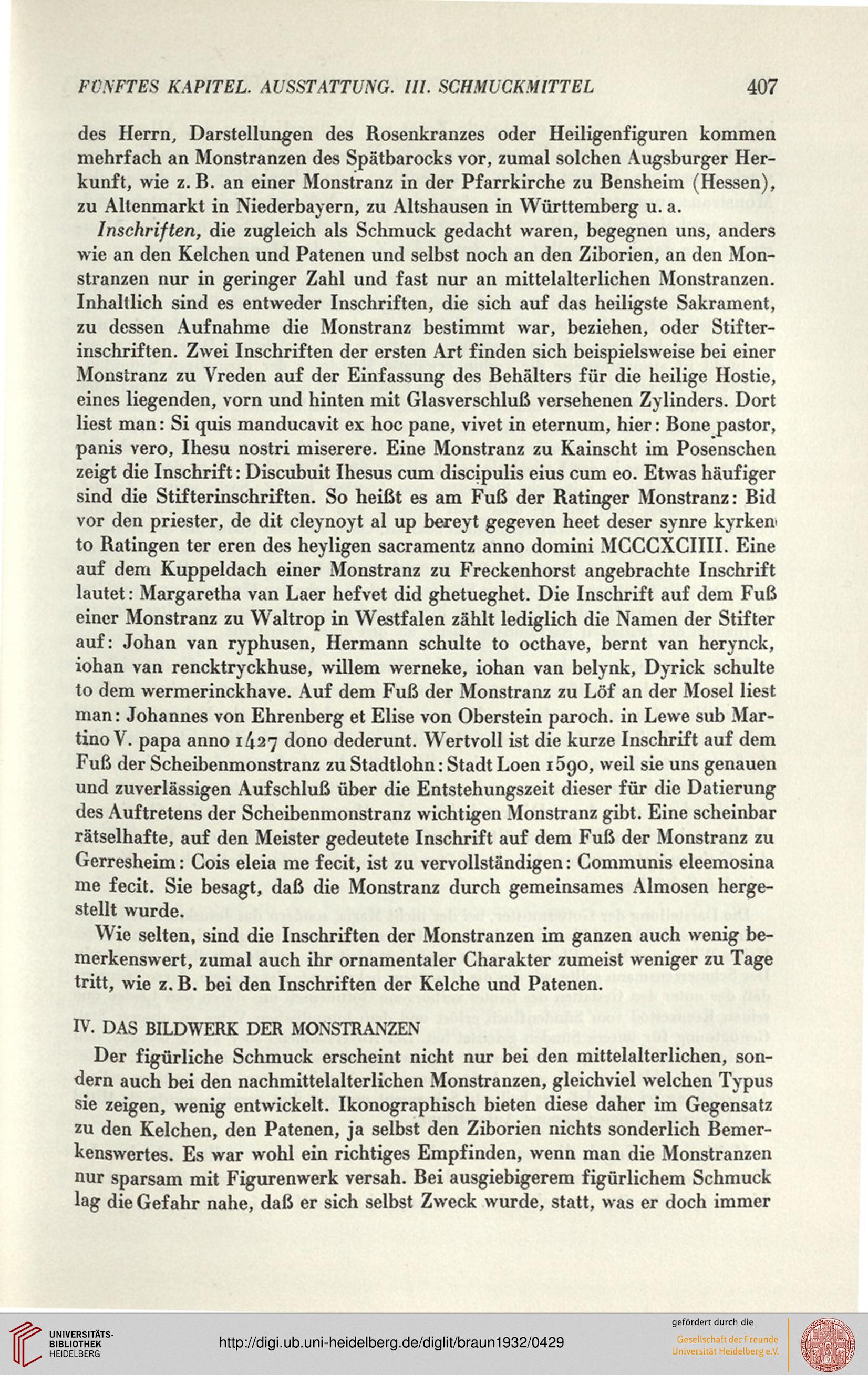FÜNFTES KAPITEL. AUSSTATTUNG. III. SCHMUCKMITTEL 407
des Herrn, Darstellungen des Rosenkranzes oder Heiligenfiguren kommen
mehrfach an Monstranzen des Spätbarocks vor, zumal solchen Augsburger Her-
kunft, wie z. B. an einer Monstranz in der Pfarrkirche zu Bensheim (Hessen),
zu Altenmarkt in Niederbayern, zu Altshausen in Württemberg u. a.
Inschriften, die zugleich als Schmuck gedacht waren, begegnen uns, anders
wie an den Kelchen und Patenen und selbst noch an den Ziborien, an den Mon-
stranzen nur in geringer Zahl und fast nur an mittelalterlichen Monstranzen.
Inhaltlich sind es entweder Inschriften, die sich auf das heiligste Sakrament,
zu dessen Aufnahme die Monstranz bestimmt war, beziehen, oder Stifter-
inschriften. Zwei Inschriften der ersten Art finden sich beispielsweise bei einer
Monstranz zu Vreden auf der Einfassung des Behälters für die heilige Hostie,
eines liegenden, vorn und hinten mit Glasverschluß versehenen Zylinders. Dort
liest man: Si quis manducavit ex hoc pane, vivet in eternum, hier: Bone pastor,
panis vero, Ihesu nostri miserere. Eine Monstranz zu Kainscht im Posenschen
zeigt die Inschrift: Discubuit Ihesus cum discipulis eius cum eo. Etwas häufiger
sind die Stifterinschriften. So heißt es am Fuß der Ratinger Monstranz: Bid
vor den priester, de dit cleynoyt al up bereyt gegeven heet deser synre kyrkeni
to Ratingen ter eren des heyligen sacramentz anno domini MCCCXCIIII. Eine
auf dem Kuppeldach einer Monstranz zu Freckenhorst angebrachte Inschrift
lautet: Margaretha van Laer hefvet did ghetueghet. Die Inschrift auf dem Fuß
einer Monstranz zu Waltrop in Westfalen zählt lediglich die Namen der Stifter
auf: Johan van ryphusen, Hermann schulte to octhave, bernt van herynck,
iohan van rencktryckhuse, willem werneke, iohan van belynk, Dyrick schulte
to dem wermerinckhave. Auf dem Fuß der Monstranz zu Löf an der Mosel liest
man: Johannes von Ehrenberg et Elise von Oberstein paroch. in Lewe sub Mar-
tino V. papa anno 1627 dono dederunt. Wrertvoll ist die kurze Inschrift auf dem
Fuß der Scheibenmonstranz zu Stadtlohn: Stadt Loen 15go, weil sie uns genauen
und zuverlässigen Aufschluß über die Entstehungszeit dieser für die Datierung
des Auftretens der Scheibenmonstranz wichtigen Monstranz gibt. Eine scheinbar
rätselhafte, auf den Meister gedeutete Inschrift auf dem Fuß der Monstranz zu
Gerresheim: Cois eleia me fecit, ist zu vervollständigen: Communis eleemosina
me fecit. Sie besagt, daß die Monstranz durch gemeinsames Almosen herge-
stellt wurde.
Wie selten, sind die Inschriften der Monstranzen im ganzen auch wenig be-
merkenswert, zumal auch ihr ornamentaler Charakter zumeist weniger zu Tage
tritt, wie z.B. bei den Inschriften der Kelche und Pateuen.
IV. DAS BILDWERK DER MONSTRANZEN
Der figürliche Schmuck erscheint nicht nur bei den mittelalterlichen, son-
dern auch bei den nachmittelalterlichen Monstranzen, gleichviel welchen Typus
sie zeigen, wenig entwickelt. Ikonographisch bieten diese daher im Gegensatz
zu den Kelchen, den Patenen, ja selbst den Ziborien nichts sonderlich Bemer-
kenswertes. Es war wohl ein richtiges Empfinden, wenn man die Monstranzen
nur sparsam mit Figurenwerk versah. Bei ausgiebigerem figürlichem Schmuck
lag die Gefahr nahe, daß er sich selbst Zweck wurde, statt, was er doch immer
des Herrn, Darstellungen des Rosenkranzes oder Heiligenfiguren kommen
mehrfach an Monstranzen des Spätbarocks vor, zumal solchen Augsburger Her-
kunft, wie z. B. an einer Monstranz in der Pfarrkirche zu Bensheim (Hessen),
zu Altenmarkt in Niederbayern, zu Altshausen in Württemberg u. a.
Inschriften, die zugleich als Schmuck gedacht waren, begegnen uns, anders
wie an den Kelchen und Patenen und selbst noch an den Ziborien, an den Mon-
stranzen nur in geringer Zahl und fast nur an mittelalterlichen Monstranzen.
Inhaltlich sind es entweder Inschriften, die sich auf das heiligste Sakrament,
zu dessen Aufnahme die Monstranz bestimmt war, beziehen, oder Stifter-
inschriften. Zwei Inschriften der ersten Art finden sich beispielsweise bei einer
Monstranz zu Vreden auf der Einfassung des Behälters für die heilige Hostie,
eines liegenden, vorn und hinten mit Glasverschluß versehenen Zylinders. Dort
liest man: Si quis manducavit ex hoc pane, vivet in eternum, hier: Bone pastor,
panis vero, Ihesu nostri miserere. Eine Monstranz zu Kainscht im Posenschen
zeigt die Inschrift: Discubuit Ihesus cum discipulis eius cum eo. Etwas häufiger
sind die Stifterinschriften. So heißt es am Fuß der Ratinger Monstranz: Bid
vor den priester, de dit cleynoyt al up bereyt gegeven heet deser synre kyrkeni
to Ratingen ter eren des heyligen sacramentz anno domini MCCCXCIIII. Eine
auf dem Kuppeldach einer Monstranz zu Freckenhorst angebrachte Inschrift
lautet: Margaretha van Laer hefvet did ghetueghet. Die Inschrift auf dem Fuß
einer Monstranz zu Waltrop in Westfalen zählt lediglich die Namen der Stifter
auf: Johan van ryphusen, Hermann schulte to octhave, bernt van herynck,
iohan van rencktryckhuse, willem werneke, iohan van belynk, Dyrick schulte
to dem wermerinckhave. Auf dem Fuß der Monstranz zu Löf an der Mosel liest
man: Johannes von Ehrenberg et Elise von Oberstein paroch. in Lewe sub Mar-
tino V. papa anno 1627 dono dederunt. Wrertvoll ist die kurze Inschrift auf dem
Fuß der Scheibenmonstranz zu Stadtlohn: Stadt Loen 15go, weil sie uns genauen
und zuverlässigen Aufschluß über die Entstehungszeit dieser für die Datierung
des Auftretens der Scheibenmonstranz wichtigen Monstranz gibt. Eine scheinbar
rätselhafte, auf den Meister gedeutete Inschrift auf dem Fuß der Monstranz zu
Gerresheim: Cois eleia me fecit, ist zu vervollständigen: Communis eleemosina
me fecit. Sie besagt, daß die Monstranz durch gemeinsames Almosen herge-
stellt wurde.
Wie selten, sind die Inschriften der Monstranzen im ganzen auch wenig be-
merkenswert, zumal auch ihr ornamentaler Charakter zumeist weniger zu Tage
tritt, wie z.B. bei den Inschriften der Kelche und Pateuen.
IV. DAS BILDWERK DER MONSTRANZEN
Der figürliche Schmuck erscheint nicht nur bei den mittelalterlichen, son-
dern auch bei den nachmittelalterlichen Monstranzen, gleichviel welchen Typus
sie zeigen, wenig entwickelt. Ikonographisch bieten diese daher im Gegensatz
zu den Kelchen, den Patenen, ja selbst den Ziborien nichts sonderlich Bemer-
kenswertes. Es war wohl ein richtiges Empfinden, wenn man die Monstranzen
nur sparsam mit Figurenwerk versah. Bei ausgiebigerem figürlichem Schmuck
lag die Gefahr nahe, daß er sich selbst Zweck wurde, statt, was er doch immer