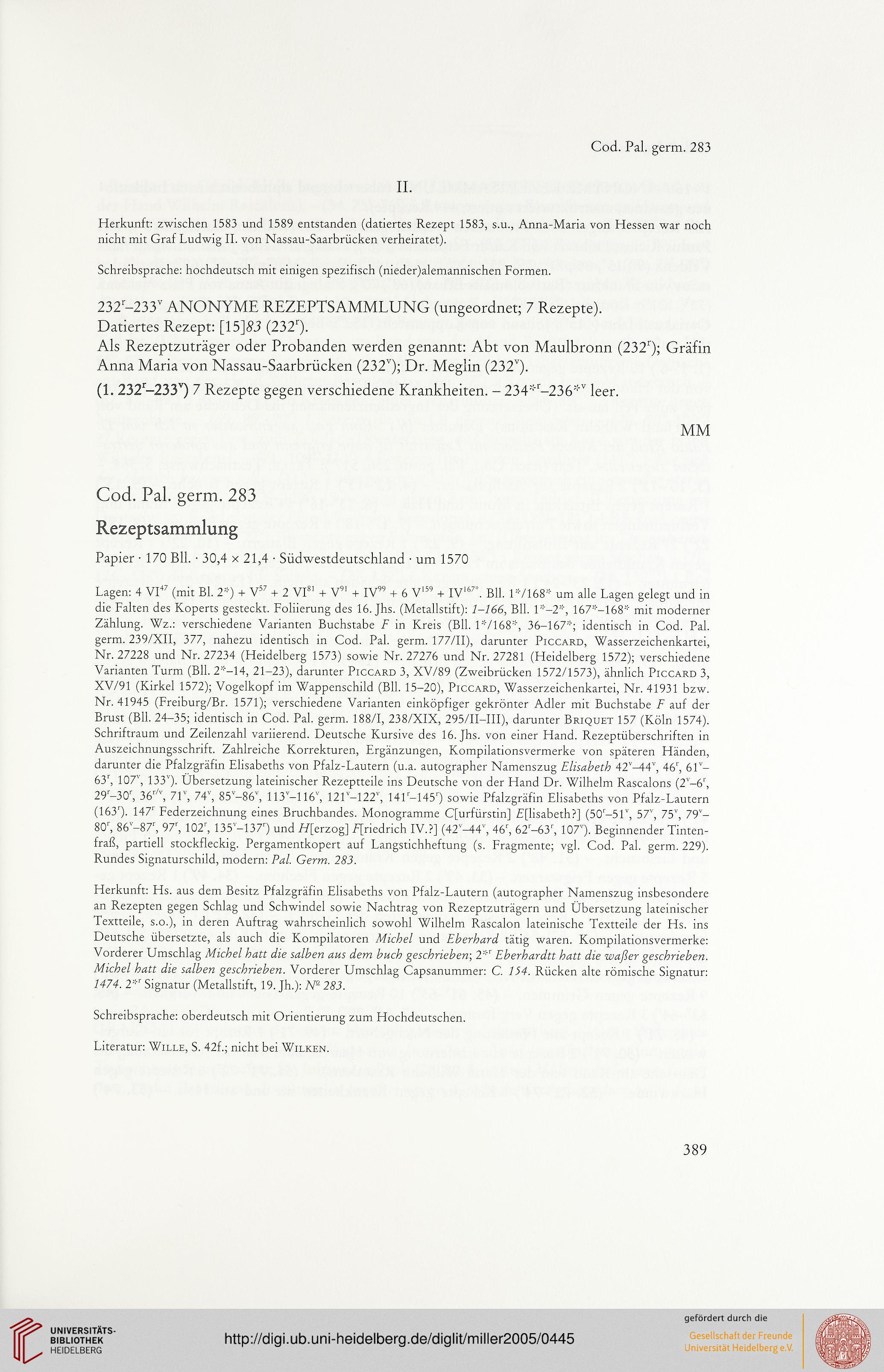Cod. Pal. germ. 283
II.
Herkunft: zwischen 1583 und 1589 entstanden (datiertes Rezept 1583, s.u., Anna-Maria von Hessen war noch
nicht mit Graf Ludwig II. von Nassau-Saarbrücken verheiratet).
Schreibsprache: hochdeutsch mit einigen spezifisch (nieder)alemannischen Formen.
232r-233v ANONYME REZEPTSAMMLUNG (ungeordnet; 7 Rezepte).
Datiertes Rezept: [15]83 (232r).
Als Rezeptzuträger oder Probanden werden genannt: Abt von Maulbronn (232r); Gräfin
Anna Maria von Nassau-Saarbrücken (232'); Dr. Meglin (232v).
(1. 232r-233v) 7 Rezepte gegen verschiedene Krankheiten. - 234::'r-236:,'v leer.
MM
Cod. Pal. germ. 283
Rezeptsammlung
Papier • 170 Bll. • 30,4 x 21,4 • Südwestdeutschland • um 1570
Lagen: 4 VI47 (mit Bl. 2*) + V57 + 2 VI81 + V91 + IV99 + 6 V159 + IV167*. Bll. 1*/168* um alle Lagen gelegt und in
die Falten des Koperts gesteckt. Foliierung des 16. Jhs. (Metallstift): 1-166, Bll. l*-2*, 167;:'-168“' mit moderner
Zählung. Wz.: verschiedene Varianten Buchstabe F in Kreis (Bll. 1*/168*, 36-167*; identisch in Cod. Pal.
germ. 239/XII, 377, nahezu identisch in Cod. Pal. germ. 177/11), darunter Piccard, Wasserzeichenkartei,
Nr. 27228 und Nr. 27234 (Heidelberg 1573) sowie Nr. 27276 und Nr. 27281 (Heidelberg 1572); verschiedene
Varianten Turm (Bll. 2*-14, 21-23), darunter Piccard 3, XV/89 (Zweibrücken 1572/1573), ähnlich Piccard 3,
XV/91 (Kirkel 1572); Vogelkopf im Wappenschild (Bll. 15-20), Piccard, Wasserzeichenkartei, Nr. 41931 bzw.
Nr. 41945 (Freiburg/Br. 1571); verschiedene Varianten einköpfiger gekrönter Adler mit Buchstabe F auf der
Brust (Bll. 24-35; identisch in Cod. Pal. germ. 188/1, 238/XIX, 295/11—III), darunter Briquet 157 (Köln 1574).
Schriftraum und Zeilenzahl variierend. Deutsche Kursive des 16. Jhs. von einer Hand. Rezeptüberschriften in
Auszeichnungsschrift. Zahlreiche Korrekturen, Ergänzungen, Kompilationsvermerke von späteren Händen,
darunter die Pfalzgräfin Elisabeths von Pfalz-Lautern (u.a. autographer Namenszug Elisabeth 42v-44v, 46r, 61v-
63r, 107v, 133v). Übersetzung lateinischer Rezeptteile ins Deutsche von der Hand Dr. Wilhelm Rascalons (2v-6r,
29r-30r, 36r/\ 71v, 74v, 85v—86', 113V—116V, 121v-122', 141r-145r) sowie Pfalzgräfin Elisabeths von Pfalz-Lautern
(163r). 147r Federzeichnung eines Bruchbandes. Monogramme Cfurfürstin] EJlisabeth?] (50r—51v, 57v, 75v, 79V-
80r, 86'-87r, 97r, 102r, 135v—137r) und //[erzog] /Jriedrich IV.?] (42'-44v, 46r, 62r-63r, 107v). Beginnender Tinten-
fraß, partiell stockfleckig. Pergamentkopert auf Langstichheftung (s. Fragmente; vgl. Cod. Pal. germ. 229).
Rundes Signaturschild, modern: Pal. Germ. 283.
Herkunft: Hs. aus dem Besitz Pfalzgräfin Elisabeths von Pfalz-Lautern (autographer Namenszug insbesondere
an Rezepten gegen Schlag und Schwindel sowie Nachtrag von Rezeptzuträgern und Übersetzung lateinischer
Textteile, s.o.), in deren Auftrag wahrscheinlich sowohl Wilhelm Rascalon lateinische Textteile der Hs. ins
Deutsche übersetzte, als auch die Kompilatoren Michel und Eberhard tätig waren. Kompilationsvermerke:
Vorderer Umschlag Michel hatt die salben aus dem buch geschrieben; 2*r Eberhardtt hatt die waßer geschrieben.
Michel hatt die salben geschrieben. Vorderer Umschlag Capsanummer: C. 154. Rücken alte römische Signatur:
1474. 2*r Signatur (Metallstift, 19. Jh.): N~ 283.
Schreibsprache: oberdeutsch mit Orientierung zum Hochdeutschen.
Literatur: Wille, S. 42f.; nicht bei Wilken.
389
II.
Herkunft: zwischen 1583 und 1589 entstanden (datiertes Rezept 1583, s.u., Anna-Maria von Hessen war noch
nicht mit Graf Ludwig II. von Nassau-Saarbrücken verheiratet).
Schreibsprache: hochdeutsch mit einigen spezifisch (nieder)alemannischen Formen.
232r-233v ANONYME REZEPTSAMMLUNG (ungeordnet; 7 Rezepte).
Datiertes Rezept: [15]83 (232r).
Als Rezeptzuträger oder Probanden werden genannt: Abt von Maulbronn (232r); Gräfin
Anna Maria von Nassau-Saarbrücken (232'); Dr. Meglin (232v).
(1. 232r-233v) 7 Rezepte gegen verschiedene Krankheiten. - 234::'r-236:,'v leer.
MM
Cod. Pal. germ. 283
Rezeptsammlung
Papier • 170 Bll. • 30,4 x 21,4 • Südwestdeutschland • um 1570
Lagen: 4 VI47 (mit Bl. 2*) + V57 + 2 VI81 + V91 + IV99 + 6 V159 + IV167*. Bll. 1*/168* um alle Lagen gelegt und in
die Falten des Koperts gesteckt. Foliierung des 16. Jhs. (Metallstift): 1-166, Bll. l*-2*, 167;:'-168“' mit moderner
Zählung. Wz.: verschiedene Varianten Buchstabe F in Kreis (Bll. 1*/168*, 36-167*; identisch in Cod. Pal.
germ. 239/XII, 377, nahezu identisch in Cod. Pal. germ. 177/11), darunter Piccard, Wasserzeichenkartei,
Nr. 27228 und Nr. 27234 (Heidelberg 1573) sowie Nr. 27276 und Nr. 27281 (Heidelberg 1572); verschiedene
Varianten Turm (Bll. 2*-14, 21-23), darunter Piccard 3, XV/89 (Zweibrücken 1572/1573), ähnlich Piccard 3,
XV/91 (Kirkel 1572); Vogelkopf im Wappenschild (Bll. 15-20), Piccard, Wasserzeichenkartei, Nr. 41931 bzw.
Nr. 41945 (Freiburg/Br. 1571); verschiedene Varianten einköpfiger gekrönter Adler mit Buchstabe F auf der
Brust (Bll. 24-35; identisch in Cod. Pal. germ. 188/1, 238/XIX, 295/11—III), darunter Briquet 157 (Köln 1574).
Schriftraum und Zeilenzahl variierend. Deutsche Kursive des 16. Jhs. von einer Hand. Rezeptüberschriften in
Auszeichnungsschrift. Zahlreiche Korrekturen, Ergänzungen, Kompilationsvermerke von späteren Händen,
darunter die Pfalzgräfin Elisabeths von Pfalz-Lautern (u.a. autographer Namenszug Elisabeth 42v-44v, 46r, 61v-
63r, 107v, 133v). Übersetzung lateinischer Rezeptteile ins Deutsche von der Hand Dr. Wilhelm Rascalons (2v-6r,
29r-30r, 36r/\ 71v, 74v, 85v—86', 113V—116V, 121v-122', 141r-145r) sowie Pfalzgräfin Elisabeths von Pfalz-Lautern
(163r). 147r Federzeichnung eines Bruchbandes. Monogramme Cfurfürstin] EJlisabeth?] (50r—51v, 57v, 75v, 79V-
80r, 86'-87r, 97r, 102r, 135v—137r) und //[erzog] /Jriedrich IV.?] (42'-44v, 46r, 62r-63r, 107v). Beginnender Tinten-
fraß, partiell stockfleckig. Pergamentkopert auf Langstichheftung (s. Fragmente; vgl. Cod. Pal. germ. 229).
Rundes Signaturschild, modern: Pal. Germ. 283.
Herkunft: Hs. aus dem Besitz Pfalzgräfin Elisabeths von Pfalz-Lautern (autographer Namenszug insbesondere
an Rezepten gegen Schlag und Schwindel sowie Nachtrag von Rezeptzuträgern und Übersetzung lateinischer
Textteile, s.o.), in deren Auftrag wahrscheinlich sowohl Wilhelm Rascalon lateinische Textteile der Hs. ins
Deutsche übersetzte, als auch die Kompilatoren Michel und Eberhard tätig waren. Kompilationsvermerke:
Vorderer Umschlag Michel hatt die salben aus dem buch geschrieben; 2*r Eberhardtt hatt die waßer geschrieben.
Michel hatt die salben geschrieben. Vorderer Umschlag Capsanummer: C. 154. Rücken alte römische Signatur:
1474. 2*r Signatur (Metallstift, 19. Jh.): N~ 283.
Schreibsprache: oberdeutsch mit Orientierung zum Hochdeutschen.
Literatur: Wille, S. 42f.; nicht bei Wilken.
389