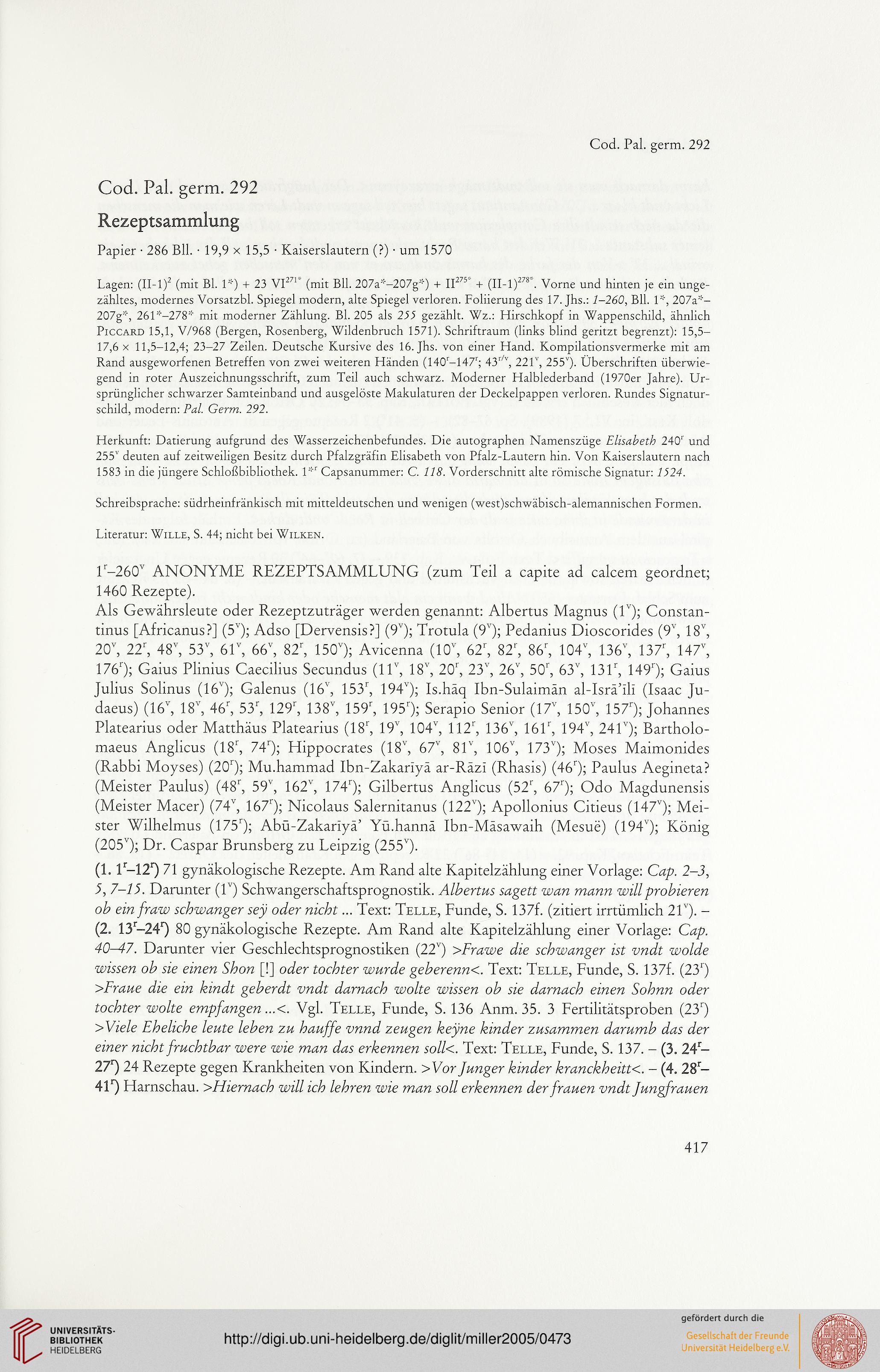Cod. Pal. germ. 292
Cod. Pal. germ. 292
Rezeptsammlung
Papier • 286 Bll. • 19,9 x 15,5 ■ Kaiserslautern (?) • um 1570
Lagen: (II-1)2 (mit Bl. 1::') + 23 VI21’ (mit Bll. 207a'“'-207g::') + II275 + (II-l)278 . Vorne und hinten je ein unge-
zähltes, modernes Vorsatzbl. Spiegel modern, alte Spiegel verloren. Foliierung des 17. Jhs.: 1-260, Bll. 1*, 207a*-
207g“', 261*—278* mit moderner Zählung. Bl. 205 als 255 gezählt. Wz.: Hirschkopf in Wappenschild, ähnlich
Piccard 15,1, V/968 (Bergen, Rosenberg, Wildenbruch 1571). Schriftraum (links blind geritzt begrenzt): 15,5-
17,6 x 11,5-12,4; 23-27 Zeilen. Deutsche Kursive des 16. Jhs. von einer Hand. Kompilationsvermerke mit am
Rand ausgeworfenen Betreffen von zwei weiteren Händen (140r-147r; 43r/v, 221v, 255v). Überschriften überwie-
gend in roter Auszeichnungsschrift, zum Teil auch schwarz. Moderner Halblederband (1970er Jahre). Ur-
sprünglicher schwarzer Samteinband und ausgelöste Makulaturen der Deckelpappen verloren. Rundes Signatur-
schild, modern: Pal. Germ. 292.
Herkunft: Datierung aufgrund des Wasserzeichenbefundes. Die autographen Namenszüge Elisabeth 240r und
255v deuten auf zeitweiligen Besitz durch Pfalzgräfin Elisabeth von Pfalz-Lautern hin. Von Kaiserslautern nach
1583 in die jüngere Schloßbibliothek. l*r Capsanummer: C. 118. Vorderschnitt alte römische Signatur: 1524.
Schreibsprache: südrheinfränkisch mit mitteldeutschen und wenigen (west)schwäbisch-alemannischen Formen.
Literatur: Wille, S. 44; nicht bei Wilken.
lr-260v ANONYME REZEPTSAMMLUNG (zum Teil a capite ad calcem geordnet;
1460 Rezepte).
Als Gewährsleute oder Rezeptzuträger werden genannt: Albertus Magnus (lv); Constan-
tinus [Africanus?] (5V); Adso [Dervensis?] (9V); Trotula (9V); Pedanius Dioscorides (9V, 18v,
20v, 22r, 48v, 53v, 61v, 66v, 82r, 150v); Avicenna (10v, 62r, 82r, 86r, 104v, 136v, 137r, 147v,
176r); Gaius Plinius Caecilius Secundus (llv, 18v, 20r, 23v, 26v, 50r, 63v, 131r, 149r); Gaius
Julius Solinus (16'); Galenus (16v, 153r, 194'); Is.häq Ibn-Sulaimän al-Isrä’ili (Isaac Ju-
daeus) (16', 18v, 46r, 53r, 129r, 138', 159r, 195r); Serapio Senior (17', 150', 157r); Johannes
Platearius oder Matthäus Platearius (18r, 19v, 104v, 112r, 136v, 161r, 194', 24lv); Bartholo-
maeus Anglicus (18r, 74r); Hippocrates (18v, 67v, 81v, 106v, 173v); Moses Maimonides
(Rabbi Moyses) (20r); Mu.hammad Ibn-Zakariyä ar-Räzi (Rhasis) (46r); Paulus Aegineta?
(Meister Paulus) (48r, 59v, 162', 174r); Gilbertus Anglicus (52r, 67r); Odo Magdunensis
(Meister Macer) (74v, 167r); Nicolaus Salernitanus (122'); Apollonius Citieus (147v); Mei-
ster Wilhelmus (175r); Abü-Zakariyä’ Yü.hannä Ibn-Mäsawaih (Mesue) (194v); König
(205v); Dr. Caspar Brunsberg zu Leipzig (255').
(1. ¥—12*) 71 gynäkologische Rezepte. Am Rand alte Kapitelzählung einer Vorlage: Cap. 2-3,
3, 7-15. Darunter (lv) Schwangerschaftsprognostik. Albertus sagett wan mann will probieren
ob einfraw schwanger sey oder nicht... Text: Telle, Funde, S. 137f. (zitiert irrtümlich 21v). -
(2. 13r-24r) 80 gynäkologische Rezepte. Am Rand alte Kapitelzählung einer Vorlage: Cap.
40-47. Darunter vier Geschlechtsprognostiken (22v) >Frawe die schwanger ist vndt wolde
wissen oh sie einen Shon [!] oder tochter wurde geberenn<. Text: Telle, Funde, S. 137f. (23r)
>Fraue die ein kindt geberdt vndt darnach wolte wissen ob sie darnach einen Sohnn oder
tochter wolte empfangen ...<. Vgl. Telle, Funde, S. 136 Anm. 35. 3 Fertilitätsproben (23r)
>Viele Eheliche leute leben zu hauffe vnnd zeugen keyne kinder zusammen darumb das der
einer nicht fruchtbar were wie man das erkennen soll<. Text: Telle, Funde, S. 137. - (3. 24r-
279 24 Rezepte gegen Krankheiten von Kindern. >Vor Junger kinder kranckheitt<. - (4. 28r-
41r) Harnschau. >Hiernach will ich lehren wie man soll erkennen der frauen vndt Jungfrauen
417
Cod. Pal. germ. 292
Rezeptsammlung
Papier • 286 Bll. • 19,9 x 15,5 ■ Kaiserslautern (?) • um 1570
Lagen: (II-1)2 (mit Bl. 1::') + 23 VI21’ (mit Bll. 207a'“'-207g::') + II275 + (II-l)278 . Vorne und hinten je ein unge-
zähltes, modernes Vorsatzbl. Spiegel modern, alte Spiegel verloren. Foliierung des 17. Jhs.: 1-260, Bll. 1*, 207a*-
207g“', 261*—278* mit moderner Zählung. Bl. 205 als 255 gezählt. Wz.: Hirschkopf in Wappenschild, ähnlich
Piccard 15,1, V/968 (Bergen, Rosenberg, Wildenbruch 1571). Schriftraum (links blind geritzt begrenzt): 15,5-
17,6 x 11,5-12,4; 23-27 Zeilen. Deutsche Kursive des 16. Jhs. von einer Hand. Kompilationsvermerke mit am
Rand ausgeworfenen Betreffen von zwei weiteren Händen (140r-147r; 43r/v, 221v, 255v). Überschriften überwie-
gend in roter Auszeichnungsschrift, zum Teil auch schwarz. Moderner Halblederband (1970er Jahre). Ur-
sprünglicher schwarzer Samteinband und ausgelöste Makulaturen der Deckelpappen verloren. Rundes Signatur-
schild, modern: Pal. Germ. 292.
Herkunft: Datierung aufgrund des Wasserzeichenbefundes. Die autographen Namenszüge Elisabeth 240r und
255v deuten auf zeitweiligen Besitz durch Pfalzgräfin Elisabeth von Pfalz-Lautern hin. Von Kaiserslautern nach
1583 in die jüngere Schloßbibliothek. l*r Capsanummer: C. 118. Vorderschnitt alte römische Signatur: 1524.
Schreibsprache: südrheinfränkisch mit mitteldeutschen und wenigen (west)schwäbisch-alemannischen Formen.
Literatur: Wille, S. 44; nicht bei Wilken.
lr-260v ANONYME REZEPTSAMMLUNG (zum Teil a capite ad calcem geordnet;
1460 Rezepte).
Als Gewährsleute oder Rezeptzuträger werden genannt: Albertus Magnus (lv); Constan-
tinus [Africanus?] (5V); Adso [Dervensis?] (9V); Trotula (9V); Pedanius Dioscorides (9V, 18v,
20v, 22r, 48v, 53v, 61v, 66v, 82r, 150v); Avicenna (10v, 62r, 82r, 86r, 104v, 136v, 137r, 147v,
176r); Gaius Plinius Caecilius Secundus (llv, 18v, 20r, 23v, 26v, 50r, 63v, 131r, 149r); Gaius
Julius Solinus (16'); Galenus (16v, 153r, 194'); Is.häq Ibn-Sulaimän al-Isrä’ili (Isaac Ju-
daeus) (16', 18v, 46r, 53r, 129r, 138', 159r, 195r); Serapio Senior (17', 150', 157r); Johannes
Platearius oder Matthäus Platearius (18r, 19v, 104v, 112r, 136v, 161r, 194', 24lv); Bartholo-
maeus Anglicus (18r, 74r); Hippocrates (18v, 67v, 81v, 106v, 173v); Moses Maimonides
(Rabbi Moyses) (20r); Mu.hammad Ibn-Zakariyä ar-Räzi (Rhasis) (46r); Paulus Aegineta?
(Meister Paulus) (48r, 59v, 162', 174r); Gilbertus Anglicus (52r, 67r); Odo Magdunensis
(Meister Macer) (74v, 167r); Nicolaus Salernitanus (122'); Apollonius Citieus (147v); Mei-
ster Wilhelmus (175r); Abü-Zakariyä’ Yü.hannä Ibn-Mäsawaih (Mesue) (194v); König
(205v); Dr. Caspar Brunsberg zu Leipzig (255').
(1. ¥—12*) 71 gynäkologische Rezepte. Am Rand alte Kapitelzählung einer Vorlage: Cap. 2-3,
3, 7-15. Darunter (lv) Schwangerschaftsprognostik. Albertus sagett wan mann will probieren
ob einfraw schwanger sey oder nicht... Text: Telle, Funde, S. 137f. (zitiert irrtümlich 21v). -
(2. 13r-24r) 80 gynäkologische Rezepte. Am Rand alte Kapitelzählung einer Vorlage: Cap.
40-47. Darunter vier Geschlechtsprognostiken (22v) >Frawe die schwanger ist vndt wolde
wissen oh sie einen Shon [!] oder tochter wurde geberenn<. Text: Telle, Funde, S. 137f. (23r)
>Fraue die ein kindt geberdt vndt darnach wolte wissen ob sie darnach einen Sohnn oder
tochter wolte empfangen ...<. Vgl. Telle, Funde, S. 136 Anm. 35. 3 Fertilitätsproben (23r)
>Viele Eheliche leute leben zu hauffe vnnd zeugen keyne kinder zusammen darumb das der
einer nicht fruchtbar were wie man das erkennen soll<. Text: Telle, Funde, S. 137. - (3. 24r-
279 24 Rezepte gegen Krankheiten von Kindern. >Vor Junger kinder kranckheitt<. - (4. 28r-
41r) Harnschau. >Hiernach will ich lehren wie man soll erkennen der frauen vndt Jungfrauen
417