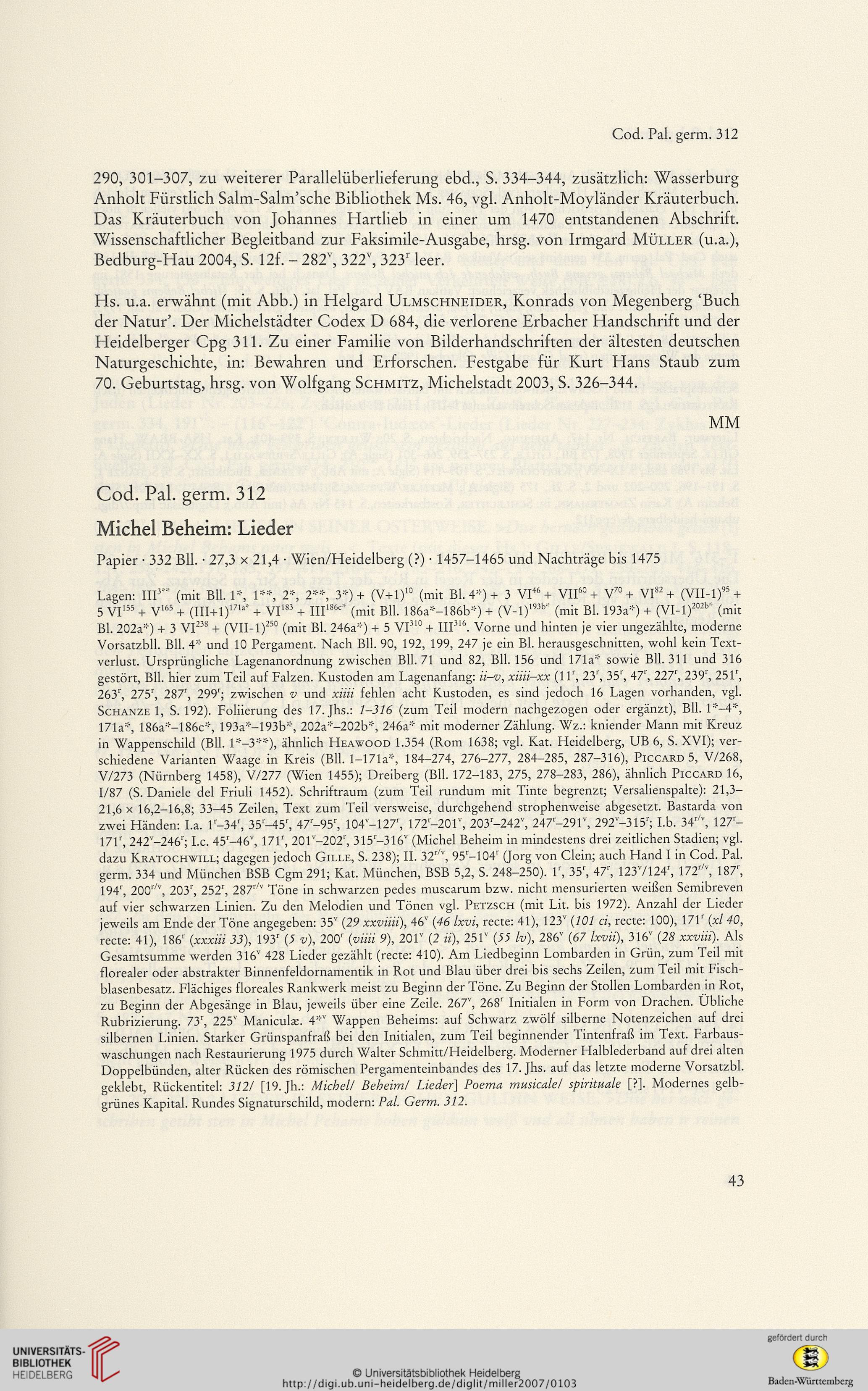Cod. Pal. germ. 312
290, 301-307, zu weiterer Parallelüberlieferung ebd., S. 334-344, zusätzlich: Wasserburg
Anholt Fürstlich Salm-Salm’sche Bibliothek Ms. 46, vgl. Anholt-Moyländer Kräuterbuch.
Das Kräuterbuch von Johannes Flartlieb in einer um 1470 entstandenen Abschrift.
Wissenschaftlicher Begleitband zur Faksimile-Ausgabe, hrsg. von Irmgard Müller (u.a.),
Bedburg-FIau 2004, S. 12f. - 282 v, 322 v, 323 r leer.
Hs. u.a. erwähnt (mit Abb.) in Helgard Ulmschneider, Konrads von Megenberg cBuch
der Natur’. Der Michelstädter Codex D 684, die verlorene Erbacher Handschrift und der
Heidelberger Cpg 311. Zu einer Familie von Bilderhandschriften der ältesten deutschen
Naturgeschichte, in: Bewahren und Erforschen. Festgabe für Kurt Hans Staub zum
70. Geburtstag, hrsg. von Wolfgang Schmitz, Michelstadt 2003, S. 326-344.
MM
Cod. Pal. germ. 312
Michel Beheim: Lieder
Papier • 332 Bll. • 27,3 x 21,4 • Wien/Heidelberg (?) • 1457-1465 und Nachträge bis 1475
Lagen: III 3” (mit Bll. 1*, 1**, 2*, 2**, 3*) + (V+l) 10 (mit Bl. 4 ::') + 3 VI 46 + VII 60 + V 70 + VI 82 + (VII-1 ) 95 +
5 VI 155 + V 165 + (III+l) 171a* + VI 183 + III 186cS' (mit Bll. 186a ;:'-186b ;:') + (V-l) 193b* (mit Bl. 193a ;:') + (VI-l) 202b* (mit
Bl. 202a ;:') + 3 VI 238 + (VII-l) 230 (mit Bl. 246a ;:') + 5 VI 310 + III 316. Vorne und hinten je vier ungezählte, moderne
Vorsatzbll. Bll. 4 ;:' und 10 Pergament. Nach Bll. 90, 192, 199, 247 je ein Bl. herausgeschnitten, wohl kein Text-
verlust. Ursprüngliche Lagenanordnung zwischen Bll. 71 und 82, Bll. 156 und 171a ;:' sowie Bll. 311 und 316
gestört, Bll. hier zum Teil auf Falzen. Kustoden am Lagenanfang: ii-v, xiiii-xx (ll r, 23 r, 35', 47 r, 227 r, 239 r, 25l r,
263 r, 275 r, 287 r, 299 r; zwischen v und xiiii fehlen acht Kustoden, es sind jedoch 16 Lagen vorhanden, vgl.
Schanze 1, S. 192). Foliierung des 17. Jhs.: 1-316 (zum Teil modern nachgezogen oder ergänzt), Bll. l ;:'-4 ;:',
171a ;:-, 186a ;:'-186c ;:', 193a ;:'-193b ;:', 202a ;:'-202b ;:', 246a ;:' mit moderner Zählung. Wz.: kniender Mann mit Kreuz
in Wappenschild (Bll. l ;:'-3 ;:' ;:'), ähnlich Heawood 1.354 (Rom 1638; vgl. Kat. Heidelberg, UB 6, S. XVI); ver-
schiedene Varianten Waage in Kreis (Bll. l-171a ;:', 184-274, 276-277, 284-285, 287-316), Piccard 5, V/268,
V/273 (Nürnberg 1458), V/277 (Wien 1455); Dreiberg (Bll. 172-183, 275, 278-283, 286), ähnlich Piccard 16,
1/87 (S. Daniele del Friuli 1452). Schriftraum (zum Teil rundum mit Tinte begrenzt; Versalienspalte): 21,3-
21,6 x 16,2-16,8; 33-45 Zeilen, Text zum Teil versweise, durchgehend strophenweise abgesetzt. Bastarda von
zwei Händen: I.a. l r-34 r, 35 r-45 r, 47 r-95 r, 104 v-127 r, 172 r-201 v, 203 r-242 v, 247 r-291 v, 292 v-315 r; I.b. 34 r/v, 127 r-
17T, 242 v-246 r; I.c. 45'-46 v, 17T, 201 v-202 r, 315 r-316 v (Michel Beheim in mindestens drei zeitlichen Stadien; vgl.
dazu Kratochwill; dagegen jedoch Gille, S. 238); II. 32 r/v, 95 r-104 r Qorg von Clein; auch Hand I in Cod. Pal.
germ. 334 und München BSB Cgm 291; Kat. München, BSB 5,2, S. 248-250). l r, 35 r, 47 r, 123 v/124 r, 172 r/v, 187 r,
194 r, 200 r/v, 203 r, 252 r, 287 r/v Töne in schwarzen pedes muscarum bzw. nicht mensurierten weißen Semibreven
auf vier schwarzen Linien. Zu den Melodien und Tönen vgl. Petzsch (mit Lit. bis 1972). Anzahl der Lieder
jeweils am Ende der Töne angegeben: 35 v (29 xxviiii), 46 v (46 Ixvi, recte: 41), 123' (101 ci, recte: 100), 17V (xl 40,
recte: 41), 186 r (xxxiii 33), 193 r (5 v), 200 r (vuü 9), 20V (2 ii), 25V (35 Iv), 286 v (67 Ixvii), 316 v (28 xxviii). Als
Gesamtsumme werden 316 v 428 Lieder gezählt (recte: 410). Am Liedbeginn Lombarden in Grün, zum Teil mit
florealer oder abstrakter Binnenfeldornamentik in Rot und Blau über drei bis sechs Zeilen, zum Teil mit Fisch-
blasenbesatz. Flächiges floreales Rankwerk meist zu Beginn der Töne. Zu Beginn der Stollen Lombarden in Rot,
zu Beginn der Abgesänge in Blau, jeweils über eine Zeile. 267 V, 268' Initialen in Form von Drachen. Übliche
Rubrizierung. 73 r, 225 v Maniculx. 4 ;:' v Wappen Beheims: auf Schwarz zwölf silberne Notenzeichen auf drei
silbernen Linien. Starker Grünspanfraß bei den Initialen, zum Teil beginnender Tintenfraß im Text. Farbaus-
waschungen nach Restaurierung 1975 durch Walter Schmitt/Heidelberg. Moderner Halblederband auf drei alten
Doppelbünden, alter Rücken des römischen Pergamenteinbandes des 17. Jhs. auf das letzte moderne Vorsatzbl.
geklebt, Rückentitel: 312/ [19. Jh.: Michel/ Beheim/ Lieder] Poema musicale/ spirituale [?]. Modernes gelb-
grünes Kapital. Rundes Signaturschild, modern: Pal. Germ. 312.
43
290, 301-307, zu weiterer Parallelüberlieferung ebd., S. 334-344, zusätzlich: Wasserburg
Anholt Fürstlich Salm-Salm’sche Bibliothek Ms. 46, vgl. Anholt-Moyländer Kräuterbuch.
Das Kräuterbuch von Johannes Flartlieb in einer um 1470 entstandenen Abschrift.
Wissenschaftlicher Begleitband zur Faksimile-Ausgabe, hrsg. von Irmgard Müller (u.a.),
Bedburg-FIau 2004, S. 12f. - 282 v, 322 v, 323 r leer.
Hs. u.a. erwähnt (mit Abb.) in Helgard Ulmschneider, Konrads von Megenberg cBuch
der Natur’. Der Michelstädter Codex D 684, die verlorene Erbacher Handschrift und der
Heidelberger Cpg 311. Zu einer Familie von Bilderhandschriften der ältesten deutschen
Naturgeschichte, in: Bewahren und Erforschen. Festgabe für Kurt Hans Staub zum
70. Geburtstag, hrsg. von Wolfgang Schmitz, Michelstadt 2003, S. 326-344.
MM
Cod. Pal. germ. 312
Michel Beheim: Lieder
Papier • 332 Bll. • 27,3 x 21,4 • Wien/Heidelberg (?) • 1457-1465 und Nachträge bis 1475
Lagen: III 3” (mit Bll. 1*, 1**, 2*, 2**, 3*) + (V+l) 10 (mit Bl. 4 ::') + 3 VI 46 + VII 60 + V 70 + VI 82 + (VII-1 ) 95 +
5 VI 155 + V 165 + (III+l) 171a* + VI 183 + III 186cS' (mit Bll. 186a ;:'-186b ;:') + (V-l) 193b* (mit Bl. 193a ;:') + (VI-l) 202b* (mit
Bl. 202a ;:') + 3 VI 238 + (VII-l) 230 (mit Bl. 246a ;:') + 5 VI 310 + III 316. Vorne und hinten je vier ungezählte, moderne
Vorsatzbll. Bll. 4 ;:' und 10 Pergament. Nach Bll. 90, 192, 199, 247 je ein Bl. herausgeschnitten, wohl kein Text-
verlust. Ursprüngliche Lagenanordnung zwischen Bll. 71 und 82, Bll. 156 und 171a ;:' sowie Bll. 311 und 316
gestört, Bll. hier zum Teil auf Falzen. Kustoden am Lagenanfang: ii-v, xiiii-xx (ll r, 23 r, 35', 47 r, 227 r, 239 r, 25l r,
263 r, 275 r, 287 r, 299 r; zwischen v und xiiii fehlen acht Kustoden, es sind jedoch 16 Lagen vorhanden, vgl.
Schanze 1, S. 192). Foliierung des 17. Jhs.: 1-316 (zum Teil modern nachgezogen oder ergänzt), Bll. l ;:'-4 ;:',
171a ;:-, 186a ;:'-186c ;:', 193a ;:'-193b ;:', 202a ;:'-202b ;:', 246a ;:' mit moderner Zählung. Wz.: kniender Mann mit Kreuz
in Wappenschild (Bll. l ;:'-3 ;:' ;:'), ähnlich Heawood 1.354 (Rom 1638; vgl. Kat. Heidelberg, UB 6, S. XVI); ver-
schiedene Varianten Waage in Kreis (Bll. l-171a ;:', 184-274, 276-277, 284-285, 287-316), Piccard 5, V/268,
V/273 (Nürnberg 1458), V/277 (Wien 1455); Dreiberg (Bll. 172-183, 275, 278-283, 286), ähnlich Piccard 16,
1/87 (S. Daniele del Friuli 1452). Schriftraum (zum Teil rundum mit Tinte begrenzt; Versalienspalte): 21,3-
21,6 x 16,2-16,8; 33-45 Zeilen, Text zum Teil versweise, durchgehend strophenweise abgesetzt. Bastarda von
zwei Händen: I.a. l r-34 r, 35 r-45 r, 47 r-95 r, 104 v-127 r, 172 r-201 v, 203 r-242 v, 247 r-291 v, 292 v-315 r; I.b. 34 r/v, 127 r-
17T, 242 v-246 r; I.c. 45'-46 v, 17T, 201 v-202 r, 315 r-316 v (Michel Beheim in mindestens drei zeitlichen Stadien; vgl.
dazu Kratochwill; dagegen jedoch Gille, S. 238); II. 32 r/v, 95 r-104 r Qorg von Clein; auch Hand I in Cod. Pal.
germ. 334 und München BSB Cgm 291; Kat. München, BSB 5,2, S. 248-250). l r, 35 r, 47 r, 123 v/124 r, 172 r/v, 187 r,
194 r, 200 r/v, 203 r, 252 r, 287 r/v Töne in schwarzen pedes muscarum bzw. nicht mensurierten weißen Semibreven
auf vier schwarzen Linien. Zu den Melodien und Tönen vgl. Petzsch (mit Lit. bis 1972). Anzahl der Lieder
jeweils am Ende der Töne angegeben: 35 v (29 xxviiii), 46 v (46 Ixvi, recte: 41), 123' (101 ci, recte: 100), 17V (xl 40,
recte: 41), 186 r (xxxiii 33), 193 r (5 v), 200 r (vuü 9), 20V (2 ii), 25V (35 Iv), 286 v (67 Ixvii), 316 v (28 xxviii). Als
Gesamtsumme werden 316 v 428 Lieder gezählt (recte: 410). Am Liedbeginn Lombarden in Grün, zum Teil mit
florealer oder abstrakter Binnenfeldornamentik in Rot und Blau über drei bis sechs Zeilen, zum Teil mit Fisch-
blasenbesatz. Flächiges floreales Rankwerk meist zu Beginn der Töne. Zu Beginn der Stollen Lombarden in Rot,
zu Beginn der Abgesänge in Blau, jeweils über eine Zeile. 267 V, 268' Initialen in Form von Drachen. Übliche
Rubrizierung. 73 r, 225 v Maniculx. 4 ;:' v Wappen Beheims: auf Schwarz zwölf silberne Notenzeichen auf drei
silbernen Linien. Starker Grünspanfraß bei den Initialen, zum Teil beginnender Tintenfraß im Text. Farbaus-
waschungen nach Restaurierung 1975 durch Walter Schmitt/Heidelberg. Moderner Halblederband auf drei alten
Doppelbünden, alter Rücken des römischen Pergamenteinbandes des 17. Jhs. auf das letzte moderne Vorsatzbl.
geklebt, Rückentitel: 312/ [19. Jh.: Michel/ Beheim/ Lieder] Poema musicale/ spirituale [?]. Modernes gelb-
grünes Kapital. Rundes Signaturschild, modern: Pal. Germ. 312.
43