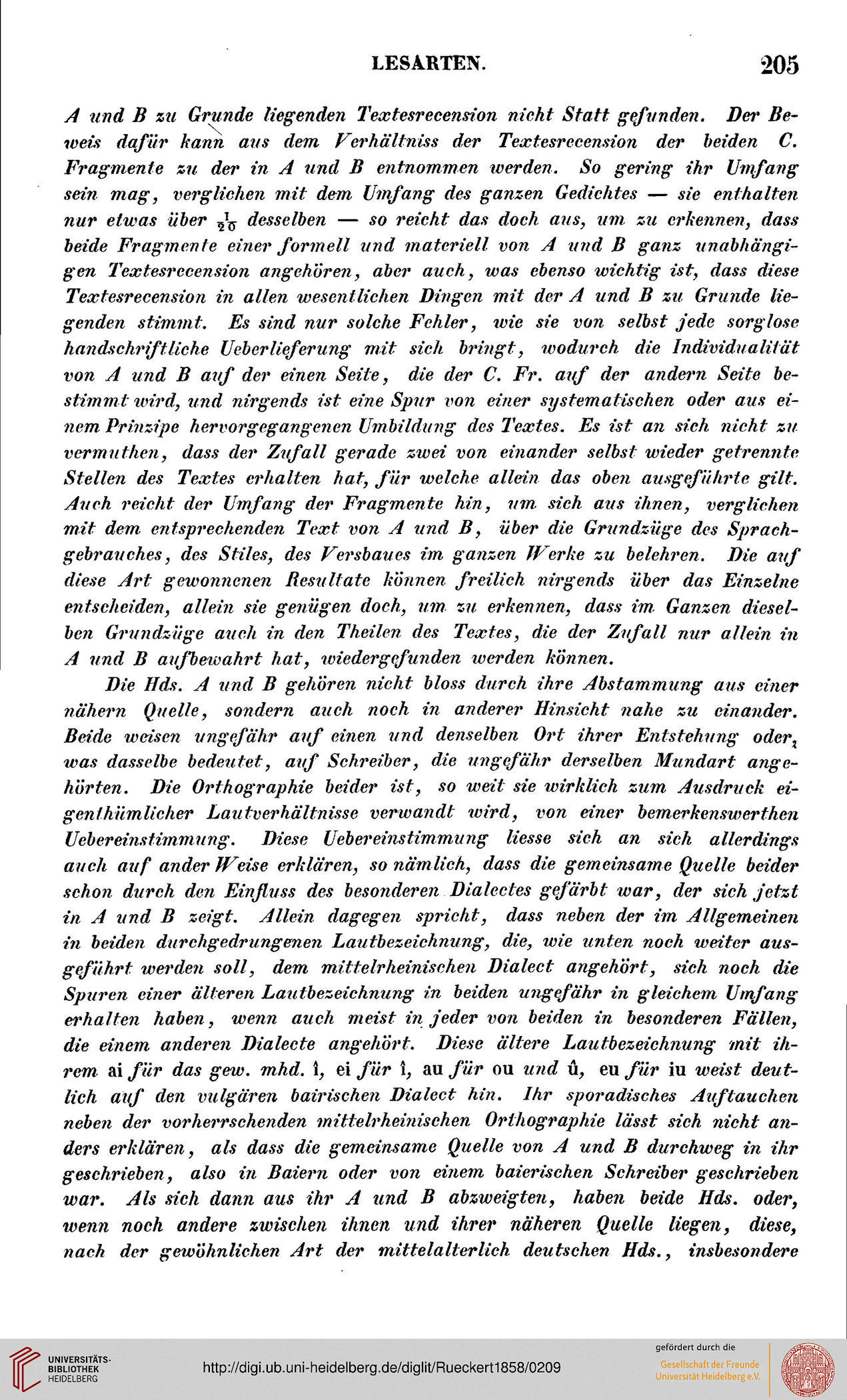LESARTEN. 205
A und B zu Grunde liegenden Textesrecension nicht Statt gefunden. Dei' Be-
weis dafür kann aus dem Verhältniss der Textesrecension der beiden C.
Fragmente zu der in A und B entnommen werden. So gering ihr Umfang
sein mag, verglicheil mit dem Umfang des ganzen Gedichtes — sie enthalten
nur etwas über 5Tff desselben — so reicht das doch aus, um zu erkennen, dass
beide Fragmente einer formell und materiell von A und B ganz unabhängi-
gen Textesrecension angehören, aber auch, was ebenso wichtig ist, dass diese
Textesrecension in allen wesentlichen Dingen mit der A und B zu Grtinde lie-
genden stimmt. Es sind nur solche Fehler, wie sie von selbst jede sorglose
handschriftliche Ueberlief er ung mit sich bringt, wodurch die Individualität
von A und B auf der einen Seite, die der C. Fr. auf der andern Seite be-
stimmt wird, und nirgends ist eine Spur von einer systematischen oder aus ei-
nem Prinzipe hervorgegangenen Umbildung des Textes. Es ist an sich nicht zu
vermuthen, dass der Zufall gerade zwei von einander selbst wieder getrennte
Stellen des Textes erhalten hat, für welche allein das oben ausgeführte gilt.
Auch reicht der Umfang der Fragmente hin, um sieh aus ihnen, verglichen
mit dein entsprechenden Text von A und B, über die Grundzüge des Sprach-
gebrauches, des Stiles, des Versbaues im ganzen Werke zu belehren. Die auf
diese Art gewonnenen Resultate können freilich nirgends über das Einzelne
entscheiden, allein sie genügen doch, um zu erkennen, dass im. Ganzen diesel-
ben Grundzüge auch in den Theilen des Textes, die der Zufall nur allein in
A und B aufbewahrt hat, wiedergefunden werden können.
Die Hds. A und B gehören nicht bloss durch ihre Abstammung aus einer
nähern Quelle, sondern auch noch in anderer Hinsicht nahe zu einander.
Beide weisen ungefähr auf einen und denselben Ort ihrer Entstehung oderx
was dasselbe bedeutet, auf Schreiber, die ungefähr derselben Mundart ange-
hörten. Die Orthographie beider ist, so weit sie wirklich zum Atisdruck ei-
genlhümlicher Lautverhältnisse verwandt wird, von einer bemerkenswerten
Uebereinstimmung. Diese Uebereinstimmung Hesse sich an sich allerdings
auch auf ander Weise erklären, so nämlich, dass die gemeinsame Quelle beider
schon durch den Einßuss des besonderen Dialectes gefärbt war, der sich jetzt
in A und B zeigt. Allein dagegen spricht, dass neben der im Allgemeinen
in beiden durchgedrungenen Lautbezeichnung, die, wie unten noch weiter aus-
geführt werdeii soll, dem mittelrheinischen Dialect angehört, sich noch die
Spuren einer älteren Lautbezeichnung in beiden ungefähr in gleichem Urnfang
erhalten haben, wenn auch meist in jeder von beiden in besonderen Fällen,
die einem anderen Dialecte angehört. Diese ältere Lautbezeichnung mit ih-
rem &i für das gew. mhd. Ì, ei für Ì, au für ou und û, eu für iu weist deut-
lich auf den vulgären bairischen Dialect hin. Ihr sporadisches Auftauchen
neben der vorherrschenden mittelrheinischen Orthographie lässt sich nicht an-
ders erklären, als dass die gemeinsame Quelle von A und B durchweg in ihr
geschrieben, also in Baiern oder von einem baierischen Schreiber geschrieben
war. Als sich dann aus ihr A und B abzweigten, haben beide Hds. oder,
wenn noch andere zwischen ihnen und ihrer näheren Quelle liegen, diese,
nach der gewöhnlichen Art der mittelalterlich deutschen Hd<s., insbesondere
A und B zu Grunde liegenden Textesrecension nicht Statt gefunden. Dei' Be-
weis dafür kann aus dem Verhältniss der Textesrecension der beiden C.
Fragmente zu der in A und B entnommen werden. So gering ihr Umfang
sein mag, verglicheil mit dem Umfang des ganzen Gedichtes — sie enthalten
nur etwas über 5Tff desselben — so reicht das doch aus, um zu erkennen, dass
beide Fragmente einer formell und materiell von A und B ganz unabhängi-
gen Textesrecension angehören, aber auch, was ebenso wichtig ist, dass diese
Textesrecension in allen wesentlichen Dingen mit der A und B zu Grtinde lie-
genden stimmt. Es sind nur solche Fehler, wie sie von selbst jede sorglose
handschriftliche Ueberlief er ung mit sich bringt, wodurch die Individualität
von A und B auf der einen Seite, die der C. Fr. auf der andern Seite be-
stimmt wird, und nirgends ist eine Spur von einer systematischen oder aus ei-
nem Prinzipe hervorgegangenen Umbildung des Textes. Es ist an sich nicht zu
vermuthen, dass der Zufall gerade zwei von einander selbst wieder getrennte
Stellen des Textes erhalten hat, für welche allein das oben ausgeführte gilt.
Auch reicht der Umfang der Fragmente hin, um sieh aus ihnen, verglichen
mit dein entsprechenden Text von A und B, über die Grundzüge des Sprach-
gebrauches, des Stiles, des Versbaues im ganzen Werke zu belehren. Die auf
diese Art gewonnenen Resultate können freilich nirgends über das Einzelne
entscheiden, allein sie genügen doch, um zu erkennen, dass im. Ganzen diesel-
ben Grundzüge auch in den Theilen des Textes, die der Zufall nur allein in
A und B aufbewahrt hat, wiedergefunden werden können.
Die Hds. A und B gehören nicht bloss durch ihre Abstammung aus einer
nähern Quelle, sondern auch noch in anderer Hinsicht nahe zu einander.
Beide weisen ungefähr auf einen und denselben Ort ihrer Entstehung oderx
was dasselbe bedeutet, auf Schreiber, die ungefähr derselben Mundart ange-
hörten. Die Orthographie beider ist, so weit sie wirklich zum Atisdruck ei-
genlhümlicher Lautverhältnisse verwandt wird, von einer bemerkenswerten
Uebereinstimmung. Diese Uebereinstimmung Hesse sich an sich allerdings
auch auf ander Weise erklären, so nämlich, dass die gemeinsame Quelle beider
schon durch den Einßuss des besonderen Dialectes gefärbt war, der sich jetzt
in A und B zeigt. Allein dagegen spricht, dass neben der im Allgemeinen
in beiden durchgedrungenen Lautbezeichnung, die, wie unten noch weiter aus-
geführt werdeii soll, dem mittelrheinischen Dialect angehört, sich noch die
Spuren einer älteren Lautbezeichnung in beiden ungefähr in gleichem Urnfang
erhalten haben, wenn auch meist in jeder von beiden in besonderen Fällen,
die einem anderen Dialecte angehört. Diese ältere Lautbezeichnung mit ih-
rem &i für das gew. mhd. Ì, ei für Ì, au für ou und û, eu für iu weist deut-
lich auf den vulgären bairischen Dialect hin. Ihr sporadisches Auftauchen
neben der vorherrschenden mittelrheinischen Orthographie lässt sich nicht an-
ders erklären, als dass die gemeinsame Quelle von A und B durchweg in ihr
geschrieben, also in Baiern oder von einem baierischen Schreiber geschrieben
war. Als sich dann aus ihr A und B abzweigten, haben beide Hds. oder,
wenn noch andere zwischen ihnen und ihrer näheren Quelle liegen, diese,
nach der gewöhnlichen Art der mittelalterlich deutschen Hd<s., insbesondere