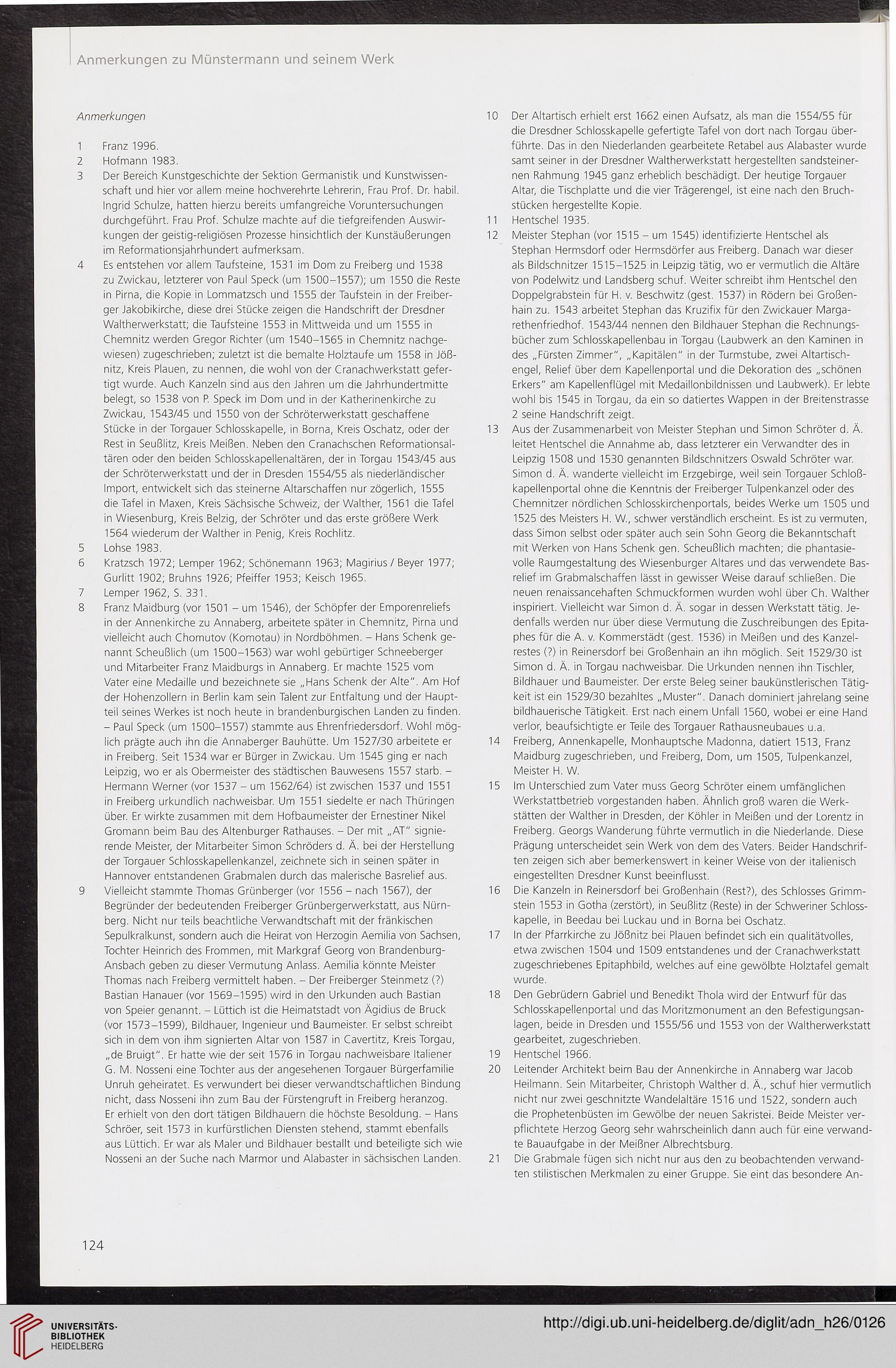Anmerkungen zu Münstermann und seinem Werk
Anmerkungen
1 Franz 1996.
2 Hofmann 1983.
3 Der Bereich Kunstgeschichte der Sektion Germanistik und Kunstwissen-
schaft und hier vor allem meine hochverehrte Lehrerin, Frau Prof. Dr. habil.
Ingrid Schulze, hatten hierzu bereits umfangreiche Voruntersuchungen
durchgeführt. Frau Prof. Schulze machte auf die tiefgreifenden Auswir-
kungen der geistig-religiösen Prozesse hinsichtlich der Kunstäußerungen
im Reformationsjahrhundert aufmerksam.
4 Es entstehen vor allem Taufsteine, 1531 im Dom zu Freiberg und 1538
zu Zwickau, letzterer von Paul Speck (um 1500-1557); um 1550 die Reste
in Pirna, die Kopie in Lommatzsch und 1555 der Taufstein in der Freiber-
ger Jakobikirche, diese drei Stücke zeigen die Handschrift der Dresdner
Waltherwerkstatt; die Taufsteine 1553 in Mittweida und um 1555 in
Chemnitz werden Gregor Richter (um 1540-1565 in Chemnitz nachge-
wiesen) zugeschrieben; zuletzt ist die bemalte Holztaufe um 1558 in Jöß-
nitz, Kreis Plauen, zu nennen, die wohl von der Cranachwerkstatt gefer-
tigt wurde. Auch Kanzeln sind aus den Jahren um die Jahrhundertmitte
belegt, so 1538 von P. Speck im Dom und in der Katherinenkirche zu
Zwickau, 1543/45 und 1550 von der Schröterwerkstatt geschaffene
Stücke in der Torgauer Schlosskapelle, in Borna, Kreis Oschatz, oder der
Rest in Seußlitz, Kreis Meißen. Neben den Cranachschen Reformationsal-
tären oder den beiden Schlosskapellenaltären, der in Torgau 1543/45 aus
der Schröterwerkstatt und der in Dresden 1554/55 als niederländischer
Import, entwickelt sich das steinerne Altarschaffen nur zögerlich, 1555
die Tafel in Maxen, Kreis Sächsische Schweiz, der Walther, 1561 die Tafel
in Wiesenburg, Kreis Belzig, der Schröter und das erste größere Werk
1564 wiederum der Walther in Penig, Kreis Rochlitz.
5 Lohse 1983.
6 Kratzsch 1972; Lemper 1962; Schönemann 1963; Magirius / Beyer 1977;
Gurlitt 1902; Bruhns 1926; Pfeiffer 1953; Keisch 1965.
7 Lemper 1962, S. 331.
8 Franz Maidburg (vor 1501 - um 1546), der Schöpfer der Emporenreliefs
in der Annenkirche zu Annaberg, arbeitete später in Chemnitz, Pirna und
vielleicht auch Chomutov (Komotau) in Nordböhmen. - Hans Schenk ge-
nannt Scheußlich (um 1500-1563) war wohl gebürtiger Schneeberger
und Mitarbeiter Franz Maidburgs in Annaberg. Er machte 1525 vom
Vater eine Medaille und bezeichnete sie „Hans Schenk der Alte". Am Hof
der Hohenzollern in Berlin kam sein Talent zur Entfaltung und der Haupt-
teil seines Werkes ist noch heute in brandenburgischen Landen zu finden.
- Paul Speck (um 1500-1557) stammte aus Ehrenfriedersdorf. Wohl mög-
lich prägte auch ihn die Annaberger Bauhütte. Um 1527/30 arbeitete er
in Freiberg. Seit 1534 war er Bürger in Zwickau. Um 1545 ging er nach
Leipzig, wo er als Obermeister des städtischen Bauwesens 1557 starb. -
Hermann Werner (vor 1537 - um 1562/64) ist zwischen 1537 und 1551
in Freiberg urkundlich nachweisbar. Um 1551 siedelte er nach Thüringen
über. Er wirkte zusammen mit dem Hofbaumeister der Ernestiner Nikel
Gromann beim Bau des Altenburger Rathauses. - Der mit „AT" signie-
rende Meister, der Mitarbeiter Simon Schröders d. Ä. bei der Herstellung
der Torgauer Schlosskapellenkanzel, zeichnete sich in seinen später in
Hannover entstandenen Grabmalen durch das malerische Basrelief aus.
9 Vielleicht stammte Thomas Grünberger (vor 1556 - nach 1567), der
Begründer der bedeutenden Freiberger Grünbergerwerkstatt, aus Nürn-
berg. Nicht nur teils beachtliche Verwandtschaft mit der fränkischen
Sepulkralkunst, sondern auch die Heirat von Herzogin Aemilia von Sachsen,
Tochter Heinrich des Frommen, mit Markgraf Georg von Brandenburg-
Ansbach geben zu dieser Vermutung Anlass. Aemilia könnte Meister
Thomas nach Freiberg vermittelt haben. - Der Freiberger Steinmetz (?)
Bastian Hanauer (vor 1569-1595) wird in den Urkunden auch Bastian
von Speier genannt. - Lüttich ist die Heimatstadt von Ägidius de Bruck
(vor 1573-1599), Bildhauer, Ingenieur und Baumeister. Er selbst schreibt
sich in dem von ihm signierten Altar von 1587 in Cavertitz, Kreis Torgau,
„de Bruigt". Er hatte wie der seit 1576 in Torgau nachweisbare Italiener
G. M. Nosseni eine Tochter aus der angesehenen Torgauer Bürgerfamilie
Unruh geheiratet. Es verwundert bei dieser verwandtschaftlichen Bindung
nicht, dass Nosseni ihn zum Bau der Fürstengruft in Freiberg heranzog.
Er erhielt von den dort tätigen Bildhauern die höchste Besoldung. - Hans
Schröer, seit 1573 in kurfürstlichen Diensten stehend, stammt ebenfalls
aus Lüttich. Er war als Maler und Bildhauer bestallt und beteiligte sich wie
Nosseni an der Suche nach Marmor und Alabaster in sächsischen Landen.
10 Der Altartisch erhielt erst 1662 einen Aufsatz, als man die 1554/55 für
die Dresdner Schlosskapelle gefertigte Tafel von dort nach Torgau über-
führte. Das in den Niederlanden gearbeitete Retabel aus Alabaster wurde
samt seiner in der Dresdner Waltherwerkstatt hergestellten sandsteiner-
nen Rahmung 1945 ganz erheblich beschädigt. Der heutige Torgauer
Altar, die Tischplatte und die vier Trägerengel, ist eine nach den Bruch-
stücken hergestellte Kopie.
11 Hentschel 1935.
12 Meister Stephan (vor 1515 - um 1545) identifizierte Hentschel als
Stephan Hermsdorf oder Hermsdörfer aus Freiberg. Danach war dieser
als Bildschnitzer 1515-1525 in Leipzig tätig, wo er vermutlich die Altäre
von Podelwitz und Landsberg schuf. Weiter schreibt ihm Hentschel den
Doppelgrabstein für H. v. Beschwitz (gest. 1537) in Rödern bei Großen-
hain zu. 1543 arbeitet Stephan das Kruzifix für den Zwickauer Marga-
rethenfriedhof. 1543/44 nennen den Bildhauer Stephan die Rechnungs-
bücher zum Schlosskapellenbau in Torgau (Laubwerk an den Kaminen in
des „Fürsten Zimmer", „Kapitalen" in der Turmstube, zwei Altartisch-
engel, Relief über dem Kapellenportal und die Dekoration des „schönen
Erkers" am Kapellenflügel mit Medaillonbildnissen und Laubwerk). Er lebte
wohl bis 1545 in Torgau, da ein so datiertes Wappen in der Breitenstrasse
2 seine Handschrift zeigt.
13 Aus der Zusammenarbeit von Meister Stephan und Simon Schröter d. Ä.
leitet Hentschel die Annahme ab, dass letzterer ein Verwandter des in
Leipzig 1508 und 1530 genannten Bildschnitzers Oswald Schröter war.
Simon d. Ä. wanderte vielleicht im Erzgebirge, weil sein Torgauer Schloß-
kapellenportal ohne die Kenntnis der Freiberger Tulpenkanzel oder des
Chemnitzer nördlichen Schlosskirchenportals, beides Werke um 1505 und
1525 des Meisters H. W., schwer verständlich erscheint. Es ist zu vermuten,
dass Simon selbst oder später auch sein Sohn Georg die Bekanntschaft
mit Werken von Hans Schenk gen. Scheußlich machten; die phantasie-
volle Raumgestaltung des Wiesenburger Altares und das verwendete Bas-
relief im Grabmalschaffen lässt in gewisser Weise darauf schließen. Die
neuen renaissancehaften Schmuckformen wurden wohl über Ch. Walther
inspiriert. Vielleicht war Simon d. Ä. sogar in dessen Werkstatt tätig. Je-
denfalls werden nur über diese Vermutung die Zuschreibungen des Epita-
phes für die A. v. Kommerstädt (gest. 1536) in Meißen und des Kanzel-
restes (?) in Reinersdorf bei Großenhain an ihn möglich. Seit 1529/30 ist
Simon d. Ä. in Torgau nachweisbar. Die Urkunden nennen ihn Tischler,
Bildhauer und Baumeister. Der erste Beleg seiner baukünstlerischen Tätig-
keit ist ein 1529/30 bezahltes „Muster". Danach dominiert jahrelang seine
bildhauerische Tätigkeit. Erst nach einem Unfall 1560, wobei er eine Hand
verlor, beaufsichtigte er Teile des Torgauer Rathausneubaues u.a.
14 Freiberg, Annenkapelle, Monhauptsche Madonna, datiert 1513, Franz
Maidburg zugeschrieben, und Freiberg, Dom, um 1505, Tulpenkanzel,
Meister H. W.
15 Im Unterschied zum Vater muss Georg Schröter einem umfänglichen
Werkstattbetrieb vorgestanden haben. Ähnlich groß waren die Werk-
stätten der Walther in Dresden, der Köhler in Meißen und der Lorentz in
Freiberg. Georgs Wanderung führte vermutlich in die Niederlande. Diese
Prägung unterscheidet sein Werk von dem des Vaters. Beider Handschrif-
ten zeigen sich aber bemerkenswert in keiner Weise von der italienisch
eingestellten Dresdner Kunst beeinflusst.
16 Die Kanzeln in Reinersdorf bei Großenhain (Rest?), des Schlosses Grimm-
stein 1553 in Gotha (zerstört), in Seußlitz (Reste) in der Schweriner Schloss-
kapelle, in Beedau bei Luckau und in Borna bei Oschatz.
17 In der Pfarrkirche zu Jößnitz bei Plauen befindet sich ein qualitätvolles,
etwa zwischen 1504 und 1509 entstandenes und der Cranachwerkstatt
zugeschriebenes Epitaphbild, welches auf eine gewölbte Holztafel gemalt
wurde.
18 Den Gebrüdern Gabriel und Benedikt Thola wird der Entwurf für das
Schlosskapellenportal und das Moritzmonument an den Befestigungsan-
lagen, beide in Dresden und 1555/56 und 1553 von der Waltherwerkstatt
gearbeitet, zugeschrieben.
19 Hentschel 1966.
20 Leitender Architekt beim Bau der Annenkirche in Annaberg war Jacob
Heilmann. Sein Mitarbeiter, Christoph Walther d. Ä., schuf hier vermutlich
nicht nur zwei geschnitzte Wandelaltäre 1516 und 1522, sondern auch
die Prophetenbüsten im Gewölbe der neuen Sakristei. Beide Meister ver-
pflichtete Herzog Georg sehr wahrscheinlich dann auch für eine verwand-
te Bauaufgabe in der Meißner Albrechtsburg.
21 Die Grabmale fügen sich nicht nur aus den zu beobachtenden verwand-
ten stilistischen Merkmalen zu einer Gruppe. Sie eint das besondere An-
124
Anmerkungen
1 Franz 1996.
2 Hofmann 1983.
3 Der Bereich Kunstgeschichte der Sektion Germanistik und Kunstwissen-
schaft und hier vor allem meine hochverehrte Lehrerin, Frau Prof. Dr. habil.
Ingrid Schulze, hatten hierzu bereits umfangreiche Voruntersuchungen
durchgeführt. Frau Prof. Schulze machte auf die tiefgreifenden Auswir-
kungen der geistig-religiösen Prozesse hinsichtlich der Kunstäußerungen
im Reformationsjahrhundert aufmerksam.
4 Es entstehen vor allem Taufsteine, 1531 im Dom zu Freiberg und 1538
zu Zwickau, letzterer von Paul Speck (um 1500-1557); um 1550 die Reste
in Pirna, die Kopie in Lommatzsch und 1555 der Taufstein in der Freiber-
ger Jakobikirche, diese drei Stücke zeigen die Handschrift der Dresdner
Waltherwerkstatt; die Taufsteine 1553 in Mittweida und um 1555 in
Chemnitz werden Gregor Richter (um 1540-1565 in Chemnitz nachge-
wiesen) zugeschrieben; zuletzt ist die bemalte Holztaufe um 1558 in Jöß-
nitz, Kreis Plauen, zu nennen, die wohl von der Cranachwerkstatt gefer-
tigt wurde. Auch Kanzeln sind aus den Jahren um die Jahrhundertmitte
belegt, so 1538 von P. Speck im Dom und in der Katherinenkirche zu
Zwickau, 1543/45 und 1550 von der Schröterwerkstatt geschaffene
Stücke in der Torgauer Schlosskapelle, in Borna, Kreis Oschatz, oder der
Rest in Seußlitz, Kreis Meißen. Neben den Cranachschen Reformationsal-
tären oder den beiden Schlosskapellenaltären, der in Torgau 1543/45 aus
der Schröterwerkstatt und der in Dresden 1554/55 als niederländischer
Import, entwickelt sich das steinerne Altarschaffen nur zögerlich, 1555
die Tafel in Maxen, Kreis Sächsische Schweiz, der Walther, 1561 die Tafel
in Wiesenburg, Kreis Belzig, der Schröter und das erste größere Werk
1564 wiederum der Walther in Penig, Kreis Rochlitz.
5 Lohse 1983.
6 Kratzsch 1972; Lemper 1962; Schönemann 1963; Magirius / Beyer 1977;
Gurlitt 1902; Bruhns 1926; Pfeiffer 1953; Keisch 1965.
7 Lemper 1962, S. 331.
8 Franz Maidburg (vor 1501 - um 1546), der Schöpfer der Emporenreliefs
in der Annenkirche zu Annaberg, arbeitete später in Chemnitz, Pirna und
vielleicht auch Chomutov (Komotau) in Nordböhmen. - Hans Schenk ge-
nannt Scheußlich (um 1500-1563) war wohl gebürtiger Schneeberger
und Mitarbeiter Franz Maidburgs in Annaberg. Er machte 1525 vom
Vater eine Medaille und bezeichnete sie „Hans Schenk der Alte". Am Hof
der Hohenzollern in Berlin kam sein Talent zur Entfaltung und der Haupt-
teil seines Werkes ist noch heute in brandenburgischen Landen zu finden.
- Paul Speck (um 1500-1557) stammte aus Ehrenfriedersdorf. Wohl mög-
lich prägte auch ihn die Annaberger Bauhütte. Um 1527/30 arbeitete er
in Freiberg. Seit 1534 war er Bürger in Zwickau. Um 1545 ging er nach
Leipzig, wo er als Obermeister des städtischen Bauwesens 1557 starb. -
Hermann Werner (vor 1537 - um 1562/64) ist zwischen 1537 und 1551
in Freiberg urkundlich nachweisbar. Um 1551 siedelte er nach Thüringen
über. Er wirkte zusammen mit dem Hofbaumeister der Ernestiner Nikel
Gromann beim Bau des Altenburger Rathauses. - Der mit „AT" signie-
rende Meister, der Mitarbeiter Simon Schröders d. Ä. bei der Herstellung
der Torgauer Schlosskapellenkanzel, zeichnete sich in seinen später in
Hannover entstandenen Grabmalen durch das malerische Basrelief aus.
9 Vielleicht stammte Thomas Grünberger (vor 1556 - nach 1567), der
Begründer der bedeutenden Freiberger Grünbergerwerkstatt, aus Nürn-
berg. Nicht nur teils beachtliche Verwandtschaft mit der fränkischen
Sepulkralkunst, sondern auch die Heirat von Herzogin Aemilia von Sachsen,
Tochter Heinrich des Frommen, mit Markgraf Georg von Brandenburg-
Ansbach geben zu dieser Vermutung Anlass. Aemilia könnte Meister
Thomas nach Freiberg vermittelt haben. - Der Freiberger Steinmetz (?)
Bastian Hanauer (vor 1569-1595) wird in den Urkunden auch Bastian
von Speier genannt. - Lüttich ist die Heimatstadt von Ägidius de Bruck
(vor 1573-1599), Bildhauer, Ingenieur und Baumeister. Er selbst schreibt
sich in dem von ihm signierten Altar von 1587 in Cavertitz, Kreis Torgau,
„de Bruigt". Er hatte wie der seit 1576 in Torgau nachweisbare Italiener
G. M. Nosseni eine Tochter aus der angesehenen Torgauer Bürgerfamilie
Unruh geheiratet. Es verwundert bei dieser verwandtschaftlichen Bindung
nicht, dass Nosseni ihn zum Bau der Fürstengruft in Freiberg heranzog.
Er erhielt von den dort tätigen Bildhauern die höchste Besoldung. - Hans
Schröer, seit 1573 in kurfürstlichen Diensten stehend, stammt ebenfalls
aus Lüttich. Er war als Maler und Bildhauer bestallt und beteiligte sich wie
Nosseni an der Suche nach Marmor und Alabaster in sächsischen Landen.
10 Der Altartisch erhielt erst 1662 einen Aufsatz, als man die 1554/55 für
die Dresdner Schlosskapelle gefertigte Tafel von dort nach Torgau über-
führte. Das in den Niederlanden gearbeitete Retabel aus Alabaster wurde
samt seiner in der Dresdner Waltherwerkstatt hergestellten sandsteiner-
nen Rahmung 1945 ganz erheblich beschädigt. Der heutige Torgauer
Altar, die Tischplatte und die vier Trägerengel, ist eine nach den Bruch-
stücken hergestellte Kopie.
11 Hentschel 1935.
12 Meister Stephan (vor 1515 - um 1545) identifizierte Hentschel als
Stephan Hermsdorf oder Hermsdörfer aus Freiberg. Danach war dieser
als Bildschnitzer 1515-1525 in Leipzig tätig, wo er vermutlich die Altäre
von Podelwitz und Landsberg schuf. Weiter schreibt ihm Hentschel den
Doppelgrabstein für H. v. Beschwitz (gest. 1537) in Rödern bei Großen-
hain zu. 1543 arbeitet Stephan das Kruzifix für den Zwickauer Marga-
rethenfriedhof. 1543/44 nennen den Bildhauer Stephan die Rechnungs-
bücher zum Schlosskapellenbau in Torgau (Laubwerk an den Kaminen in
des „Fürsten Zimmer", „Kapitalen" in der Turmstube, zwei Altartisch-
engel, Relief über dem Kapellenportal und die Dekoration des „schönen
Erkers" am Kapellenflügel mit Medaillonbildnissen und Laubwerk). Er lebte
wohl bis 1545 in Torgau, da ein so datiertes Wappen in der Breitenstrasse
2 seine Handschrift zeigt.
13 Aus der Zusammenarbeit von Meister Stephan und Simon Schröter d. Ä.
leitet Hentschel die Annahme ab, dass letzterer ein Verwandter des in
Leipzig 1508 und 1530 genannten Bildschnitzers Oswald Schröter war.
Simon d. Ä. wanderte vielleicht im Erzgebirge, weil sein Torgauer Schloß-
kapellenportal ohne die Kenntnis der Freiberger Tulpenkanzel oder des
Chemnitzer nördlichen Schlosskirchenportals, beides Werke um 1505 und
1525 des Meisters H. W., schwer verständlich erscheint. Es ist zu vermuten,
dass Simon selbst oder später auch sein Sohn Georg die Bekanntschaft
mit Werken von Hans Schenk gen. Scheußlich machten; die phantasie-
volle Raumgestaltung des Wiesenburger Altares und das verwendete Bas-
relief im Grabmalschaffen lässt in gewisser Weise darauf schließen. Die
neuen renaissancehaften Schmuckformen wurden wohl über Ch. Walther
inspiriert. Vielleicht war Simon d. Ä. sogar in dessen Werkstatt tätig. Je-
denfalls werden nur über diese Vermutung die Zuschreibungen des Epita-
phes für die A. v. Kommerstädt (gest. 1536) in Meißen und des Kanzel-
restes (?) in Reinersdorf bei Großenhain an ihn möglich. Seit 1529/30 ist
Simon d. Ä. in Torgau nachweisbar. Die Urkunden nennen ihn Tischler,
Bildhauer und Baumeister. Der erste Beleg seiner baukünstlerischen Tätig-
keit ist ein 1529/30 bezahltes „Muster". Danach dominiert jahrelang seine
bildhauerische Tätigkeit. Erst nach einem Unfall 1560, wobei er eine Hand
verlor, beaufsichtigte er Teile des Torgauer Rathausneubaues u.a.
14 Freiberg, Annenkapelle, Monhauptsche Madonna, datiert 1513, Franz
Maidburg zugeschrieben, und Freiberg, Dom, um 1505, Tulpenkanzel,
Meister H. W.
15 Im Unterschied zum Vater muss Georg Schröter einem umfänglichen
Werkstattbetrieb vorgestanden haben. Ähnlich groß waren die Werk-
stätten der Walther in Dresden, der Köhler in Meißen und der Lorentz in
Freiberg. Georgs Wanderung führte vermutlich in die Niederlande. Diese
Prägung unterscheidet sein Werk von dem des Vaters. Beider Handschrif-
ten zeigen sich aber bemerkenswert in keiner Weise von der italienisch
eingestellten Dresdner Kunst beeinflusst.
16 Die Kanzeln in Reinersdorf bei Großenhain (Rest?), des Schlosses Grimm-
stein 1553 in Gotha (zerstört), in Seußlitz (Reste) in der Schweriner Schloss-
kapelle, in Beedau bei Luckau und in Borna bei Oschatz.
17 In der Pfarrkirche zu Jößnitz bei Plauen befindet sich ein qualitätvolles,
etwa zwischen 1504 und 1509 entstandenes und der Cranachwerkstatt
zugeschriebenes Epitaphbild, welches auf eine gewölbte Holztafel gemalt
wurde.
18 Den Gebrüdern Gabriel und Benedikt Thola wird der Entwurf für das
Schlosskapellenportal und das Moritzmonument an den Befestigungsan-
lagen, beide in Dresden und 1555/56 und 1553 von der Waltherwerkstatt
gearbeitet, zugeschrieben.
19 Hentschel 1966.
20 Leitender Architekt beim Bau der Annenkirche in Annaberg war Jacob
Heilmann. Sein Mitarbeiter, Christoph Walther d. Ä., schuf hier vermutlich
nicht nur zwei geschnitzte Wandelaltäre 1516 und 1522, sondern auch
die Prophetenbüsten im Gewölbe der neuen Sakristei. Beide Meister ver-
pflichtete Herzog Georg sehr wahrscheinlich dann auch für eine verwand-
te Bauaufgabe in der Meißner Albrechtsburg.
21 Die Grabmale fügen sich nicht nur aus den zu beobachtenden verwand-
ten stilistischen Merkmalen zu einer Gruppe. Sie eint das besondere An-
124