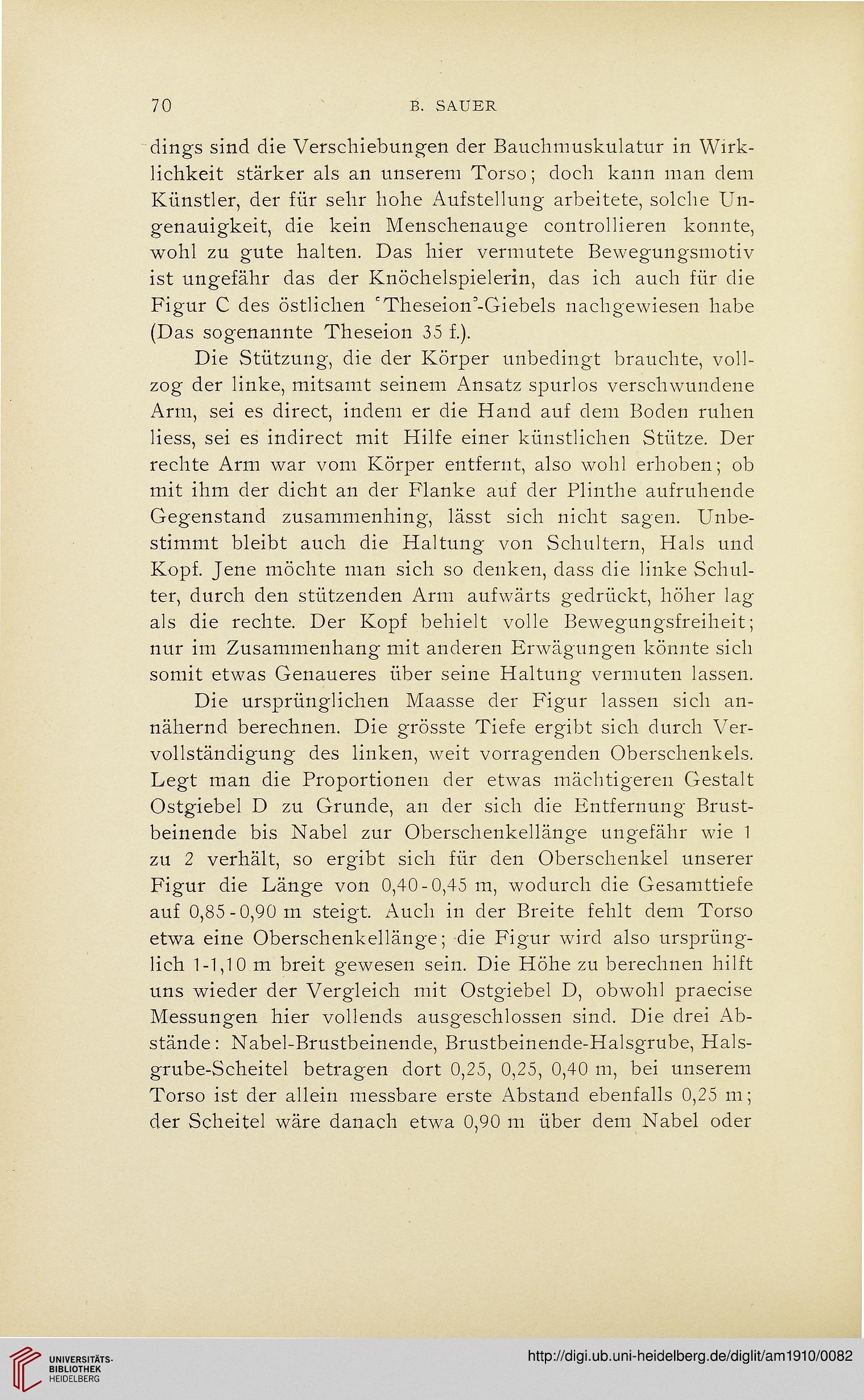70
B. SAUER
dings sind die Verschiebungen der Bauchmuskulatur in Wirk-
lichkeit stärker als an unserem Torso; doch kann man dem
Künstler, der für sehr hohe Aufstellung arbeitete, solche Un-
genauigkeit, die kein Menschenauge controllieren konnte,
wohl zu gute halten. Das hier vermutete Bewegungsmotiv
ist ungefähr das der Knöchelspielerin, das ich auch für die
Figur C des östlichen ‘Theseion’-Giebels nachgewiesen habe
(Das sogenannte Theseion 35 f.).
Die Stützung, die der Körper unbedingt brauchte, voll-
zog der linke, mitsamt seinem Ansatz spurlos verschwundene
Arm, sei es direct, indem er die Hand auf dem Boden ruhen
Hess, sei es indirect mit Hilfe einer künstlichen Stütze. Der
rechte Arm war vom Körper entfernt, also wohl erhoben; ob
mit ihm der dicht an der Flanke auf der Plinthe aufruhende
Gegenstand zusammenhing, lässt sich nicht sagen. Unbe-
stimmt bleibt auch die Haltung von Schultern, Hals und
Kopf. Jene möchte man sich so denken, dass die linke Schul-
ter, durch den stützenden Arm aufwärts gedrückt, höher lag
als die rechte. Der Kopf behielt volle Bewegungsfreiheit;
nur im Zusammenhang mit anderen Erwägungen könnte sich
somit etwas Genaueres über seine Haltung vermuten lassen.
Die ursprünglichen Maasse der Figur lassen sich an-
nähernd berechnen. Die grösste Tiefe ergibt sich durch Ver-
vollständigung des linken, weit vorragenden Oberschenkels.
Legt man die Proportionen der etwas mächtigeren Gestalt
Ostgiebel D zu Grunde, an der sich die Entfernung Brust-
beinende bis Nabel zur Oberschenkellänge ungefähr wie 1
zu 2 verhält, so ergibt sich für den Oberschenkel unserer
Figur die Länge von 0,40-0,45 m, wodurch die Gesamttiefe
auf 0,85-0,90 in steigt. Auch in der Breite fehlt dem Torso
etwa eine Oberschenkellänge; die Figur wird also ursprüng-
lich 1-1,10 m breit gewesen sein. Die Höhe zu berechnen hilft
uns wieder der Vergleich mit Ostgiebel D, obwohl praecise
Messungen hier vollends ausgeschlossen sind. Die drei Ab-
stände: Nabel-Brustbeinende, Brustbeinende-Halsgrube, Hals-
grube-Scheitel betragen dort 0,25, 0,25, 0,40 m, bei unserem
Torso ist der allein messbare erste Abstand ebenfalls 0,25 m;
der Scheitel wäre danach etwa 0,90 m über dem Nabel oder
B. SAUER
dings sind die Verschiebungen der Bauchmuskulatur in Wirk-
lichkeit stärker als an unserem Torso; doch kann man dem
Künstler, der für sehr hohe Aufstellung arbeitete, solche Un-
genauigkeit, die kein Menschenauge controllieren konnte,
wohl zu gute halten. Das hier vermutete Bewegungsmotiv
ist ungefähr das der Knöchelspielerin, das ich auch für die
Figur C des östlichen ‘Theseion’-Giebels nachgewiesen habe
(Das sogenannte Theseion 35 f.).
Die Stützung, die der Körper unbedingt brauchte, voll-
zog der linke, mitsamt seinem Ansatz spurlos verschwundene
Arm, sei es direct, indem er die Hand auf dem Boden ruhen
Hess, sei es indirect mit Hilfe einer künstlichen Stütze. Der
rechte Arm war vom Körper entfernt, also wohl erhoben; ob
mit ihm der dicht an der Flanke auf der Plinthe aufruhende
Gegenstand zusammenhing, lässt sich nicht sagen. Unbe-
stimmt bleibt auch die Haltung von Schultern, Hals und
Kopf. Jene möchte man sich so denken, dass die linke Schul-
ter, durch den stützenden Arm aufwärts gedrückt, höher lag
als die rechte. Der Kopf behielt volle Bewegungsfreiheit;
nur im Zusammenhang mit anderen Erwägungen könnte sich
somit etwas Genaueres über seine Haltung vermuten lassen.
Die ursprünglichen Maasse der Figur lassen sich an-
nähernd berechnen. Die grösste Tiefe ergibt sich durch Ver-
vollständigung des linken, weit vorragenden Oberschenkels.
Legt man die Proportionen der etwas mächtigeren Gestalt
Ostgiebel D zu Grunde, an der sich die Entfernung Brust-
beinende bis Nabel zur Oberschenkellänge ungefähr wie 1
zu 2 verhält, so ergibt sich für den Oberschenkel unserer
Figur die Länge von 0,40-0,45 m, wodurch die Gesamttiefe
auf 0,85-0,90 in steigt. Auch in der Breite fehlt dem Torso
etwa eine Oberschenkellänge; die Figur wird also ursprüng-
lich 1-1,10 m breit gewesen sein. Die Höhe zu berechnen hilft
uns wieder der Vergleich mit Ostgiebel D, obwohl praecise
Messungen hier vollends ausgeschlossen sind. Die drei Ab-
stände: Nabel-Brustbeinende, Brustbeinende-Halsgrube, Hals-
grube-Scheitel betragen dort 0,25, 0,25, 0,40 m, bei unserem
Torso ist der allein messbare erste Abstand ebenfalls 0,25 m;
der Scheitel wäre danach etwa 0,90 m über dem Nabel oder