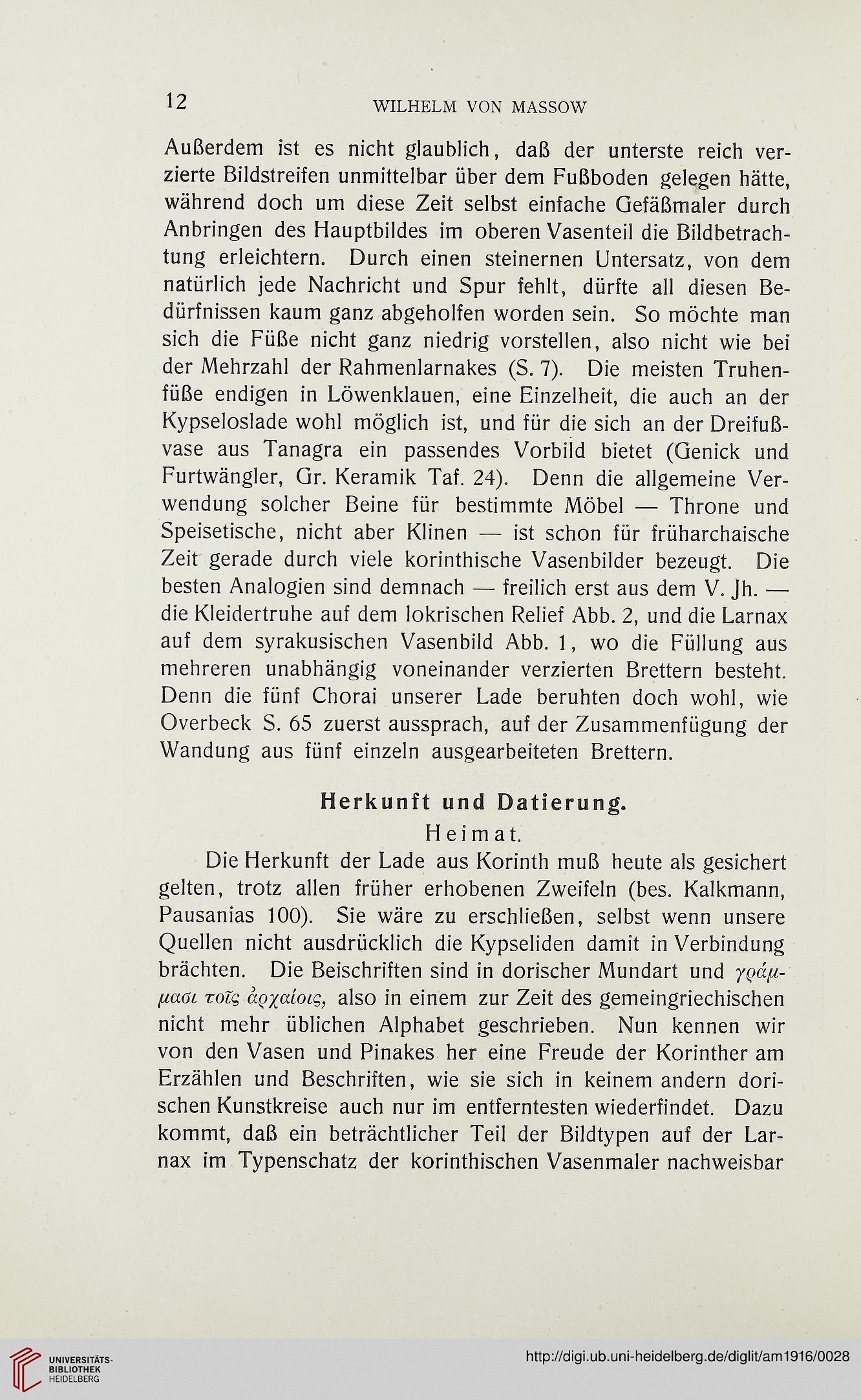12
WILHELM VON MASSOW
Außerdem ist es nicht glaublich, daß der unterste reich ver-
zierte Bildstreifen unmittelbar über dem Fußboden gelegen hätte,
während doch um diese Zeit selbst einfache Gefäßmaler durch
Anbringen des Hauptbildes im oberen Vasenteil die Bildbetrach-
tung erleichtern. Durch einen steinernen Untersatz, von dem
natürlich jede Nachricht und Spur fehlt, dürfte all diesen Be-
dürfnissen kaum ganz abgeholfen worden sein. So möchte man
sich die Füße nicht ganz niedrig vorstellen, also nicht wie bei
der Mehrzahl der Rahmenlarnakes (S. 7). Die meisten Truhen-
füße endigen in Löwenklauen, eine Einzelheit, die auch an der
Kypseloslade wohl möglich ist, und für die sich an der Dreifuß-
vase aus Tanagra ein passendes Vorbild bietet (Genick und
Furtwängler, Gr. Keramik Taf. 24). Denn die allgemeine Ver-
wendung solcher Beine für bestimmte Möbel — Throne und
Speisetische, nicht aber Klinen — ist schon für früharchaische
Zeit gerade durch viele korinthische Vasenbilder bezeugt. Die
besten Analogien sind demnach — freilich erst aus dem V. Jh. —
die Kleidertruhe auf dem lokrischen Relief Abb. 2, und die Larnax
auf dem syrakusischen Vasenbild Abb. 1, wo die Füllung aus
mehreren unabhängig voneinander verzierten Brettern besteht.
Denn die fünf Chorai unserer Lade beruhten doch wohl, wie
Overbeck S. 65 zuerst aussprach, auf der Zusammenfügung der
Wandung aus fünf einzeln ausgearbeiteten Brettern.
Herkunft und Datierung.
Heimat.
Die Herkunft der Lade aus Korinth muß heute als gesichert
gelten, trotz allen früher erhobenen Zweifeln (bes. Kalkmann,
Pausanias 100). Sie wäre zu erschließen, selbst wenn unsere
Quellen nicht ausdrücklich die Kypseliden damit in Verbindung
brächten. Die Beischriften sind in dorischer Mundart und ygdfi-
[iaöL roZq ccQxcdoig, also in einem zur Zeit des gemeingriechischen
nicht mehr üblichen Alphabet geschrieben. Nun kennen wir
von den Vasen und Pinakes her eine Freude der Korinther am
Erzählen und Beschriften, wie sie sich in keinem andern dori-
schen Kunstkreise auch nur im entferntesten wiederfindet. Dazu
kommt, daß ein beträchtlicher Teil der Bildtypen auf der Lar-
nax im Typenschatz der korinthischen Vasenmaler nachweisbar
WILHELM VON MASSOW
Außerdem ist es nicht glaublich, daß der unterste reich ver-
zierte Bildstreifen unmittelbar über dem Fußboden gelegen hätte,
während doch um diese Zeit selbst einfache Gefäßmaler durch
Anbringen des Hauptbildes im oberen Vasenteil die Bildbetrach-
tung erleichtern. Durch einen steinernen Untersatz, von dem
natürlich jede Nachricht und Spur fehlt, dürfte all diesen Be-
dürfnissen kaum ganz abgeholfen worden sein. So möchte man
sich die Füße nicht ganz niedrig vorstellen, also nicht wie bei
der Mehrzahl der Rahmenlarnakes (S. 7). Die meisten Truhen-
füße endigen in Löwenklauen, eine Einzelheit, die auch an der
Kypseloslade wohl möglich ist, und für die sich an der Dreifuß-
vase aus Tanagra ein passendes Vorbild bietet (Genick und
Furtwängler, Gr. Keramik Taf. 24). Denn die allgemeine Ver-
wendung solcher Beine für bestimmte Möbel — Throne und
Speisetische, nicht aber Klinen — ist schon für früharchaische
Zeit gerade durch viele korinthische Vasenbilder bezeugt. Die
besten Analogien sind demnach — freilich erst aus dem V. Jh. —
die Kleidertruhe auf dem lokrischen Relief Abb. 2, und die Larnax
auf dem syrakusischen Vasenbild Abb. 1, wo die Füllung aus
mehreren unabhängig voneinander verzierten Brettern besteht.
Denn die fünf Chorai unserer Lade beruhten doch wohl, wie
Overbeck S. 65 zuerst aussprach, auf der Zusammenfügung der
Wandung aus fünf einzeln ausgearbeiteten Brettern.
Herkunft und Datierung.
Heimat.
Die Herkunft der Lade aus Korinth muß heute als gesichert
gelten, trotz allen früher erhobenen Zweifeln (bes. Kalkmann,
Pausanias 100). Sie wäre zu erschließen, selbst wenn unsere
Quellen nicht ausdrücklich die Kypseliden damit in Verbindung
brächten. Die Beischriften sind in dorischer Mundart und ygdfi-
[iaöL roZq ccQxcdoig, also in einem zur Zeit des gemeingriechischen
nicht mehr üblichen Alphabet geschrieben. Nun kennen wir
von den Vasen und Pinakes her eine Freude der Korinther am
Erzählen und Beschriften, wie sie sich in keinem andern dori-
schen Kunstkreise auch nur im entferntesten wiederfindet. Dazu
kommt, daß ein beträchtlicher Teil der Bildtypen auf der Lar-
nax im Typenschatz der korinthischen Vasenmaler nachweisbar