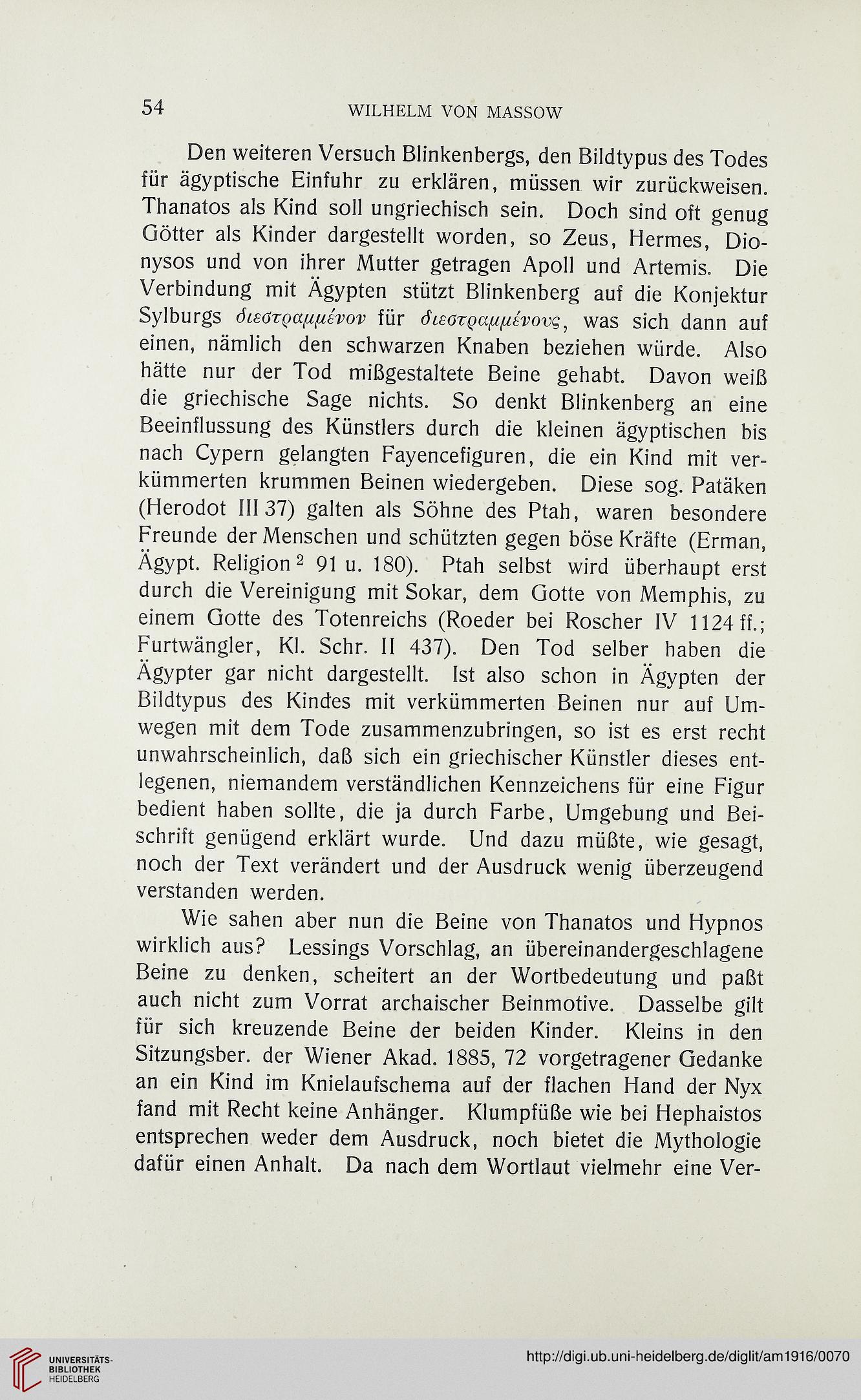54
WILHELM VON MASSOW
Den weiteren Versuch Blinkenbergs, den Bildtypus des Todes
für ägyptische Einfuhr zu erklären, müssen wir zurückweisen.
Thanatos als Kind soll ungriechisch sein. Doch sind oft genug
Götter als Kinder dargestellt worden, so Zeus, Hermes, Dio-
nysos und von ihrer Mutter getragen Apoll und Artemis. Die
Verbindung mit Ägypten stützt Blinkenberg auf die Konjektur
Sylburgs disöTQaftfitvov für ÖLsOTQafifiivovg^ was sich dann auf
einen, nämlich den schwarzen Knaben beziehen würde. Also
hätte nur der Tod mißgestaltete Beine gehabt. Davon weiß
die griechische Sage nichts. So denkt Blinkenberg an eine
Beeinflussung des Künstlers durch die kleinen ägyptischen bis
nach Cypern gelangten Fayencefiguren, die ein Kind mit ver-
kümmerten krummen Beinen wiedergeben. Diese sog. Patäken
(Herodot 11137) galten als Söhne des Ptah, waren besondere
Freunde der Menschen und schützten gegen böse Kräfte (Erman,
Ägypt. Religion2 91 u. 180). Ptah selbst wird überhaupt erst
durch die Vereinigung mit Sokar, dem Gotte von Memphis, zu
einem Gotte des Totenreichs (Roeder bei Roscher IV 1124 ff.;
Furtwängler, Kl. Sehr. II 437). Den Tod selber haben die
Ägypter gar nicht dargestellt. Ist also schon in Ägypten der
Bildtypus des Kindes mit verkümmerten Beinen nur auf Um-
wegen mit dem Tode zusammenzubringen, so ist es erst recht
unwahrscheinlich, daß sich ein griechischer Künstler dieses ent-
legenen, niemandem verständlichen Kennzeichens für eine Figur
bedient haben sollte, die ja durch Farbe, Umgebung und Bei-
schrift genügend erklärt wurde. Und dazu müßte, wie gesagt,
noch der Text verändert und der Ausdruck wenig überzeugend
verstanden werden.
Wie sahen aber nun die Beine von Thanatos und Hypnos
wirklich aus? Lessings Vorschlag, an übereinandergeschlagene
Beine zu denken, scheitert an der Wortbedeutung und paßt
auch nicht zum Vorrat archaischer Beinmotive. Dasselbe gilt
für sich kreuzende Beine der beiden Kinder. Kleins in den
Sitzungsber. der Wiener Akad. 1885, 72 vorgetragener Gedanke
an ein Kind im Knielaufschema auf der flachen Hand der Nyx
fand mit Recht keine Anhänger. Klumpfüße wie bei Hephaistos
entsprechen weder dem Ausdruck, noch bietet die Mythologie
dafür einen Anhalt. Da nach dem Wortlaut vielmehr eine Ver-
WILHELM VON MASSOW
Den weiteren Versuch Blinkenbergs, den Bildtypus des Todes
für ägyptische Einfuhr zu erklären, müssen wir zurückweisen.
Thanatos als Kind soll ungriechisch sein. Doch sind oft genug
Götter als Kinder dargestellt worden, so Zeus, Hermes, Dio-
nysos und von ihrer Mutter getragen Apoll und Artemis. Die
Verbindung mit Ägypten stützt Blinkenberg auf die Konjektur
Sylburgs disöTQaftfitvov für ÖLsOTQafifiivovg^ was sich dann auf
einen, nämlich den schwarzen Knaben beziehen würde. Also
hätte nur der Tod mißgestaltete Beine gehabt. Davon weiß
die griechische Sage nichts. So denkt Blinkenberg an eine
Beeinflussung des Künstlers durch die kleinen ägyptischen bis
nach Cypern gelangten Fayencefiguren, die ein Kind mit ver-
kümmerten krummen Beinen wiedergeben. Diese sog. Patäken
(Herodot 11137) galten als Söhne des Ptah, waren besondere
Freunde der Menschen und schützten gegen böse Kräfte (Erman,
Ägypt. Religion2 91 u. 180). Ptah selbst wird überhaupt erst
durch die Vereinigung mit Sokar, dem Gotte von Memphis, zu
einem Gotte des Totenreichs (Roeder bei Roscher IV 1124 ff.;
Furtwängler, Kl. Sehr. II 437). Den Tod selber haben die
Ägypter gar nicht dargestellt. Ist also schon in Ägypten der
Bildtypus des Kindes mit verkümmerten Beinen nur auf Um-
wegen mit dem Tode zusammenzubringen, so ist es erst recht
unwahrscheinlich, daß sich ein griechischer Künstler dieses ent-
legenen, niemandem verständlichen Kennzeichens für eine Figur
bedient haben sollte, die ja durch Farbe, Umgebung und Bei-
schrift genügend erklärt wurde. Und dazu müßte, wie gesagt,
noch der Text verändert und der Ausdruck wenig überzeugend
verstanden werden.
Wie sahen aber nun die Beine von Thanatos und Hypnos
wirklich aus? Lessings Vorschlag, an übereinandergeschlagene
Beine zu denken, scheitert an der Wortbedeutung und paßt
auch nicht zum Vorrat archaischer Beinmotive. Dasselbe gilt
für sich kreuzende Beine der beiden Kinder. Kleins in den
Sitzungsber. der Wiener Akad. 1885, 72 vorgetragener Gedanke
an ein Kind im Knielaufschema auf der flachen Hand der Nyx
fand mit Recht keine Anhänger. Klumpfüße wie bei Hephaistos
entsprechen weder dem Ausdruck, noch bietet die Mythologie
dafür einen Anhalt. Da nach dem Wortlaut vielmehr eine Ver-