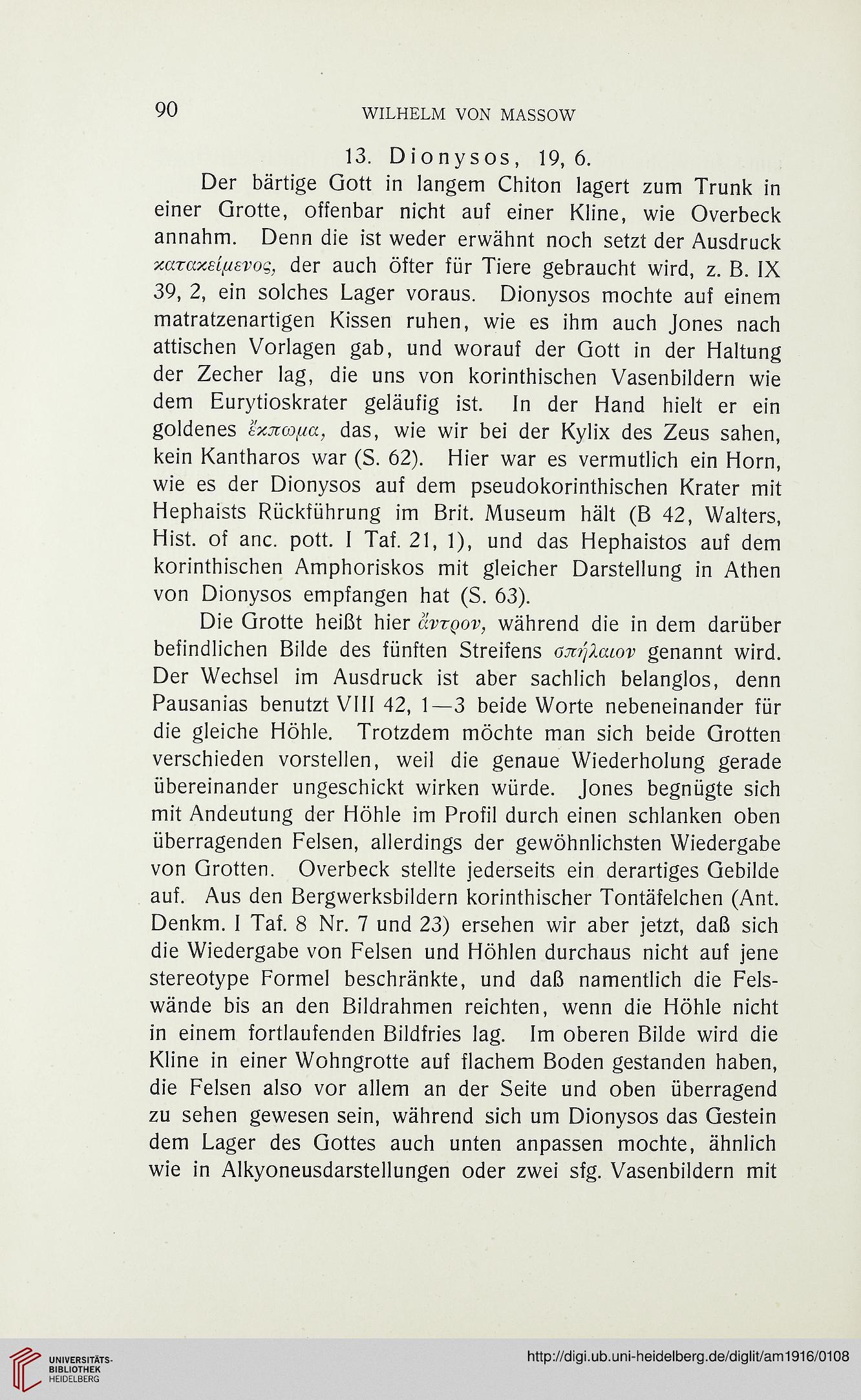90
WILHELM VON MASSOW
13. Dionysos, 19, 6.
Der bärtige Gott in langem Chiton lagert zum Trunk in
einer Grotte, offenbar nicht auf einer Kline, wie Overbeck
annahm. Denn die ist weder erwähnt noch setzt der Ausdruck
xazaxelfievoq, der auch öfter für Tiere gebraucht wird, z. B. IX
39, 2, ein solches Lager voraus. Dionysos mochte auf einem
matratzenartigen Kissen ruhen, wie es ihm auch Jones nach
attischen Vorlagen gab, und worauf der Gott in der Haltung
der Zecher lag, die uns von korinthischen Vasenbildern wie
dem Eurytioskrater geläufig ist. In der Hand hielt er ein
goldenes exjccofia, das, wie wir bei der Kylix des Zeus sahen,
kein Kantharos war (S. 62). Hier war es vermutlich ein Horn,
wie es der Dionysos auf dem pseudokorinthischen Krater mit
Hephaists Rückführung im Brit. Museum hält (B 42, Walters,
Hist, of anc. pott. I Taf. 21, 1), und das Hephaistos auf dem
korinthischen Amphoriskos mit gleicher Darstellung in Athen
von Dionysos empfangen hat (S. 63).
Die Grotte heißt hier olvtqov, während die in dem darüber
befindlichen Bilde des fünften Streifens öjtr/laiov genannt wird.
Der Wechsel im Ausdruck ist aber sachlich belanglos, denn
Pausanias benutzt VIII 42, 1—3 beide Worte nebeneinander für
die gleiche Höhle. Trotzdem möchte man sich beide Grotten
verschieden vorstellen, weil die genaue Wiederholung gerade
übereinander ungeschickt wirken würde. Jones begnügte sich
mit Andeutung der Höhle im Profil durch einen schlanken oben
überragenden Felsen, allerdings der gewöhnlichsten Wiedergabe
von Grotten. Overbeck stellte jederseits ein derartiges Gebilde
auf. Aus den Bergwerksbildern korinthischer Tontäfelchen (Ant.
Denkm. I Taf. 8 Nr. 7 und 23) ersehen wir aber jetzt, daß sich
die Wiedergabe von Felsen und Höhlen durchaus nicht auf jene
stereotype Formel beschränkte, und daß namentlich die Fels-
wände bis an den Bildrahmen reichten, wenn die Höhle nicht
in einem fortlaufenden Bildfries lag. Im oberen Bilde wird die
Kline in einer Wohngrotte auf flachem Boden gestanden haben,
die Felsen also vor allem an der Seite und oben überragend
zu sehen gewesen sein, während sich um Dionysos das Gestein
dem Lager des Gottes auch unten anpassen mochte, ähnlich
wie in Alkyoneusdarstellungen oder zwei sfg. Vasenbildern mit
WILHELM VON MASSOW
13. Dionysos, 19, 6.
Der bärtige Gott in langem Chiton lagert zum Trunk in
einer Grotte, offenbar nicht auf einer Kline, wie Overbeck
annahm. Denn die ist weder erwähnt noch setzt der Ausdruck
xazaxelfievoq, der auch öfter für Tiere gebraucht wird, z. B. IX
39, 2, ein solches Lager voraus. Dionysos mochte auf einem
matratzenartigen Kissen ruhen, wie es ihm auch Jones nach
attischen Vorlagen gab, und worauf der Gott in der Haltung
der Zecher lag, die uns von korinthischen Vasenbildern wie
dem Eurytioskrater geläufig ist. In der Hand hielt er ein
goldenes exjccofia, das, wie wir bei der Kylix des Zeus sahen,
kein Kantharos war (S. 62). Hier war es vermutlich ein Horn,
wie es der Dionysos auf dem pseudokorinthischen Krater mit
Hephaists Rückführung im Brit. Museum hält (B 42, Walters,
Hist, of anc. pott. I Taf. 21, 1), und das Hephaistos auf dem
korinthischen Amphoriskos mit gleicher Darstellung in Athen
von Dionysos empfangen hat (S. 63).
Die Grotte heißt hier olvtqov, während die in dem darüber
befindlichen Bilde des fünften Streifens öjtr/laiov genannt wird.
Der Wechsel im Ausdruck ist aber sachlich belanglos, denn
Pausanias benutzt VIII 42, 1—3 beide Worte nebeneinander für
die gleiche Höhle. Trotzdem möchte man sich beide Grotten
verschieden vorstellen, weil die genaue Wiederholung gerade
übereinander ungeschickt wirken würde. Jones begnügte sich
mit Andeutung der Höhle im Profil durch einen schlanken oben
überragenden Felsen, allerdings der gewöhnlichsten Wiedergabe
von Grotten. Overbeck stellte jederseits ein derartiges Gebilde
auf. Aus den Bergwerksbildern korinthischer Tontäfelchen (Ant.
Denkm. I Taf. 8 Nr. 7 und 23) ersehen wir aber jetzt, daß sich
die Wiedergabe von Felsen und Höhlen durchaus nicht auf jene
stereotype Formel beschränkte, und daß namentlich die Fels-
wände bis an den Bildrahmen reichten, wenn die Höhle nicht
in einem fortlaufenden Bildfries lag. Im oberen Bilde wird die
Kline in einer Wohngrotte auf flachem Boden gestanden haben,
die Felsen also vor allem an der Seite und oben überragend
zu sehen gewesen sein, während sich um Dionysos das Gestein
dem Lager des Gottes auch unten anpassen mochte, ähnlich
wie in Alkyoneusdarstellungen oder zwei sfg. Vasenbildern mit