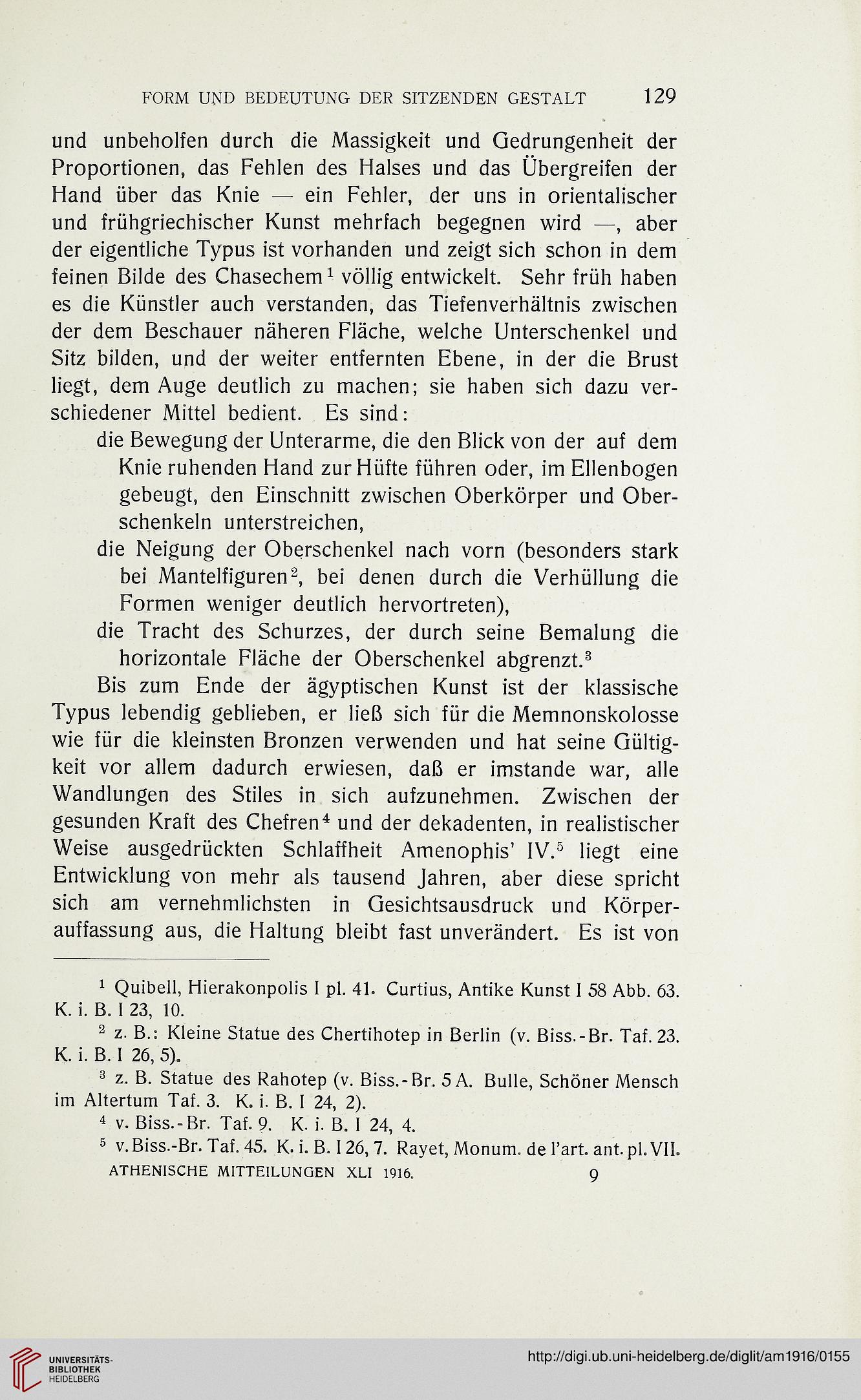FORM UND BEDEUTUNG DER SITZENDEN GESTALT 129
und unbeholfen durch die Massigkeit und Gedrungenheit der
Proportionen, das Fehlen des Halses und das Übergreifen der
Hand über das Knie — ein Fehler, der uns in orientalischer
und frühgriechischer Kunst mehrfach begegnen wird —, aber
der eigentliche Typus ist vorhanden und zeigt sich schon in dem
feinen Bilde des Chasechem1 völlig entwickelt. Sehr früh haben
es die Künstler auch verstanden, das Tiefenverhältnis zwischen
der dem Beschauer näheren Fläche, welche Unterschenkel und
Sitz bilden, und der weiter entfernten Ebene, in der die Brust
liegt, dem Auge deutlich zu machen; sie haben sich dazu ver-
schiedener Mittel bedient. Es sind:
die Bewegung der Unterarme, die den Blick von der auf dem
Knie ruhenden Hand zur Hüfte führen oder, im Ellenbogen
gebeugt, den Einschnitt zwischen Oberkörper und Ober-
schenkeln unterstreichen,
die Neigung der Oberschenkel nach vorn (besonders stark
bei Mantelfiguren2, bei denen durch die Verhüllung die
Formen weniger deutlich hervortreten),
die Tracht des Schurzes, der durch seine Bemalung die
horizontale Fläche der Oberschenkel abgrenzt.3
Bis zum Ende der ägyptischen Kunst ist der klassische
Typus lebendig geblieben, er ließ sich für die Memnonskolosse
wie für die kleinsten Bronzen verwenden und hat seine Gültig-
keit vor allem dadurch erwiesen, daß er imstande war, alle
Wandlungen des Stiles in sich aufzunehmen. Zwischen der
gesunden Kraft des Chefren4 und der dekadenten, in realistischer
Weise ausgedrückten Schlaffheit Amenophis’ IV.5 liegt eine
Entwicklung von mehr als tausend Jahren, aber diese spricht
sich am vernehmlichsten in Gesichtsausdruck und Körper-
auffassung aus, die Haltung bleibt fast unverändert. Es ist von
1 Quibell, Hierakonpolis I pl. 41. Curtius, Antike Kunst I 58 Abb. 63.
K. i. B. 1 23, 10.
2 z. B.: Kleine Statue des Chertihotep in Berlin (v. Biss.-Br. Taf. 23.
K. i. B. I 26, 5).
3 z. B. Statue des Rahotep (v. Biss.-Br. 5 A. Bulle, Schöner Mensch
im Altertum Taf. 3. K. i. B. I 24, 2).
4 v. Biss.-Br. Taf. 9. K. i. B. I 24, 4.
5 v. Biss.-Br. Taf. 45. K. i. B. I 26, 7. Rayet, Monum. de l’art. ant. pl. VI1.
ATHENISCHE MITTEILUNGEN XLI 1916. 9
und unbeholfen durch die Massigkeit und Gedrungenheit der
Proportionen, das Fehlen des Halses und das Übergreifen der
Hand über das Knie — ein Fehler, der uns in orientalischer
und frühgriechischer Kunst mehrfach begegnen wird —, aber
der eigentliche Typus ist vorhanden und zeigt sich schon in dem
feinen Bilde des Chasechem1 völlig entwickelt. Sehr früh haben
es die Künstler auch verstanden, das Tiefenverhältnis zwischen
der dem Beschauer näheren Fläche, welche Unterschenkel und
Sitz bilden, und der weiter entfernten Ebene, in der die Brust
liegt, dem Auge deutlich zu machen; sie haben sich dazu ver-
schiedener Mittel bedient. Es sind:
die Bewegung der Unterarme, die den Blick von der auf dem
Knie ruhenden Hand zur Hüfte führen oder, im Ellenbogen
gebeugt, den Einschnitt zwischen Oberkörper und Ober-
schenkeln unterstreichen,
die Neigung der Oberschenkel nach vorn (besonders stark
bei Mantelfiguren2, bei denen durch die Verhüllung die
Formen weniger deutlich hervortreten),
die Tracht des Schurzes, der durch seine Bemalung die
horizontale Fläche der Oberschenkel abgrenzt.3
Bis zum Ende der ägyptischen Kunst ist der klassische
Typus lebendig geblieben, er ließ sich für die Memnonskolosse
wie für die kleinsten Bronzen verwenden und hat seine Gültig-
keit vor allem dadurch erwiesen, daß er imstande war, alle
Wandlungen des Stiles in sich aufzunehmen. Zwischen der
gesunden Kraft des Chefren4 und der dekadenten, in realistischer
Weise ausgedrückten Schlaffheit Amenophis’ IV.5 liegt eine
Entwicklung von mehr als tausend Jahren, aber diese spricht
sich am vernehmlichsten in Gesichtsausdruck und Körper-
auffassung aus, die Haltung bleibt fast unverändert. Es ist von
1 Quibell, Hierakonpolis I pl. 41. Curtius, Antike Kunst I 58 Abb. 63.
K. i. B. 1 23, 10.
2 z. B.: Kleine Statue des Chertihotep in Berlin (v. Biss.-Br. Taf. 23.
K. i. B. I 26, 5).
3 z. B. Statue des Rahotep (v. Biss.-Br. 5 A. Bulle, Schöner Mensch
im Altertum Taf. 3. K. i. B. I 24, 2).
4 v. Biss.-Br. Taf. 9. K. i. B. I 24, 4.
5 v. Biss.-Br. Taf. 45. K. i. B. I 26, 7. Rayet, Monum. de l’art. ant. pl. VI1.
ATHENISCHE MITTEILUNGEN XLI 1916. 9