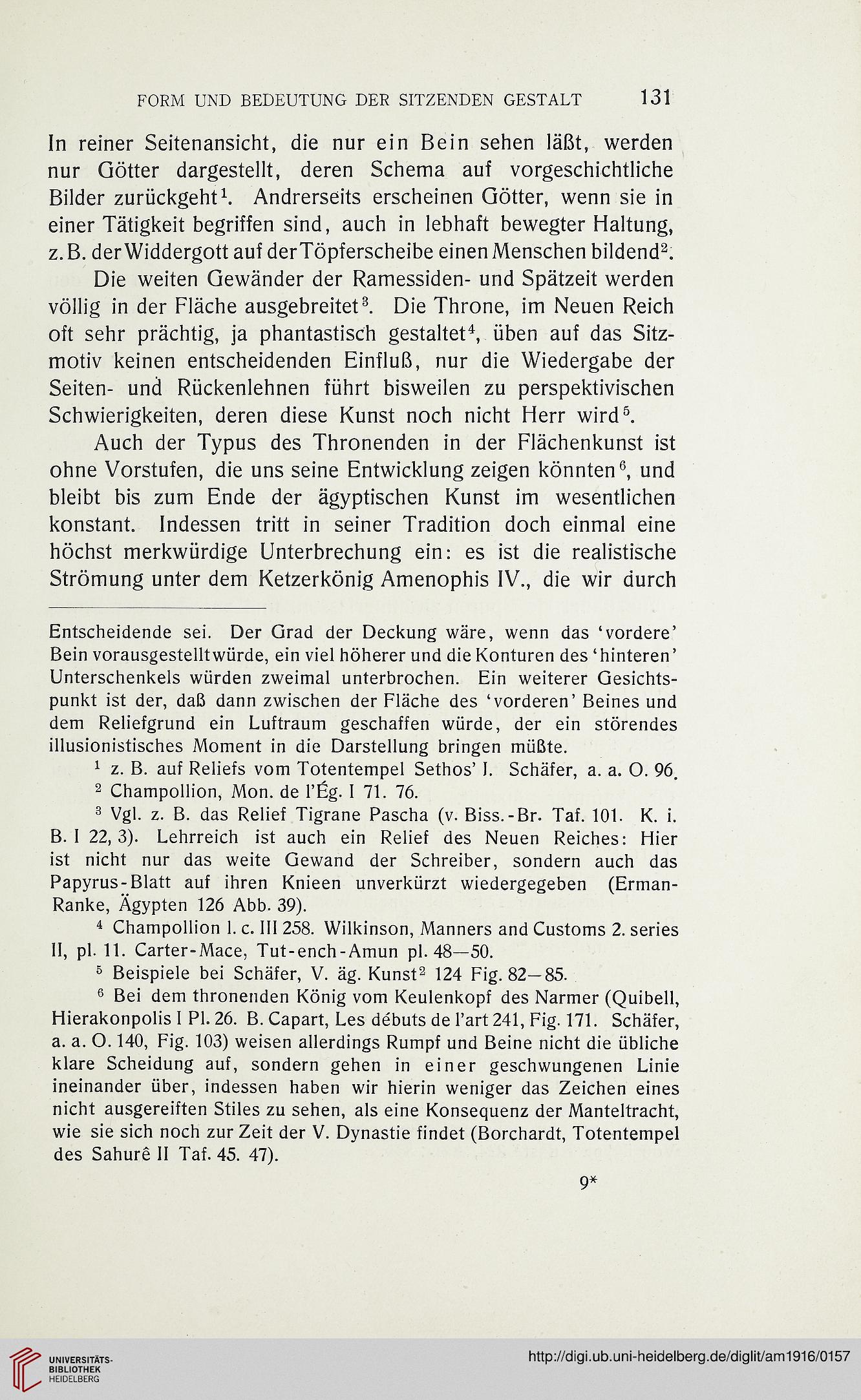FORM UND BEDEUTUNG DER SITZENDEN GESTALT
131
In reiner Seitenansicht, die nur ein Bein sehen läßt, werden
nur Götter dargestellt, deren Schema auf vorgeschichtliche
Bilder zurückgeht* 1. Andrerseits erscheinen Götter, wenn sie in
einer Tätigkeit begriffen sind, auch in lebhaft bewegter Haltung,
z. B. der Widdergott auf derTöpferscheibe einen Menschen bildend2.
Die weiten Gewänder der Ramessiden- und Spätzeit werden
völlig in der Fläche ausgebreitet3. Die Throne, im Neuen Reich
oft sehr prächtig, ja phantastisch gestaltet4, üben auf das Sitz-
motiv keinen entscheidenden Einfluß, nur die Wiedergabe der
Seiten- und Rückenlehnen führt bisweilen zu perspektivischen
Schwierigkeiten, deren diese Kunst noch nicht Herr wird5.
Auch der Typus des Thronenden in der Flächenkunst ist
ohne Vorstufen, die uns seine Entwicklung zeigen könnten6, und
bleibt bis zum Ende der ägyptischen Kunst im wesentlichen
konstant. Indessen tritt in seiner Tradition doch einmal eine
höchst merkwürdige Unterbrechung ein: es ist die realistische
Strömung unter dem Ketzerkönig Amenophis IV., die wir durch
Entscheidende sei. Der Grad der Deckung wäre, wenn das ‘vordere’
Bein vorausgestelltwürde, ein viel höherer und die Konturen des ‘hinteren’
Unterschenkels würden zweimal unterbrochen. Ein weiterer Gesichts-
punkt ist der, daß dann zwischen der Fläche des ‘vorderen’ Beines und
dem Reliefgrund ein Luftraum geschaffen würde, der ein störendes
illusionistisches Moment in die Darstellung bringen müßte.
1 z. B. auf Reliefs vom Totentempel Sethos’ I. Schäfer, a. a. O. 96.
2 Champollion, Mon. de l’Eg. 1 71. 76.
3 Vgl. z. B. das Relief Tigrane Pascha (v. Biss.-Br. Taf. 101. K. i.
B. I 22,3). Lehrreich ist auch ein Relief des Neuen Reiches: Hier
ist nicht nur das weite Gewand der Schreiber, sondern auch das
Papyrus-Blatt auf ihren Knieen unverkürzt wiedergegeben (Erman-
Ranke, Ägypten 126 Abb. 39).
4 Champollion 1. c. III 258. Wilkinson, Manners and Customs 2. series
II, pl. 11. Carter-Mace, Tut-ench-Amun pl. 48—50.
5 Beispiele bei Schäfer, V. äg. Kunst2 124 Fig. 82— 85.
6 Bei dem thronenden König vom Keulenkopf des Narmer (Quibell,
Hierakonpolis I Pl. 26. B. Capart, Les debuts de l’art 241, Fig. 171. Schäfer,
a. a. 0.140, Fig. 103) weisen allerdings Rumpf und Beine nicht die übliche
klare Scheidung auf, sondern gehen in einer geschwungenen Linie
ineinander über, indessen haben wir hierin weniger das Zeichen eines
nicht ausgereiften Stiles zu sehen, als eine Konsequenz der Manteltracht,
wie sie sich noch zur Zeit der V. Dynastie findet (Borchardt, Totentempel
des Sahure II Taf. 45. 47).
9*
131
In reiner Seitenansicht, die nur ein Bein sehen läßt, werden
nur Götter dargestellt, deren Schema auf vorgeschichtliche
Bilder zurückgeht* 1. Andrerseits erscheinen Götter, wenn sie in
einer Tätigkeit begriffen sind, auch in lebhaft bewegter Haltung,
z. B. der Widdergott auf derTöpferscheibe einen Menschen bildend2.
Die weiten Gewänder der Ramessiden- und Spätzeit werden
völlig in der Fläche ausgebreitet3. Die Throne, im Neuen Reich
oft sehr prächtig, ja phantastisch gestaltet4, üben auf das Sitz-
motiv keinen entscheidenden Einfluß, nur die Wiedergabe der
Seiten- und Rückenlehnen führt bisweilen zu perspektivischen
Schwierigkeiten, deren diese Kunst noch nicht Herr wird5.
Auch der Typus des Thronenden in der Flächenkunst ist
ohne Vorstufen, die uns seine Entwicklung zeigen könnten6, und
bleibt bis zum Ende der ägyptischen Kunst im wesentlichen
konstant. Indessen tritt in seiner Tradition doch einmal eine
höchst merkwürdige Unterbrechung ein: es ist die realistische
Strömung unter dem Ketzerkönig Amenophis IV., die wir durch
Entscheidende sei. Der Grad der Deckung wäre, wenn das ‘vordere’
Bein vorausgestelltwürde, ein viel höherer und die Konturen des ‘hinteren’
Unterschenkels würden zweimal unterbrochen. Ein weiterer Gesichts-
punkt ist der, daß dann zwischen der Fläche des ‘vorderen’ Beines und
dem Reliefgrund ein Luftraum geschaffen würde, der ein störendes
illusionistisches Moment in die Darstellung bringen müßte.
1 z. B. auf Reliefs vom Totentempel Sethos’ I. Schäfer, a. a. O. 96.
2 Champollion, Mon. de l’Eg. 1 71. 76.
3 Vgl. z. B. das Relief Tigrane Pascha (v. Biss.-Br. Taf. 101. K. i.
B. I 22,3). Lehrreich ist auch ein Relief des Neuen Reiches: Hier
ist nicht nur das weite Gewand der Schreiber, sondern auch das
Papyrus-Blatt auf ihren Knieen unverkürzt wiedergegeben (Erman-
Ranke, Ägypten 126 Abb. 39).
4 Champollion 1. c. III 258. Wilkinson, Manners and Customs 2. series
II, pl. 11. Carter-Mace, Tut-ench-Amun pl. 48—50.
5 Beispiele bei Schäfer, V. äg. Kunst2 124 Fig. 82— 85.
6 Bei dem thronenden König vom Keulenkopf des Narmer (Quibell,
Hierakonpolis I Pl. 26. B. Capart, Les debuts de l’art 241, Fig. 171. Schäfer,
a. a. 0.140, Fig. 103) weisen allerdings Rumpf und Beine nicht die übliche
klare Scheidung auf, sondern gehen in einer geschwungenen Linie
ineinander über, indessen haben wir hierin weniger das Zeichen eines
nicht ausgereiften Stiles zu sehen, als eine Konsequenz der Manteltracht,
wie sie sich noch zur Zeit der V. Dynastie findet (Borchardt, Totentempel
des Sahure II Taf. 45. 47).
9*