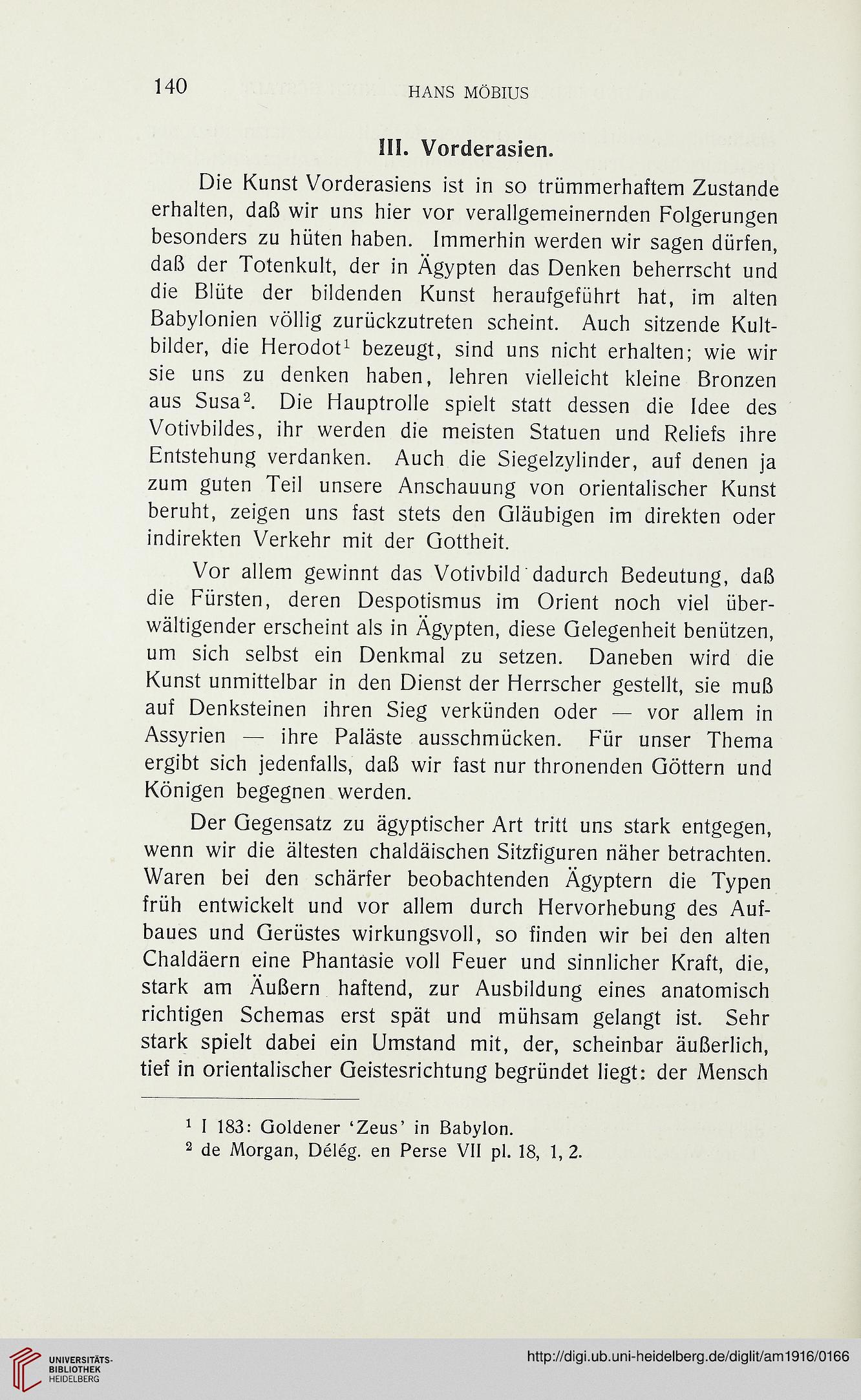140
HANS MÖBIUS
III. Vorderasien.
Die Kunst Vorderasiens ist in so trümmerhaftem Zustande
erhalten, daß wir uns hier vor verallgemeinernden Folgerungen
besonders zu hüten haben. Immerhin werden wir sagen dürfen,
daß der Totenkult, der in Ägypten das Denken beherrscht und
die Blüte der bildenden Kunst heraufgeführt hat, im alten
Babylonien völlig zurückzutreten scheint. Auch sitzende Kult-
bilder, die Herodot1 bezeugt, sind uns nicht erhalten; wie wir
sie uns zu denken haben, lehren vielleicht kleine Bronzen
aus Susa2. Die Hauptrolle spielt statt dessen die Idee des
Votivbildes, ihr werden die meisten Statuen und Reliefs ihre
Entstehung verdanken. Auch die Siegelzylinder, auf denen ja
zum guten Teil unsere Anschauung von orientalischer Kunst
beruht, zeigen uns fast stets den Gläubigen im direkten oder
indirekten Verkehr mit der Gottheit.
Vor allem gewinnt das Votivbild dadurch Bedeutung, daß
die Fürsten, deren Despotismus im Orient noch viel über-
wältigender erscheint als in Ägypten, diese Gelegenheit benützen,
um sich selbst ein Denkmal zu setzen. Daneben wird die
Kunst unmittelbar in den Dienst der Herrscher gestellt, sie muß
auf Denksteinen ihren Sieg verkünden oder — vor allem in
Assyrien — ihre Paläste ausschmücken. Für unser Thema
ergibt sich jedenfalls, daß wir fast nur thronenden Göttern und
Königen begegnen werden.
Der Gegensatz zu ägyptischer Art tritt uns stark entgegen,
wenn wir die ältesten chaldäischen Sitzfiguren näher betrachten.
Waren bei den schärfer beobachtenden Ägyptern die Typen
früh entwickelt und vor allem durch Hervorhebung des Auf-
baues und Gerüstes wirkungsvoll, so finden wir bei den alten
Chaldäern eine Phantasie voll Feuer und sinnlicher Kraft, die,
stark am Äußern haftend, zur Ausbildung eines anatomisch
richtigen Schemas erst spät und mühsam gelangt ist. Sehr
stark spielt dabei ein Umstand mit, der, scheinbar äußerlich,
tief in orientalischer Geistesrichtung begründet liegt: der Mensch
1 1 183: Goldener ‘Zeus’ in Babylon.
2 de Morgan, Deleg. en Perse VII pl. 18, 1, 2.
HANS MÖBIUS
III. Vorderasien.
Die Kunst Vorderasiens ist in so trümmerhaftem Zustande
erhalten, daß wir uns hier vor verallgemeinernden Folgerungen
besonders zu hüten haben. Immerhin werden wir sagen dürfen,
daß der Totenkult, der in Ägypten das Denken beherrscht und
die Blüte der bildenden Kunst heraufgeführt hat, im alten
Babylonien völlig zurückzutreten scheint. Auch sitzende Kult-
bilder, die Herodot1 bezeugt, sind uns nicht erhalten; wie wir
sie uns zu denken haben, lehren vielleicht kleine Bronzen
aus Susa2. Die Hauptrolle spielt statt dessen die Idee des
Votivbildes, ihr werden die meisten Statuen und Reliefs ihre
Entstehung verdanken. Auch die Siegelzylinder, auf denen ja
zum guten Teil unsere Anschauung von orientalischer Kunst
beruht, zeigen uns fast stets den Gläubigen im direkten oder
indirekten Verkehr mit der Gottheit.
Vor allem gewinnt das Votivbild dadurch Bedeutung, daß
die Fürsten, deren Despotismus im Orient noch viel über-
wältigender erscheint als in Ägypten, diese Gelegenheit benützen,
um sich selbst ein Denkmal zu setzen. Daneben wird die
Kunst unmittelbar in den Dienst der Herrscher gestellt, sie muß
auf Denksteinen ihren Sieg verkünden oder — vor allem in
Assyrien — ihre Paläste ausschmücken. Für unser Thema
ergibt sich jedenfalls, daß wir fast nur thronenden Göttern und
Königen begegnen werden.
Der Gegensatz zu ägyptischer Art tritt uns stark entgegen,
wenn wir die ältesten chaldäischen Sitzfiguren näher betrachten.
Waren bei den schärfer beobachtenden Ägyptern die Typen
früh entwickelt und vor allem durch Hervorhebung des Auf-
baues und Gerüstes wirkungsvoll, so finden wir bei den alten
Chaldäern eine Phantasie voll Feuer und sinnlicher Kraft, die,
stark am Äußern haftend, zur Ausbildung eines anatomisch
richtigen Schemas erst spät und mühsam gelangt ist. Sehr
stark spielt dabei ein Umstand mit, der, scheinbar äußerlich,
tief in orientalischer Geistesrichtung begründet liegt: der Mensch
1 1 183: Goldener ‘Zeus’ in Babylon.
2 de Morgan, Deleg. en Perse VII pl. 18, 1, 2.