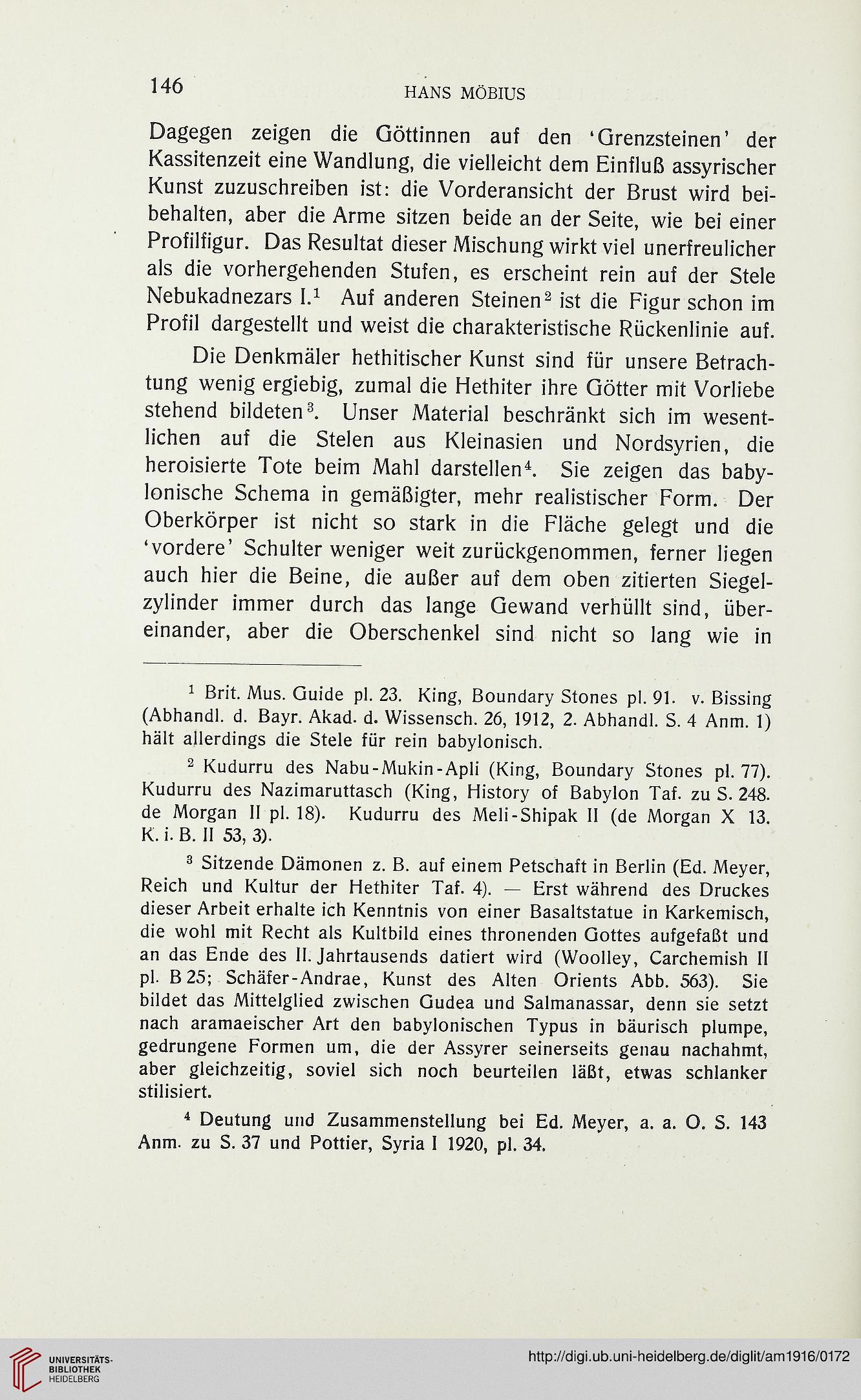146
HANS MÖBIUS
Dagegen zeigen die Göttinnen auf den ‘Grenzsteinen’ der
Kassitenzeit eine Wandlung, die vielleicht dem Einfluß assyrischer
Kunst zuzuschreiben ist: die Vorderansicht der Brust wird bei-
behalten, aber die Arme sitzen beide an der Seite, wie bei einer
Profilfigur. Das Resultat dieser Mischung wirkt viel unerfreulicher
als die vorhergehenden Stufen, es erscheint rein auf der Stele
Nebukadnezars I.1 Auf anderen Steinen2 ist die Figur schon im
Profil dargestellt und weist die charakteristische Rückenlinie auf.
Die Denkmäler hethitischer Kunst sind für unsere Betrach-
tung wenig ergiebig, zumal die Hethiter ihre Götter mit Vorliebe
stehend bildeten3. Unser Material beschränkt sich im wesent-
lichen auf die Stelen aus Kleinasien und Nordsyrien, die
heroisierte Tote beim Mahl darstellen4. Sie zeigen das baby-
lonische Schema in gemäßigter, mehr realistischer Form. Der
Oberkörper ist nicht so stark in die Fläche gelegt und die
‘vordere’ Schulter weniger weit zurückgenommen, ferner liegen
auch hier die Beine, die außer auf dem oben zitierten Siegel-
zylinder immer durch das lange Gewand verhüllt sind, über-
einander, aber die Oberschenkel sind nicht so lang wie in
1 Brit. Mus. Guide pl. 23. King, Boundary Stones pl. 91. v. Bissing
(Abhandl. d. Bayr. Akad. d. Wissensch. 26, 1912, 2. Abhandl. S. 4 Anm. 1)
hält allerdings die Stele für rein babylonisch.
2 Kudurru des Nabu-Mukin-Apli (King, Boundary Stones pl. 77).
Kudurru des Nazimaruttasch (King, History of Babylon Taf. zu S. 248.
de Morgan II pl. 18). Kudurru des Meli-Shipak II (de Morgan X 13.
K. i. B. II 53, 3).
3 Sitzende Dämonen z. B. auf einem Petschaft in Berlin (Ed. Meyer,
Reich und Kultur der Hethiter Taf. 4). — Erst während des Druckes
dieser Arbeit erhalte ich Kenntnis von einer Basaltstatue in Karkemisch,
die wohl mit Recht als Kultbild eines thronenden Gottes aufgefaßt und
an das Ende des II. Jahrtausends datiert wird (Woolley, Carchemish II
pl. B25; Schäfer-Andrae, Kunst des Alten Orients Abb. 563). Sie
bildet das Mittelglied zwischen Gudea und Salmanassar, denn sie setzt
nach aramaeischer Art den babylonischen Typus in bäurisch plumpe,
gedrungene Formen um, die der Assyrer seinerseits genau nachahmt,
aber gleichzeitig, soviel sich noch beurteilen läßt, etwas schlanker
stilisiert.
4 Deutung und Zusammenstellung bei Ed. Meyer, a. a. O. S. 143
Anm. zu S. 37 und Pottier, Syria I 1920, pl. 34.
HANS MÖBIUS
Dagegen zeigen die Göttinnen auf den ‘Grenzsteinen’ der
Kassitenzeit eine Wandlung, die vielleicht dem Einfluß assyrischer
Kunst zuzuschreiben ist: die Vorderansicht der Brust wird bei-
behalten, aber die Arme sitzen beide an der Seite, wie bei einer
Profilfigur. Das Resultat dieser Mischung wirkt viel unerfreulicher
als die vorhergehenden Stufen, es erscheint rein auf der Stele
Nebukadnezars I.1 Auf anderen Steinen2 ist die Figur schon im
Profil dargestellt und weist die charakteristische Rückenlinie auf.
Die Denkmäler hethitischer Kunst sind für unsere Betrach-
tung wenig ergiebig, zumal die Hethiter ihre Götter mit Vorliebe
stehend bildeten3. Unser Material beschränkt sich im wesent-
lichen auf die Stelen aus Kleinasien und Nordsyrien, die
heroisierte Tote beim Mahl darstellen4. Sie zeigen das baby-
lonische Schema in gemäßigter, mehr realistischer Form. Der
Oberkörper ist nicht so stark in die Fläche gelegt und die
‘vordere’ Schulter weniger weit zurückgenommen, ferner liegen
auch hier die Beine, die außer auf dem oben zitierten Siegel-
zylinder immer durch das lange Gewand verhüllt sind, über-
einander, aber die Oberschenkel sind nicht so lang wie in
1 Brit. Mus. Guide pl. 23. King, Boundary Stones pl. 91. v. Bissing
(Abhandl. d. Bayr. Akad. d. Wissensch. 26, 1912, 2. Abhandl. S. 4 Anm. 1)
hält allerdings die Stele für rein babylonisch.
2 Kudurru des Nabu-Mukin-Apli (King, Boundary Stones pl. 77).
Kudurru des Nazimaruttasch (King, History of Babylon Taf. zu S. 248.
de Morgan II pl. 18). Kudurru des Meli-Shipak II (de Morgan X 13.
K. i. B. II 53, 3).
3 Sitzende Dämonen z. B. auf einem Petschaft in Berlin (Ed. Meyer,
Reich und Kultur der Hethiter Taf. 4). — Erst während des Druckes
dieser Arbeit erhalte ich Kenntnis von einer Basaltstatue in Karkemisch,
die wohl mit Recht als Kultbild eines thronenden Gottes aufgefaßt und
an das Ende des II. Jahrtausends datiert wird (Woolley, Carchemish II
pl. B25; Schäfer-Andrae, Kunst des Alten Orients Abb. 563). Sie
bildet das Mittelglied zwischen Gudea und Salmanassar, denn sie setzt
nach aramaeischer Art den babylonischen Typus in bäurisch plumpe,
gedrungene Formen um, die der Assyrer seinerseits genau nachahmt,
aber gleichzeitig, soviel sich noch beurteilen läßt, etwas schlanker
stilisiert.
4 Deutung und Zusammenstellung bei Ed. Meyer, a. a. O. S. 143
Anm. zu S. 37 und Pottier, Syria I 1920, pl. 34.