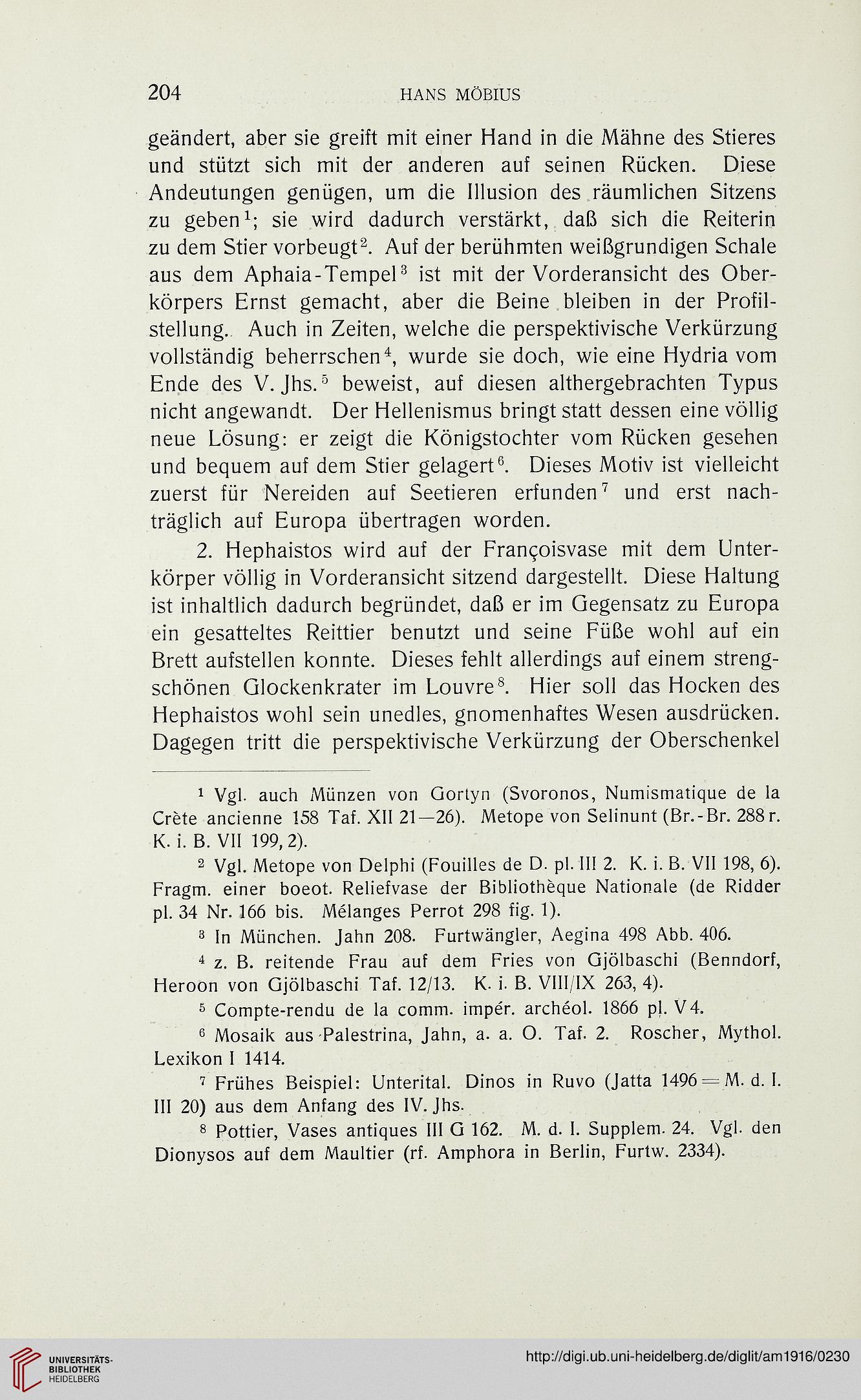204
HANS MÖBIUS
geändert, aber sie greift mit einer Hand in die Mähne des Stieres
und stützt sich mit der anderen auf seinen Rücken. Diese
Andeutungen genügen, um die Illusion des räumlichen Sitzens
zu geben1; sie wird dadurch verstärkt, daß sich die Reiterin
zu dem Stier vorbeugt2. Auf der berühmten weißgrundigen Schale
aus dem Aphaia-Tempel3 ist mit der Vorderansicht des Ober-
körpers Ernst gemacht, aber die Beine bleiben in der Profil-
stellung. Auch in Zeiten, welche die perspektivische Verkürzung
vollständig beherrschen4, wurde sie doch, wie eine Hydria vom
Ende des V. Jhs.5 beweist, auf diesen althergebrachten Typus
nicht angewandt. Der Hellenismus bringt statt dessen eine völlig
neue Lösung: er zeigt die Königstochter vom Rücken gesehen
und bequem auf dem Stier gelagert6. Dieses Motiv ist vielleicht
zuerst für Nereiden auf Seetieren erfunden7 und erst nach-
träglich auf Europa übertragen worden.
2. Hephaistos wird auf der Fran^oisvase mit dem Unter-
körper völlig in Vorderansicht sitzend dargestellt. Diese Haltung
ist inhaltlich dadurch begründet, daß er im Gegensatz zu Europa
ein gesatteltes Reittier benutzt und seine Füße wohl auf ein
Brett aufstellen konnte. Dieses fehlt allerdings auf einem streng-
schönen Glockenkrater im Louvre8. Hier soll das Hocken des
Hephaistos wohl sein unedles, gnomenhaftes Wesen ausdrücken.
Dagegen tritt die perspektivische Verkürzung der Oberschenkel
1 Vgl. auch Münzen von Gortyn (Svoronos, Numismatique de la
Crete ancienne 158 Taf. XII 21—26). Metope von Selinunt (Br.-Br. 288r.
K. i. B. Vll 199, 2).
2 Vgl. Metope von Delphi (Fouilles de D. pl. III 2. K. i. B. VII 198, 6).
Fragm. einer boeot. Reliefvase der Bibliotheque Nationale (de Ridder
pl. 34 Nr. 166 bis. Melanges Perrot 298 fig. 1).
3 In München. Jahn 208. Furtwängler, Aegina 498 Abb. 406.
4 z. B. reitende Frau auf dem Fries von Gjölbaschi (Benndorf,
Heroon von Gjölbaschi Taf. 12/13. K. i. B. VIII/IX 263, 4).
5 Compte-rendu de la comm. imper. archeol. 1866 pl. V4.
6 Mosaik aus Palestrina, Jahn, a. a. O. Taf. 2. Roscher, Mythol.
Lexikon I 1414.
7 Frühes Beispiel: Unterital. Dinos in Ruvo (Jatta 1496 = M. d. I.
III 20) aus dem Anfang des IV. Jhs.
8 Pottier, Vases antiques III G 162. M. d. I. Supplem. 24. Vgl. den
Dionysos auf dem Maultier (rf. Amphora in Berlin, Furtw. 2334).
HANS MÖBIUS
geändert, aber sie greift mit einer Hand in die Mähne des Stieres
und stützt sich mit der anderen auf seinen Rücken. Diese
Andeutungen genügen, um die Illusion des räumlichen Sitzens
zu geben1; sie wird dadurch verstärkt, daß sich die Reiterin
zu dem Stier vorbeugt2. Auf der berühmten weißgrundigen Schale
aus dem Aphaia-Tempel3 ist mit der Vorderansicht des Ober-
körpers Ernst gemacht, aber die Beine bleiben in der Profil-
stellung. Auch in Zeiten, welche die perspektivische Verkürzung
vollständig beherrschen4, wurde sie doch, wie eine Hydria vom
Ende des V. Jhs.5 beweist, auf diesen althergebrachten Typus
nicht angewandt. Der Hellenismus bringt statt dessen eine völlig
neue Lösung: er zeigt die Königstochter vom Rücken gesehen
und bequem auf dem Stier gelagert6. Dieses Motiv ist vielleicht
zuerst für Nereiden auf Seetieren erfunden7 und erst nach-
träglich auf Europa übertragen worden.
2. Hephaistos wird auf der Fran^oisvase mit dem Unter-
körper völlig in Vorderansicht sitzend dargestellt. Diese Haltung
ist inhaltlich dadurch begründet, daß er im Gegensatz zu Europa
ein gesatteltes Reittier benutzt und seine Füße wohl auf ein
Brett aufstellen konnte. Dieses fehlt allerdings auf einem streng-
schönen Glockenkrater im Louvre8. Hier soll das Hocken des
Hephaistos wohl sein unedles, gnomenhaftes Wesen ausdrücken.
Dagegen tritt die perspektivische Verkürzung der Oberschenkel
1 Vgl. auch Münzen von Gortyn (Svoronos, Numismatique de la
Crete ancienne 158 Taf. XII 21—26). Metope von Selinunt (Br.-Br. 288r.
K. i. B. Vll 199, 2).
2 Vgl. Metope von Delphi (Fouilles de D. pl. III 2. K. i. B. VII 198, 6).
Fragm. einer boeot. Reliefvase der Bibliotheque Nationale (de Ridder
pl. 34 Nr. 166 bis. Melanges Perrot 298 fig. 1).
3 In München. Jahn 208. Furtwängler, Aegina 498 Abb. 406.
4 z. B. reitende Frau auf dem Fries von Gjölbaschi (Benndorf,
Heroon von Gjölbaschi Taf. 12/13. K. i. B. VIII/IX 263, 4).
5 Compte-rendu de la comm. imper. archeol. 1866 pl. V4.
6 Mosaik aus Palestrina, Jahn, a. a. O. Taf. 2. Roscher, Mythol.
Lexikon I 1414.
7 Frühes Beispiel: Unterital. Dinos in Ruvo (Jatta 1496 = M. d. I.
III 20) aus dem Anfang des IV. Jhs.
8 Pottier, Vases antiques III G 162. M. d. I. Supplem. 24. Vgl. den
Dionysos auf dem Maultier (rf. Amphora in Berlin, Furtw. 2334).