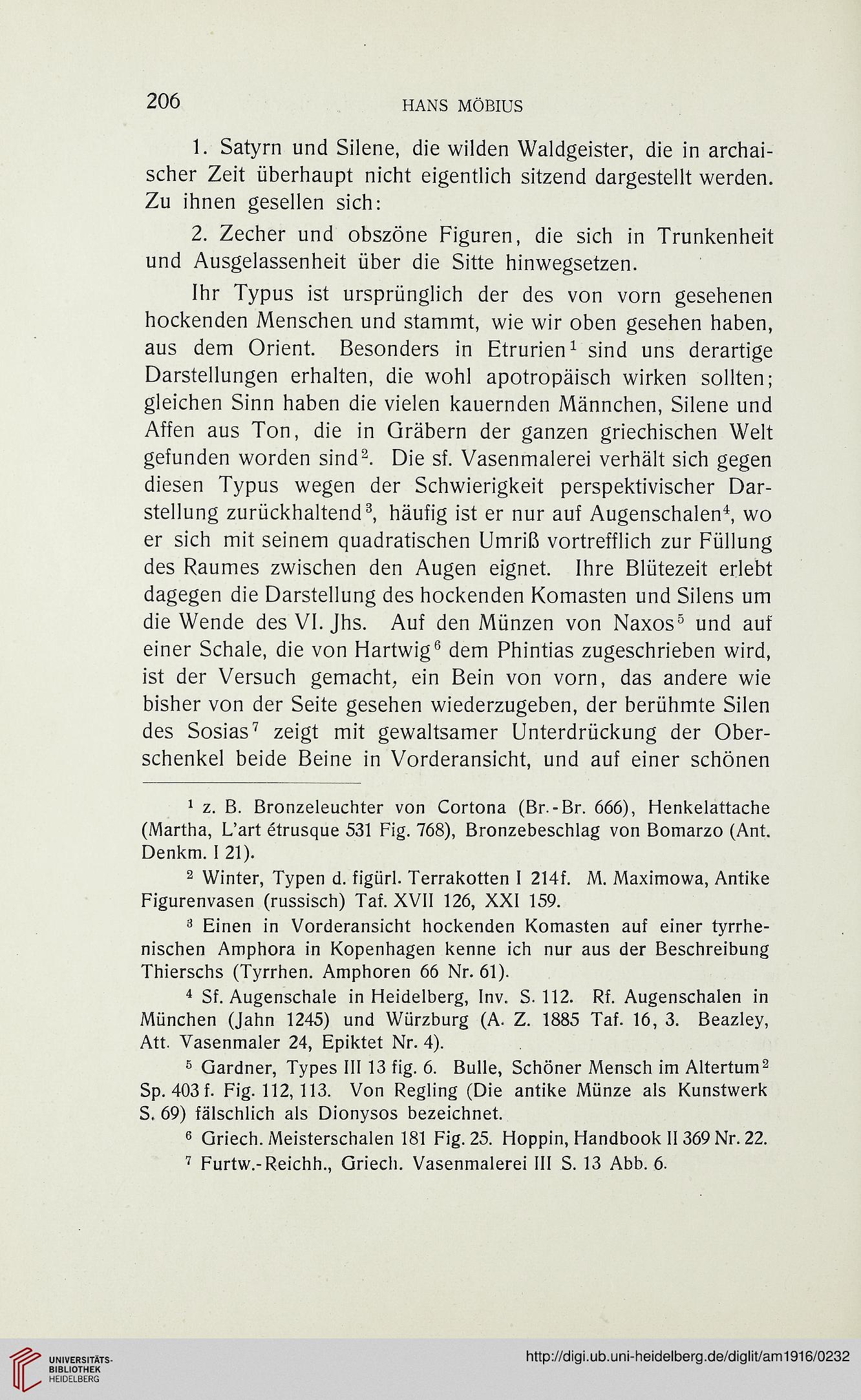206
HANS MÖBIUS
1. Satyrn und Silene, die wilden Waldgeister, die in archai-
scher Zeit überhaupt nicht eigentlich sitzend dargestellt werden.
Zu ihnen gesellen sich:
2. Zecher und obszöne Figuren, die sich in Trunkenheit
und Ausgelassenheit über die Sitte hinwegsetzen.
Ihr Typus ist ursprünglich der des von vorn gesehenen
hockenden Menschen und stammt, wie wir oben gesehen haben,
aus dem Orient. Besonders in Etrurien1 sind uns derartige
Darstellungen erhalten, die wohl apotropäisch wirken sollten;
gleichen Sinn haben die vielen kauernden Männchen, Silene und
Affen aus Ton, die in Gräbern der ganzen griechischen Welt
gefunden worden sind2. Die sf. Vasenmalerei verhält sich gegen
diesen Typus wegen der Schwierigkeit perspektivischer Dar-
stellung zurückhaltend3, häufig ist er nur auf Augenschalen4, wo
er sich mit seinem quadratischen Umriß vortrefflich zur Füllung
des Raumes zwischen den Augen eignet. Ihre Blütezeit erlebt
dagegen die Darstellung des hockenden Komasten und Silens um
die Wende des VI. Jhs. Auf den Münzen von Naxos5 und auf
einer Schale, die von Hartwig6 dem Phintias zugeschrieben wird,
ist der Versuch gemacht, ein Bein von vorn, das andere wie
bisher von der Seite gesehen wiederzugeben, der berühmte Silen
des Sosias7 zeigt mit gewaltsamer Unterdrückung der Ober-
schenkel beide Beine in Vorderansicht, und auf einer schönen
1 z. B. Bronzeleuchter von Cortona (Br.-Br. 666), Henkelattache
(Martha, L’art etrusque 531 Fig. 768), Bronzebeschlag von Bomarzo (Ant.
Denkm. I 21).
2 Winter, Typen d. figürl. Terrakotten 1 214f. M. Maximowa, Antike
Figurenvasen (russisch) Taf. XVII 126, XXI 159.
3 Einen in Vorderansicht hockenden Komasten auf einer tyrrhe-
nischen Amphora in Kopenhagen kenne ich nur aus der Beschreibung
Thierschs (Tyrrhen. Amphoren 66 Nr. 61).
4 Sf. Augenschale in Heidelberg, Inv. S. 112. Rf. Augenschalen in
München (Jahn 1245) und Würzburg (A. Z. 1885 Taf. 16, 3. Beazley,
Att. Vasenmaler 24, Epiktet Nr. 4).
5 Gardner, Types III 13 fig. 6. Bulle, Schöner Mensch im Altertum2
Sp. 403 f. Fig. 112, 113. Von Regling (Die antike Münze als Kunstwerk
S. 69) fälschlich als Dionysos bezeichnet.
6 Griech. Meisterschalen 181 Fig. 25. Hoppin, Handbook II 369 Nr. 22.
7 Furtw.-Reichh., Griech. Vasenmalerei III S. 13 Abb. 6.
HANS MÖBIUS
1. Satyrn und Silene, die wilden Waldgeister, die in archai-
scher Zeit überhaupt nicht eigentlich sitzend dargestellt werden.
Zu ihnen gesellen sich:
2. Zecher und obszöne Figuren, die sich in Trunkenheit
und Ausgelassenheit über die Sitte hinwegsetzen.
Ihr Typus ist ursprünglich der des von vorn gesehenen
hockenden Menschen und stammt, wie wir oben gesehen haben,
aus dem Orient. Besonders in Etrurien1 sind uns derartige
Darstellungen erhalten, die wohl apotropäisch wirken sollten;
gleichen Sinn haben die vielen kauernden Männchen, Silene und
Affen aus Ton, die in Gräbern der ganzen griechischen Welt
gefunden worden sind2. Die sf. Vasenmalerei verhält sich gegen
diesen Typus wegen der Schwierigkeit perspektivischer Dar-
stellung zurückhaltend3, häufig ist er nur auf Augenschalen4, wo
er sich mit seinem quadratischen Umriß vortrefflich zur Füllung
des Raumes zwischen den Augen eignet. Ihre Blütezeit erlebt
dagegen die Darstellung des hockenden Komasten und Silens um
die Wende des VI. Jhs. Auf den Münzen von Naxos5 und auf
einer Schale, die von Hartwig6 dem Phintias zugeschrieben wird,
ist der Versuch gemacht, ein Bein von vorn, das andere wie
bisher von der Seite gesehen wiederzugeben, der berühmte Silen
des Sosias7 zeigt mit gewaltsamer Unterdrückung der Ober-
schenkel beide Beine in Vorderansicht, und auf einer schönen
1 z. B. Bronzeleuchter von Cortona (Br.-Br. 666), Henkelattache
(Martha, L’art etrusque 531 Fig. 768), Bronzebeschlag von Bomarzo (Ant.
Denkm. I 21).
2 Winter, Typen d. figürl. Terrakotten 1 214f. M. Maximowa, Antike
Figurenvasen (russisch) Taf. XVII 126, XXI 159.
3 Einen in Vorderansicht hockenden Komasten auf einer tyrrhe-
nischen Amphora in Kopenhagen kenne ich nur aus der Beschreibung
Thierschs (Tyrrhen. Amphoren 66 Nr. 61).
4 Sf. Augenschale in Heidelberg, Inv. S. 112. Rf. Augenschalen in
München (Jahn 1245) und Würzburg (A. Z. 1885 Taf. 16, 3. Beazley,
Att. Vasenmaler 24, Epiktet Nr. 4).
5 Gardner, Types III 13 fig. 6. Bulle, Schöner Mensch im Altertum2
Sp. 403 f. Fig. 112, 113. Von Regling (Die antike Münze als Kunstwerk
S. 69) fälschlich als Dionysos bezeichnet.
6 Griech. Meisterschalen 181 Fig. 25. Hoppin, Handbook II 369 Nr. 22.
7 Furtw.-Reichh., Griech. Vasenmalerei III S. 13 Abb. 6.