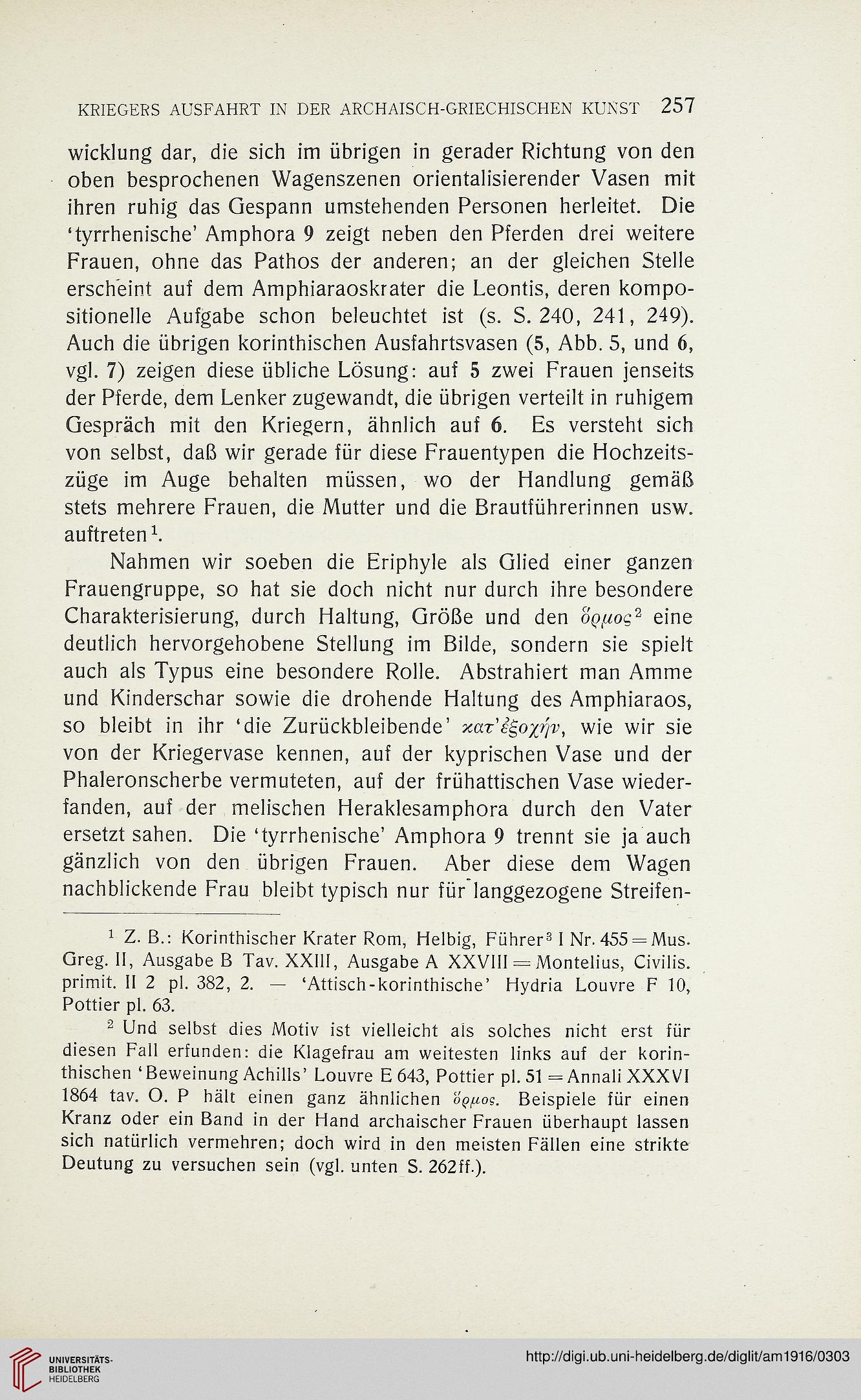KRIEGERS AUSFAHRT IN DER ARCHAISCH-GRIECHISCHEN KUNST 257
Wicklung dar, die sich im übrigen in gerader Richtung von den
oben besprochenen Wagenszenen orientalisierender Vasen mit
ihren ruhig das Gespann umstehenden Personen herleitet. Die
‘tyrrhenische’ Amphora 9 zeigt neben den Pferden drei weitere
Frauen, ohne das Pathos der anderen; an der gleichen Stelle
erscheint auf dem Amphiaraoskrater die Leontis, deren kompo-
sitionelle Aufgabe schon beleuchtet ist (s. S. 240, 241, 249).
Auch die übrigen korinthischen Ausfahrtsvasen (5, Abb. 5, und 6,
vgl. 7) zeigen diese übliche Lösung: auf 5 zwei Frauen jenseits
der Pferde, dem Lenker zugewandt, die übrigen verteilt in ruhigem
Gespräch mit den Kriegern, ähnlich auf 6. Es versteht sich
von selbst, daß wir gerade für diese Frauentypen die Hochzeits-
züge im Auge behalten müssen, wo der Handlung gemäß
stets mehrere Frauen, die Mutter und die Brautführerinnen usw.
auftreten1 2.
Nahmen wir soeben die Eriphyle als Glied einer ganzen
Frauengruppe, so hat sie doch nicht nur durch ihre besondere
Charakterisierung, durch Haltung, Größe und den ÖQpog2 eine
deutlich hervorgehobene Stellung im Bilde, sondern sie spielt
auch als Typus eine besondere Rolle. Abstrahiert man Amme
und Kinderschar sowie die drohende Haltung des Amphiaraos,
so bleibt in ihr ‘die Zurückbleibende’ xaz'it-oxrjv, wie wir sie
von der Kriegervase kennen, auf der kyprischen Vase und der
Phaleronscherbe vermuteten, auf der frühattischen Vase wieder-
fanden, auf der melischen Heraklesamphora durch den Vater
ersetzt sahen. Die ‘tyrrhenische’ Amphora 9 trennt sie ja auch
gänzlich von den übrigen Frauen. Aber diese dem Wagen
nachblickende Frau bleibt typisch nur für langgezogene Streifen-
1 Z. ß.: Korinthischer Krater Rom, Helbig, Führer3 I Nr. 455 = Mus.
Greg. II, Ausgabe B Tav. XXIII, Ausgabe A XXVIII = Montelius, Civilis,
primit. II 2 pl. 382, 2. — ‘Attisch-korinthische’ Hydria Louvre F 10,
Pottier pl. 63.
2 Und selbst dies Motiv ist vielleicht als solches nicht erst für
diesen Fall erfunden: die Klagefrau am weitesten links auf der korin-
thischen ‘Beweinung Achills’ Louvre E 643, Pottier pl. 51 =Annali XXXVI
1864 tav. O. P hält einen ganz ähnlichen oq/hos. Beispiele für einen
Kranz oder ein Band in der Hand archaischer Frauen überhaupt lassen
sich natürlich vermehren; doch wird in den meisten Fällen eine strikte
Deutung zu versuchen sein (vgl. unten S. 262ff.).
Wicklung dar, die sich im übrigen in gerader Richtung von den
oben besprochenen Wagenszenen orientalisierender Vasen mit
ihren ruhig das Gespann umstehenden Personen herleitet. Die
‘tyrrhenische’ Amphora 9 zeigt neben den Pferden drei weitere
Frauen, ohne das Pathos der anderen; an der gleichen Stelle
erscheint auf dem Amphiaraoskrater die Leontis, deren kompo-
sitionelle Aufgabe schon beleuchtet ist (s. S. 240, 241, 249).
Auch die übrigen korinthischen Ausfahrtsvasen (5, Abb. 5, und 6,
vgl. 7) zeigen diese übliche Lösung: auf 5 zwei Frauen jenseits
der Pferde, dem Lenker zugewandt, die übrigen verteilt in ruhigem
Gespräch mit den Kriegern, ähnlich auf 6. Es versteht sich
von selbst, daß wir gerade für diese Frauentypen die Hochzeits-
züge im Auge behalten müssen, wo der Handlung gemäß
stets mehrere Frauen, die Mutter und die Brautführerinnen usw.
auftreten1 2.
Nahmen wir soeben die Eriphyle als Glied einer ganzen
Frauengruppe, so hat sie doch nicht nur durch ihre besondere
Charakterisierung, durch Haltung, Größe und den ÖQpog2 eine
deutlich hervorgehobene Stellung im Bilde, sondern sie spielt
auch als Typus eine besondere Rolle. Abstrahiert man Amme
und Kinderschar sowie die drohende Haltung des Amphiaraos,
so bleibt in ihr ‘die Zurückbleibende’ xaz'it-oxrjv, wie wir sie
von der Kriegervase kennen, auf der kyprischen Vase und der
Phaleronscherbe vermuteten, auf der frühattischen Vase wieder-
fanden, auf der melischen Heraklesamphora durch den Vater
ersetzt sahen. Die ‘tyrrhenische’ Amphora 9 trennt sie ja auch
gänzlich von den übrigen Frauen. Aber diese dem Wagen
nachblickende Frau bleibt typisch nur für langgezogene Streifen-
1 Z. ß.: Korinthischer Krater Rom, Helbig, Führer3 I Nr. 455 = Mus.
Greg. II, Ausgabe B Tav. XXIII, Ausgabe A XXVIII = Montelius, Civilis,
primit. II 2 pl. 382, 2. — ‘Attisch-korinthische’ Hydria Louvre F 10,
Pottier pl. 63.
2 Und selbst dies Motiv ist vielleicht als solches nicht erst für
diesen Fall erfunden: die Klagefrau am weitesten links auf der korin-
thischen ‘Beweinung Achills’ Louvre E 643, Pottier pl. 51 =Annali XXXVI
1864 tav. O. P hält einen ganz ähnlichen oq/hos. Beispiele für einen
Kranz oder ein Band in der Hand archaischer Frauen überhaupt lassen
sich natürlich vermehren; doch wird in den meisten Fällen eine strikte
Deutung zu versuchen sein (vgl. unten S. 262ff.).