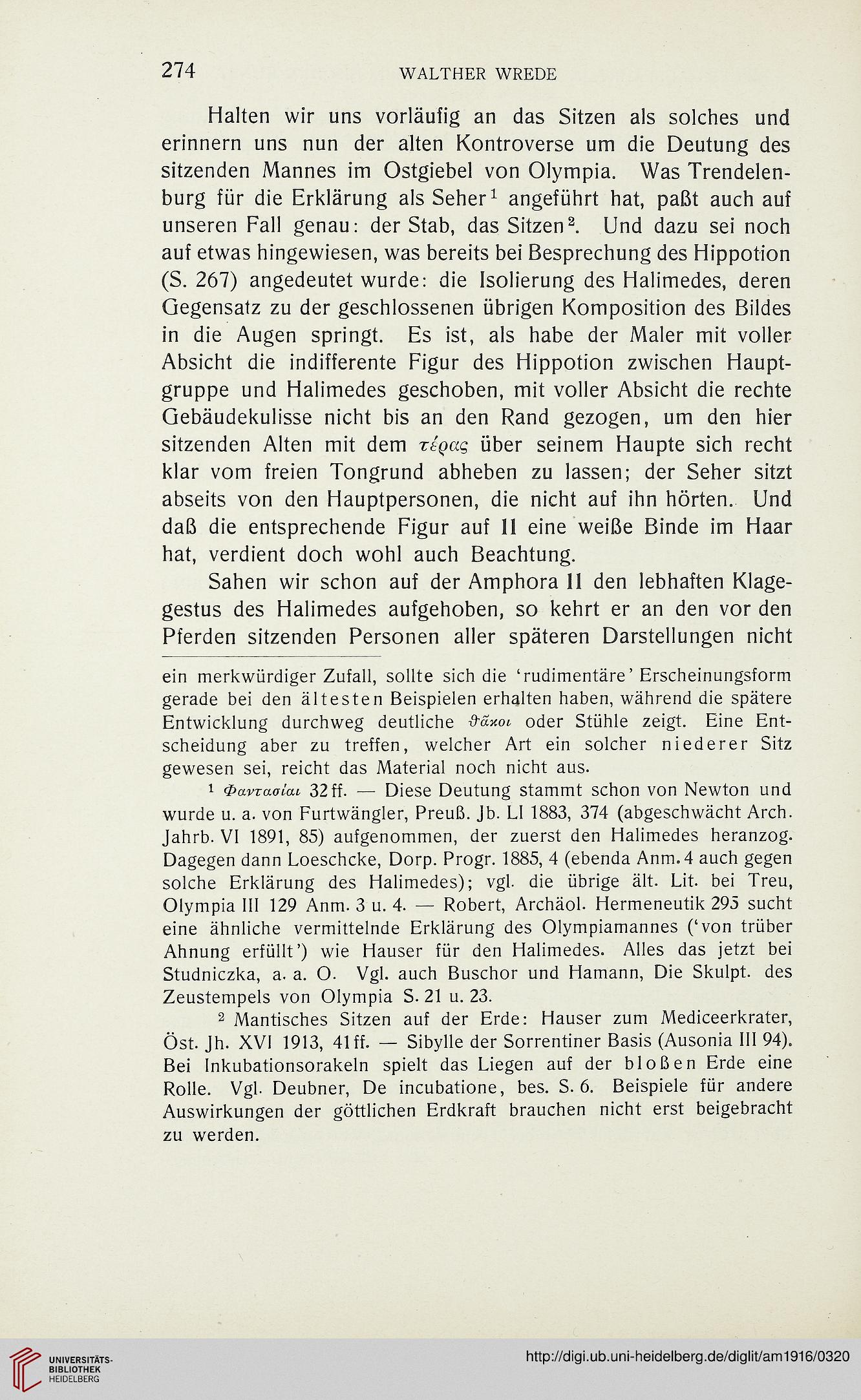274
WALTHER WREDE
Halten wir uns vorläufig an das Sitzen als solches und
erinnern uns nun der alten Kontroverse um die Deutung des
sitzenden Mannes im Ostgiebel von Olympia. Was Trendelen-
burg für die Erklärung als Seher* 1 angeführt hat, paßt auch auf
unseren Fall genau: der Stab, das Sitzen2. Und dazu sei noch
auf etwas hingewiesen, was bereits bei Besprechung des Hippotion
(S. 267) angedeutet wurde: die Isolierung des Halimedes, deren
Gegensatz zu der geschlossenen übrigen Komposition des Bildes
in die Augen springt. Es ist, als habe der Maler mit voller
Absicht die indifferente Figur des Hippotion zwischen Haupt-
gruppe und Halimedes geschoben, mit voller Absicht die rechte
Gebäudekulisse nicht bis an den Rand gezogen, um den hier
sitzenden Alten mit dem rlgag über seinem Haupte sich recht
klar vom freien Tongrund abheben zu lassen; der Seher sitzt
abseits von den Hauptpersonen, die nicht auf ihn hörten. Und
daß die entsprechende Figur auf 11 eine weiße Binde im Haar
hat, verdient doch wohl auch Beachtung.
Sahen wir schon auf der Amphora 11 den lebhaften Klage-
gestus des Halimedes aufgehoben, so kehrt er an den vor den
Pferden sitzenden Personen aller späteren Darstellungen nicht
ein merkwürdiger Zufall, sollte sich die ‘rudimentäre’ Erscheinungsform
gerade bei den ältesten Beispielen erhalten haben, während die spätere
Entwicklung durchweg deutliche itäxoi oder Stühle zeigt. Eine Ent-
scheidung aber zu treffen, welcher Art ein solcher niederer Sitz
gewesen sei, reicht das Material noch nicht aus.
1 <fravraoicu 32ff. — Diese Deutung stammt schon von Newton und
wurde u. a. von Furtwängler, Preuß. Jb. LI 1883, 374 (abgeschwächt Arch.
Jahrb. VI 1891, 85) aufgenommen, der zuerst den Halimedes heranzog.
Dagegen dann Loeschcke, Dorp. Progr. 1885, 4 (ebenda Anm.4 auch gegen
solche Erklärung des Halimedes); vgl. die übrige ält. Lit- bei Treu,
Olympia III 129 Anm. 3 u. 4. — Robert, Archäol. Hermeneutik 295 sucht
eine ähnliche vermittelnde Erklärung des Olympiamannes (‘von trüber
Ahnung erfüllt’) wie Hauser für den Halimedes. Alles das jetzt bei
Studniczka, a. a. O. Vgl. auch Buschor und Hamann, Die Skulpt. des
Zeustempels von Olympia S. 21 u. 23.
2 Mantisches Sitzen auf der Erde: Hauser zum Mediceerkrater,
Öst. Jh. XVI 1913, 41 ff. — Sibylle der Sorrentiner Basis (Ausonia 111 94).
Bei Inkubationsorakeln spielt das Liegen auf der bloßen Erde eine
Rolle. Vgl. Deubner, De incubatione, bes. S. 6. Beispiele für andere
Auswirkungen der göttlichen Erdkraft brauchen nicht erst beigebracht
zu werden.
WALTHER WREDE
Halten wir uns vorläufig an das Sitzen als solches und
erinnern uns nun der alten Kontroverse um die Deutung des
sitzenden Mannes im Ostgiebel von Olympia. Was Trendelen-
burg für die Erklärung als Seher* 1 angeführt hat, paßt auch auf
unseren Fall genau: der Stab, das Sitzen2. Und dazu sei noch
auf etwas hingewiesen, was bereits bei Besprechung des Hippotion
(S. 267) angedeutet wurde: die Isolierung des Halimedes, deren
Gegensatz zu der geschlossenen übrigen Komposition des Bildes
in die Augen springt. Es ist, als habe der Maler mit voller
Absicht die indifferente Figur des Hippotion zwischen Haupt-
gruppe und Halimedes geschoben, mit voller Absicht die rechte
Gebäudekulisse nicht bis an den Rand gezogen, um den hier
sitzenden Alten mit dem rlgag über seinem Haupte sich recht
klar vom freien Tongrund abheben zu lassen; der Seher sitzt
abseits von den Hauptpersonen, die nicht auf ihn hörten. Und
daß die entsprechende Figur auf 11 eine weiße Binde im Haar
hat, verdient doch wohl auch Beachtung.
Sahen wir schon auf der Amphora 11 den lebhaften Klage-
gestus des Halimedes aufgehoben, so kehrt er an den vor den
Pferden sitzenden Personen aller späteren Darstellungen nicht
ein merkwürdiger Zufall, sollte sich die ‘rudimentäre’ Erscheinungsform
gerade bei den ältesten Beispielen erhalten haben, während die spätere
Entwicklung durchweg deutliche itäxoi oder Stühle zeigt. Eine Ent-
scheidung aber zu treffen, welcher Art ein solcher niederer Sitz
gewesen sei, reicht das Material noch nicht aus.
1 <fravraoicu 32ff. — Diese Deutung stammt schon von Newton und
wurde u. a. von Furtwängler, Preuß. Jb. LI 1883, 374 (abgeschwächt Arch.
Jahrb. VI 1891, 85) aufgenommen, der zuerst den Halimedes heranzog.
Dagegen dann Loeschcke, Dorp. Progr. 1885, 4 (ebenda Anm.4 auch gegen
solche Erklärung des Halimedes); vgl. die übrige ält. Lit- bei Treu,
Olympia III 129 Anm. 3 u. 4. — Robert, Archäol. Hermeneutik 295 sucht
eine ähnliche vermittelnde Erklärung des Olympiamannes (‘von trüber
Ahnung erfüllt’) wie Hauser für den Halimedes. Alles das jetzt bei
Studniczka, a. a. O. Vgl. auch Buschor und Hamann, Die Skulpt. des
Zeustempels von Olympia S. 21 u. 23.
2 Mantisches Sitzen auf der Erde: Hauser zum Mediceerkrater,
Öst. Jh. XVI 1913, 41 ff. — Sibylle der Sorrentiner Basis (Ausonia 111 94).
Bei Inkubationsorakeln spielt das Liegen auf der bloßen Erde eine
Rolle. Vgl. Deubner, De incubatione, bes. S. 6. Beispiele für andere
Auswirkungen der göttlichen Erdkraft brauchen nicht erst beigebracht
zu werden.