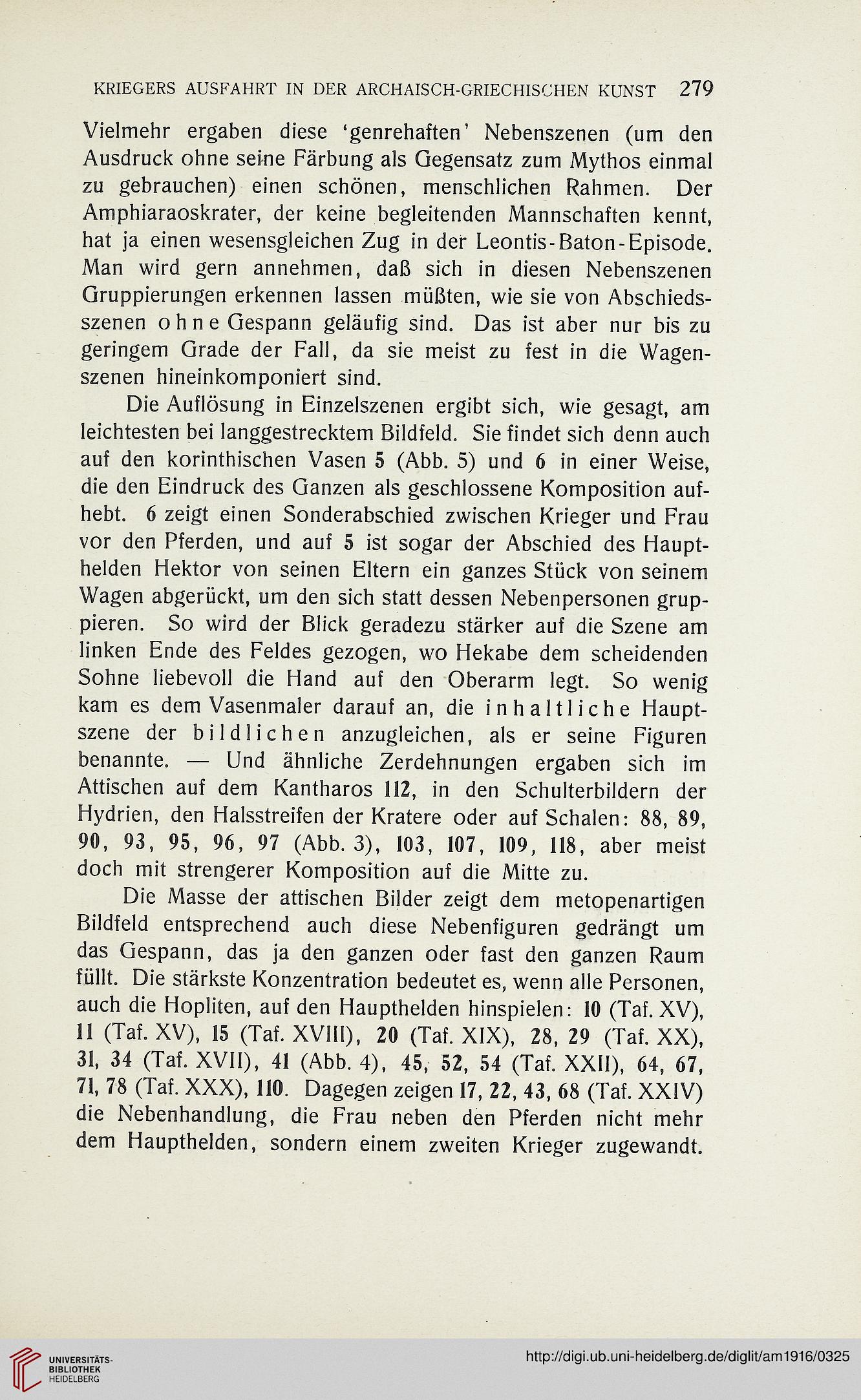KRIEGERS AUSFAHRT IN DER ARCHAISCH-GRIECHISCHEN KUNST 279
Vielmehr ergaben diese ‘genrehaften’ Nebenszenen (um den
Ausdruck ohne seine Färbung als Gegensatz zum Mythos einmal
zu gebrauchen) einen schönen, menschlichen Rahmen. Der
Amphiaraoskrater, der keine begleitenden Mannschaften kennt,
hat ja einen wesensgleichen Zug in der Leontis-Baton-Episode.
Man wird gern annehmen, daß sich in diesen Nebenszenen
Gruppierungen erkennen lassen müßten, wie sie von Abschieds-
szenen ohne Gespann geläufig sind. Das ist aber nur bis zu
geringem Grade der Fall, da sie meist zu fest in die Wagen-
szenen hineinkomponiert sind.
Die Auflösung in Einzelszenen ergibt sich, wie gesagt, am
leichtesten bei langgestrecktem Bildfeld. Sie findet sich denn auch
auf den korinthischen Vasen 5 (Abb. 5) und 6 in einer Weise,
die den Eindruck des Ganzen als geschlossene Komposition auf-
hebt. 6 zeigt einen Sonderabschied zwischen Krieger und Frau
vor den Pferden, und auf 5 ist sogar der Abschied des Haupt-
helden Hektor von seinen Eltern ein ganzes Stück von seinem
Wagen abgerückt, um den sich statt dessen Nebenpersonen grup-
pieren. So wird der Blick geradezu stärker auf die Szene am
linken Ende des Feldes gezogen, wo Hekabe dem scheidenden
Sohne liebevoll die Hand auf den Oberarm legt. So wenig
kam es dem Vasenmaler darauf an, die inhaltliche Haupt-
szene der bildlichen anzugleichen, als er seine Figuren
benannte. — Und ähnliche Zerdehnungen ergaben sich im
Attischen auf dem Kantharos 112, in den Schulterbildern der
Hydrien, den Halsstreifen der Kratere oder auf Schalen: 88, 89,
90, 93, 95, 96, 97 (Abb. 3), 103, 107, 109, 118, aber meist
doch mit strengerer Komposition auf die Mitte zu.
Die Masse der attischen Bilder zeigt dem metopenartigen
Bildfeld entsprechend auch diese Nebenfiguren gedrängt um
das Gespann, das ja den ganzen oder fast den ganzen Raum
füllt. Die stärkste Konzentration bedeutet es, wenn alle Personen,
auch die Hopliten, auf den Haupthelden hinspielen: 10 (Taf. XV),
11 (Taf. XV), 15 (Taf. XVIII), 20 (Taf. XIX), 28, 29 (Taf. XX),
31, 34 (Taf. XVII), 41 (Abb. 4), 45, 52, 54 (Taf. XXII), 64, 67,
71, 78 (Taf. XXX), 110. Dagegen zeigen 17, 22, 43, 68 (Taf. XXIV)
die Nebenhandlung, die Frau neben den Pferden nicht mehr
dem Haupthelden, sondern einem zweiten Krieger zugewandt.
Vielmehr ergaben diese ‘genrehaften’ Nebenszenen (um den
Ausdruck ohne seine Färbung als Gegensatz zum Mythos einmal
zu gebrauchen) einen schönen, menschlichen Rahmen. Der
Amphiaraoskrater, der keine begleitenden Mannschaften kennt,
hat ja einen wesensgleichen Zug in der Leontis-Baton-Episode.
Man wird gern annehmen, daß sich in diesen Nebenszenen
Gruppierungen erkennen lassen müßten, wie sie von Abschieds-
szenen ohne Gespann geläufig sind. Das ist aber nur bis zu
geringem Grade der Fall, da sie meist zu fest in die Wagen-
szenen hineinkomponiert sind.
Die Auflösung in Einzelszenen ergibt sich, wie gesagt, am
leichtesten bei langgestrecktem Bildfeld. Sie findet sich denn auch
auf den korinthischen Vasen 5 (Abb. 5) und 6 in einer Weise,
die den Eindruck des Ganzen als geschlossene Komposition auf-
hebt. 6 zeigt einen Sonderabschied zwischen Krieger und Frau
vor den Pferden, und auf 5 ist sogar der Abschied des Haupt-
helden Hektor von seinen Eltern ein ganzes Stück von seinem
Wagen abgerückt, um den sich statt dessen Nebenpersonen grup-
pieren. So wird der Blick geradezu stärker auf die Szene am
linken Ende des Feldes gezogen, wo Hekabe dem scheidenden
Sohne liebevoll die Hand auf den Oberarm legt. So wenig
kam es dem Vasenmaler darauf an, die inhaltliche Haupt-
szene der bildlichen anzugleichen, als er seine Figuren
benannte. — Und ähnliche Zerdehnungen ergaben sich im
Attischen auf dem Kantharos 112, in den Schulterbildern der
Hydrien, den Halsstreifen der Kratere oder auf Schalen: 88, 89,
90, 93, 95, 96, 97 (Abb. 3), 103, 107, 109, 118, aber meist
doch mit strengerer Komposition auf die Mitte zu.
Die Masse der attischen Bilder zeigt dem metopenartigen
Bildfeld entsprechend auch diese Nebenfiguren gedrängt um
das Gespann, das ja den ganzen oder fast den ganzen Raum
füllt. Die stärkste Konzentration bedeutet es, wenn alle Personen,
auch die Hopliten, auf den Haupthelden hinspielen: 10 (Taf. XV),
11 (Taf. XV), 15 (Taf. XVIII), 20 (Taf. XIX), 28, 29 (Taf. XX),
31, 34 (Taf. XVII), 41 (Abb. 4), 45, 52, 54 (Taf. XXII), 64, 67,
71, 78 (Taf. XXX), 110. Dagegen zeigen 17, 22, 43, 68 (Taf. XXIV)
die Nebenhandlung, die Frau neben den Pferden nicht mehr
dem Haupthelden, sondern einem zweiten Krieger zugewandt.