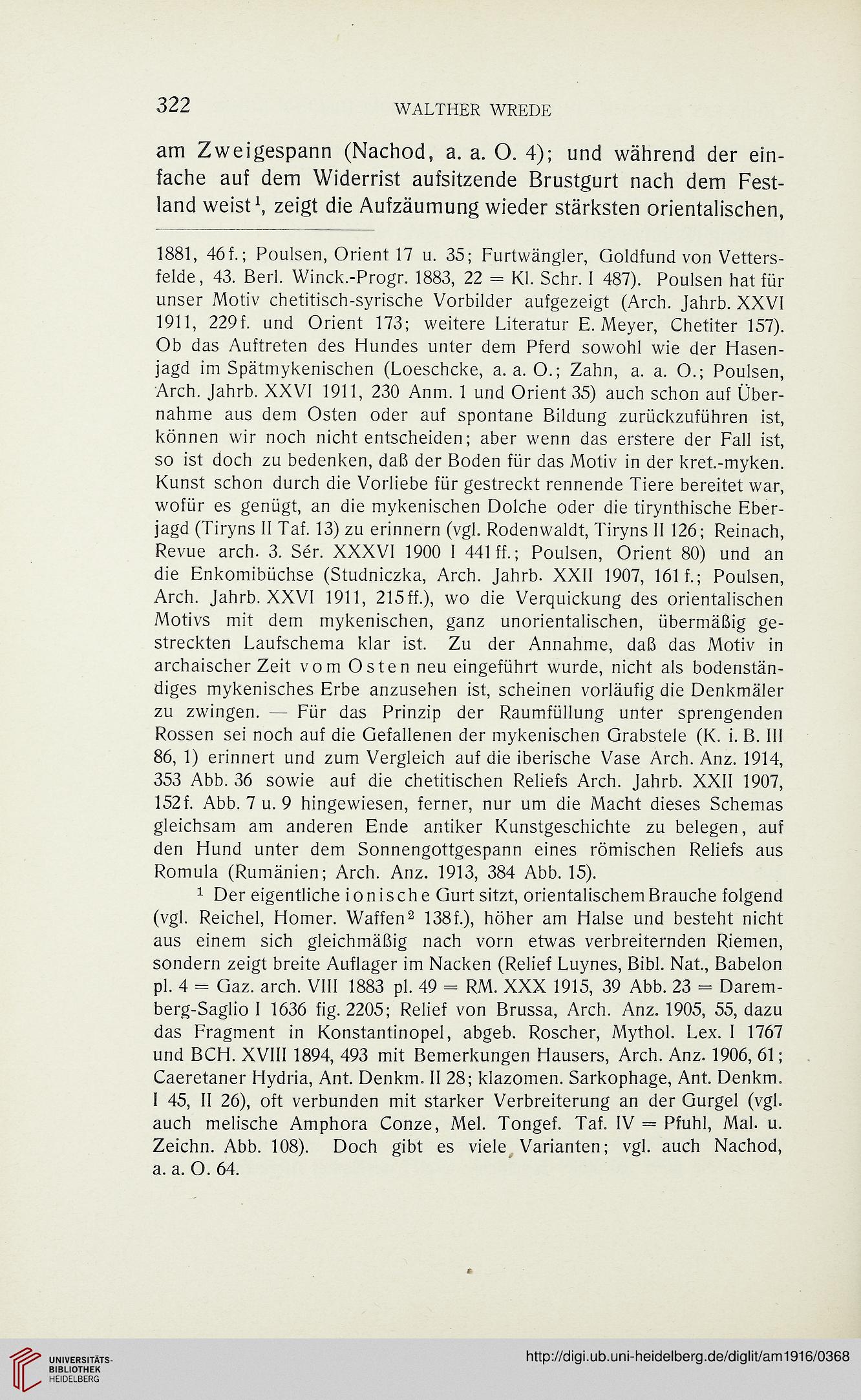322
WALTHER WREDE
am Zweigespann (Nachod, a. a. 0. 4); und während der ein-
fache auf dem Widerrist aufsitzende Brustgurt nach dem Fest-
land weist1, zeigt die Aufzäumung wieder stärksten orientalischen,
1881, 46f.; Poulsen, Orient 17 u. 35; Furtwängler, Goldfund von Vetters-
felde, 43. Berl. Winck.-Progr. 1883, 22 = Kl. Sehr. 1 487). Poulsen hat für
unser Motiv chetitisch-syrische Vorbilder aufgezeigt (Arch. Jahrb. XXVI
1911, 229f. und Orient 173; weitere Literatur E. Meyer, Chetiter 157).
Ob das Auftreten des Hundes unter dem Pferd sowohl wie der Hasen-
jagd im Spätmykenischen (Loeschcke, a. a. O.; Zahn, a. a. O.; Poulsen,
Arch. Jahrb. XXVI 1911, 230 Anm. 1 und Orient 35) auch schon auf Über-
nahme aus dem Osten oder auf spontane Bildung zurückzuführen ist,
können wir noch nicht entscheiden; aber wenn das erstere der Fall ist,
so ist doch zu bedenken, daß der Boden für das Motiv in der kret.-myken.
Kunst schon durch die Vorliebe für gestreckt rennende Tiere bereitet war,
wofür es genügt, an die mykenischen Dolche oder die tirynthische Eber-
jagd (Tiryns II Taf. 13) zu erinnern (vgl. Rodenwaldt, Tiryns II 126; Reinach,
Revue arch. 3. Ser. XXXVI 1900 I 441 ff.; Poulsen, Orient 80) und an
die Enkomibüchse (Studniczka, Arch. Jahrb. XXII 1907, 161 f.; Poulsen,
Arch. Jahrb. XXVI 1911, 215ff.), wo die Verquickung des orientalischen
Motivs mit dem mykenischen, ganz unorientalischen, übermäßig ge-
streckten Laufschema klar ist. Zu der Annahme, daß das Motiv in
archaischer Zeit vom Osten neu eingeführt wurde, nicht als bodenstän-
diges mykenisches Erbe anzusehen ist, scheinen vorläufig die Denkmäler
zu zwingen. — Für das Prinzip der Raumfüllung unter sprengenden
Rossen sei noch auf die Gefallenen der mykenischen Grabstele (K. i. B. III
86, 1) erinnert und zum Vergleich auf die iberische Vase Arch. Anz. 1914,
353 Abb. 36 sowie auf die chetitischen Reliefs Arch. Jahrb. XXII 1907,
152f. Abb. 7 u. 9 hingewiesen, ferner, nur um die Macht dieses Schemas
gleichsam am anderen Ende antiker Kunstgeschichte zu belegen, auf
den Hund unter dem Sonnengottgespann eines römischen Reliefs aus
Romula (Rumänien; Arch. Anz. 1913, 384 Abb. 15).
1 Der eigentliche ionische Gurt sitzt, orientalischem Brauche folgend
(vgl. Reichel, Homer. Waffen2 138f.), höher am Halse und besteht nicht
aus einem sich gleichmäßig nach vorn etwas verbreiternden Riemen,
sondern zeigt breite Auflager im Nacken (Relief Luynes, Bibi. Nat., Babeion
pl. 4 = Gaz. arch. VIII 1883 pl. 49 = RM. XXX 1915, 39 Abb. 23 = Darem-
berg-Saglio I 1636 fig. 2205; Relief von Brussa, Arch. Anz. 1905, 55, dazu
das Fragment in Konstantinopel, abgeb. Roscher, Mythol. Lex. I 1767
und BCH. XVIII 1894, 493 mit Bemerkungen Hausers, Arch. Anz. 1906, 61;
Caeretaner Hydria, Ant. Denkm. II 28; klazomen. Sarkophage, Ant. Denkm.
1 45, II 26), oft verbunden mit starker Verbreiterung an der Gurgel (vgl.
auch melische Amphora Conze, Mel. Tongef. Taf. IV = Pfuhl, Mal. u.
Zeichn. Abb. 108). Doch gibt es viele Varianten; vgl. auch Nachod,
a. a. O. 64.
WALTHER WREDE
am Zweigespann (Nachod, a. a. 0. 4); und während der ein-
fache auf dem Widerrist aufsitzende Brustgurt nach dem Fest-
land weist1, zeigt die Aufzäumung wieder stärksten orientalischen,
1881, 46f.; Poulsen, Orient 17 u. 35; Furtwängler, Goldfund von Vetters-
felde, 43. Berl. Winck.-Progr. 1883, 22 = Kl. Sehr. 1 487). Poulsen hat für
unser Motiv chetitisch-syrische Vorbilder aufgezeigt (Arch. Jahrb. XXVI
1911, 229f. und Orient 173; weitere Literatur E. Meyer, Chetiter 157).
Ob das Auftreten des Hundes unter dem Pferd sowohl wie der Hasen-
jagd im Spätmykenischen (Loeschcke, a. a. O.; Zahn, a. a. O.; Poulsen,
Arch. Jahrb. XXVI 1911, 230 Anm. 1 und Orient 35) auch schon auf Über-
nahme aus dem Osten oder auf spontane Bildung zurückzuführen ist,
können wir noch nicht entscheiden; aber wenn das erstere der Fall ist,
so ist doch zu bedenken, daß der Boden für das Motiv in der kret.-myken.
Kunst schon durch die Vorliebe für gestreckt rennende Tiere bereitet war,
wofür es genügt, an die mykenischen Dolche oder die tirynthische Eber-
jagd (Tiryns II Taf. 13) zu erinnern (vgl. Rodenwaldt, Tiryns II 126; Reinach,
Revue arch. 3. Ser. XXXVI 1900 I 441 ff.; Poulsen, Orient 80) und an
die Enkomibüchse (Studniczka, Arch. Jahrb. XXII 1907, 161 f.; Poulsen,
Arch. Jahrb. XXVI 1911, 215ff.), wo die Verquickung des orientalischen
Motivs mit dem mykenischen, ganz unorientalischen, übermäßig ge-
streckten Laufschema klar ist. Zu der Annahme, daß das Motiv in
archaischer Zeit vom Osten neu eingeführt wurde, nicht als bodenstän-
diges mykenisches Erbe anzusehen ist, scheinen vorläufig die Denkmäler
zu zwingen. — Für das Prinzip der Raumfüllung unter sprengenden
Rossen sei noch auf die Gefallenen der mykenischen Grabstele (K. i. B. III
86, 1) erinnert und zum Vergleich auf die iberische Vase Arch. Anz. 1914,
353 Abb. 36 sowie auf die chetitischen Reliefs Arch. Jahrb. XXII 1907,
152f. Abb. 7 u. 9 hingewiesen, ferner, nur um die Macht dieses Schemas
gleichsam am anderen Ende antiker Kunstgeschichte zu belegen, auf
den Hund unter dem Sonnengottgespann eines römischen Reliefs aus
Romula (Rumänien; Arch. Anz. 1913, 384 Abb. 15).
1 Der eigentliche ionische Gurt sitzt, orientalischem Brauche folgend
(vgl. Reichel, Homer. Waffen2 138f.), höher am Halse und besteht nicht
aus einem sich gleichmäßig nach vorn etwas verbreiternden Riemen,
sondern zeigt breite Auflager im Nacken (Relief Luynes, Bibi. Nat., Babeion
pl. 4 = Gaz. arch. VIII 1883 pl. 49 = RM. XXX 1915, 39 Abb. 23 = Darem-
berg-Saglio I 1636 fig. 2205; Relief von Brussa, Arch. Anz. 1905, 55, dazu
das Fragment in Konstantinopel, abgeb. Roscher, Mythol. Lex. I 1767
und BCH. XVIII 1894, 493 mit Bemerkungen Hausers, Arch. Anz. 1906, 61;
Caeretaner Hydria, Ant. Denkm. II 28; klazomen. Sarkophage, Ant. Denkm.
1 45, II 26), oft verbunden mit starker Verbreiterung an der Gurgel (vgl.
auch melische Amphora Conze, Mel. Tongef. Taf. IV = Pfuhl, Mal. u.
Zeichn. Abb. 108). Doch gibt es viele Varianten; vgl. auch Nachod,
a. a. O. 64.