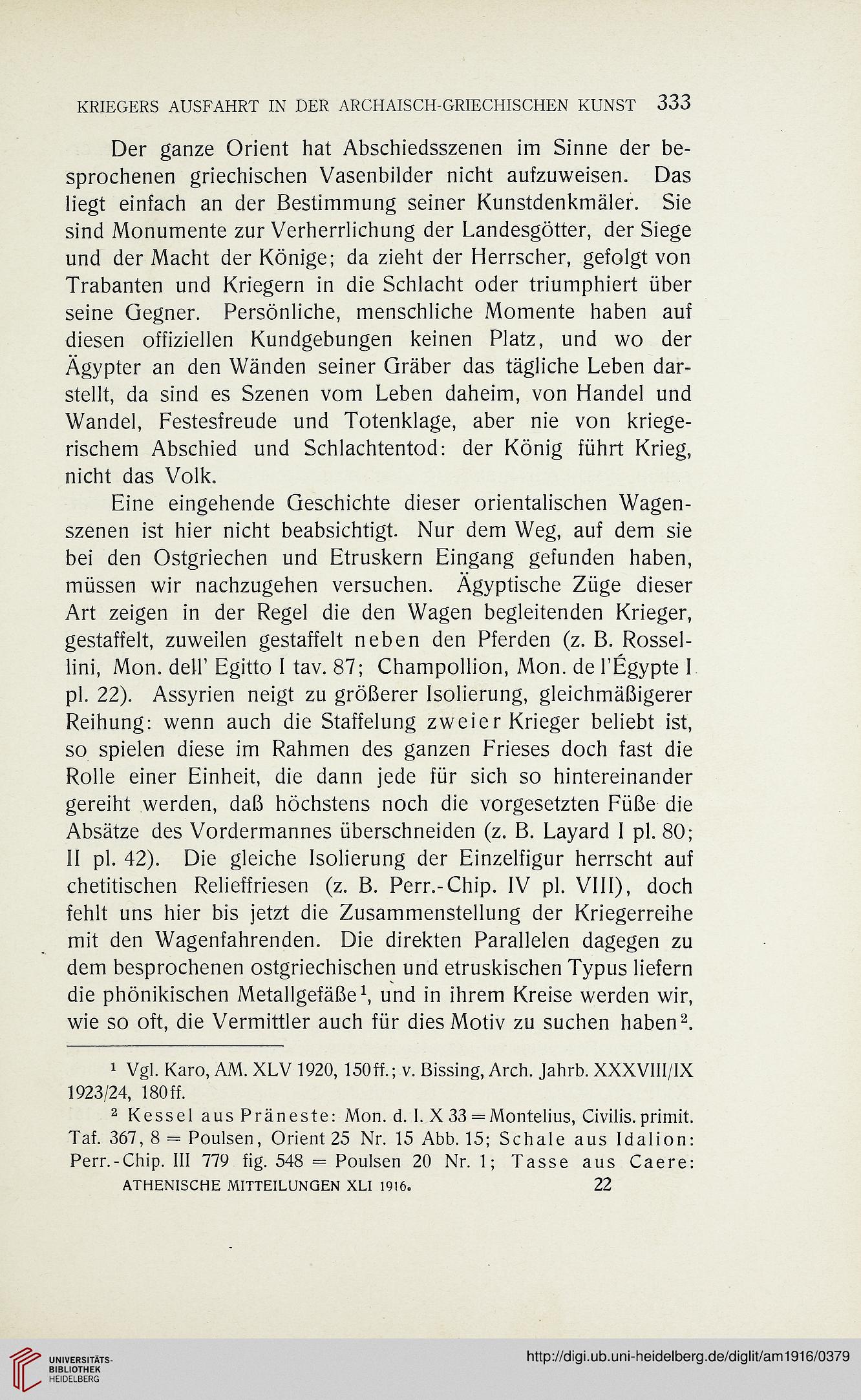KRIEGERS AUSFAHRT IN DER ARCHAISCH-GRIECHISCHEN KUNST 333
Der ganze Orient hat Abschiedsszenen im Sinne der be-
sprochenen griechischen Vasenbilder nicht aufzuweisen. Das
liegt einfach an der Bestimmung seiner Kunstdenkmäler. Sie
sind Monumente zur Verherrlichung der Landesgötter, der Siege
und der Macht der Könige; da zieht der Herrscher, gefolgt von
Trabanten und Kriegern in die Schlacht oder triumphiert über
seine Gegner. Persönliche, menschliche Momente haben auf
diesen offiziellen Kundgebungen keinen Platz, und wo der
Ägypter an den Wänden seiner Gräber das tägliche Leben dar-
stellt, da sind es Szenen vom Leben daheim, von Handel und
Wandel, Festesfreude und Totenklage, aber nie von kriege-
rischem Abschied und Schlachtentod: der König führt Krieg,
nicht das Volk.
Eine eingehende Geschichte dieser orientalischen Wagen-
szenen ist hier nicht beabsichtigt. Nur dem Weg, auf dem sie
bei den Ostgriechen und Etruskern Eingang gefunden haben,
müssen wir nachzugehen versuchen. Ägyptische Züge dieser
Art zeigen in der Regel die den Wagen begleitenden Krieger,
gestaffelt, zuweilen gestaffelt neben den Pferden (z. B. Rossel-
lini, Mon. dell’ Egitto I tav. 87; Champollion, Mon. de l’Egypte I
pl. 22). Assyrien neigt zu größerer Isolierung, gleichmäßigerer
Reihung: wenn auch die Staffelung zweier Krieger beliebt ist,
so spielen diese im Rahmen des ganzen Frieses doch fast die
Rolle einer Einheit, die dann jede für sich so hintereinander
gereiht werden, daß höchstens noch die Vorgesetzten Füße die
Absätze des Vordermannes überschneiden (z. B. Layard I pl. 80;
II pl. 42). Die gleiche Isolierung der Einzelfigur herrscht auf
chetitischen Relieffriesen (z. B. Perr.-Chip. IV pl. VIII), doch
fehlt uns hier bis jetzt die Zusammenstellung der Kriegerreihe
mit den Wagenfahrenden. Die direkten Parallelen dagegen zu
dem besprochenen ostgriechischen und etruskischen Typus liefern
die phönikischen Metallgefäße1, und in ihrem Kreise werden wir,
wie so oft, die Vermittler auch für dies Motiv zu suchen haben2.
1 Vgl. Karo, AM. XLV 1920, 150ff.; v. Bissing, Arch. Jahrb. XXXV1II/IX
1923/24, 180 ff.
2 Kessel aus Präneste: Mon. d. I. X 33 = Montelius, Civilis.primit.
Taf. 367, 8 = Poulsen, Orient 25 Nr. 15 Abb. 15; Schale aus Idalion:
Perr.-Chip. III 779 fig. 548 = Poulsen 20 Nr. 1; Tasse aus Caere:
ATHENISCHE MITTEILUNGEN XLI 1916. 22
Der ganze Orient hat Abschiedsszenen im Sinne der be-
sprochenen griechischen Vasenbilder nicht aufzuweisen. Das
liegt einfach an der Bestimmung seiner Kunstdenkmäler. Sie
sind Monumente zur Verherrlichung der Landesgötter, der Siege
und der Macht der Könige; da zieht der Herrscher, gefolgt von
Trabanten und Kriegern in die Schlacht oder triumphiert über
seine Gegner. Persönliche, menschliche Momente haben auf
diesen offiziellen Kundgebungen keinen Platz, und wo der
Ägypter an den Wänden seiner Gräber das tägliche Leben dar-
stellt, da sind es Szenen vom Leben daheim, von Handel und
Wandel, Festesfreude und Totenklage, aber nie von kriege-
rischem Abschied und Schlachtentod: der König führt Krieg,
nicht das Volk.
Eine eingehende Geschichte dieser orientalischen Wagen-
szenen ist hier nicht beabsichtigt. Nur dem Weg, auf dem sie
bei den Ostgriechen und Etruskern Eingang gefunden haben,
müssen wir nachzugehen versuchen. Ägyptische Züge dieser
Art zeigen in der Regel die den Wagen begleitenden Krieger,
gestaffelt, zuweilen gestaffelt neben den Pferden (z. B. Rossel-
lini, Mon. dell’ Egitto I tav. 87; Champollion, Mon. de l’Egypte I
pl. 22). Assyrien neigt zu größerer Isolierung, gleichmäßigerer
Reihung: wenn auch die Staffelung zweier Krieger beliebt ist,
so spielen diese im Rahmen des ganzen Frieses doch fast die
Rolle einer Einheit, die dann jede für sich so hintereinander
gereiht werden, daß höchstens noch die Vorgesetzten Füße die
Absätze des Vordermannes überschneiden (z. B. Layard I pl. 80;
II pl. 42). Die gleiche Isolierung der Einzelfigur herrscht auf
chetitischen Relieffriesen (z. B. Perr.-Chip. IV pl. VIII), doch
fehlt uns hier bis jetzt die Zusammenstellung der Kriegerreihe
mit den Wagenfahrenden. Die direkten Parallelen dagegen zu
dem besprochenen ostgriechischen und etruskischen Typus liefern
die phönikischen Metallgefäße1, und in ihrem Kreise werden wir,
wie so oft, die Vermittler auch für dies Motiv zu suchen haben2.
1 Vgl. Karo, AM. XLV 1920, 150ff.; v. Bissing, Arch. Jahrb. XXXV1II/IX
1923/24, 180 ff.
2 Kessel aus Präneste: Mon. d. I. X 33 = Montelius, Civilis.primit.
Taf. 367, 8 = Poulsen, Orient 25 Nr. 15 Abb. 15; Schale aus Idalion:
Perr.-Chip. III 779 fig. 548 = Poulsen 20 Nr. 1; Tasse aus Caere:
ATHENISCHE MITTEILUNGEN XLI 1916. 22