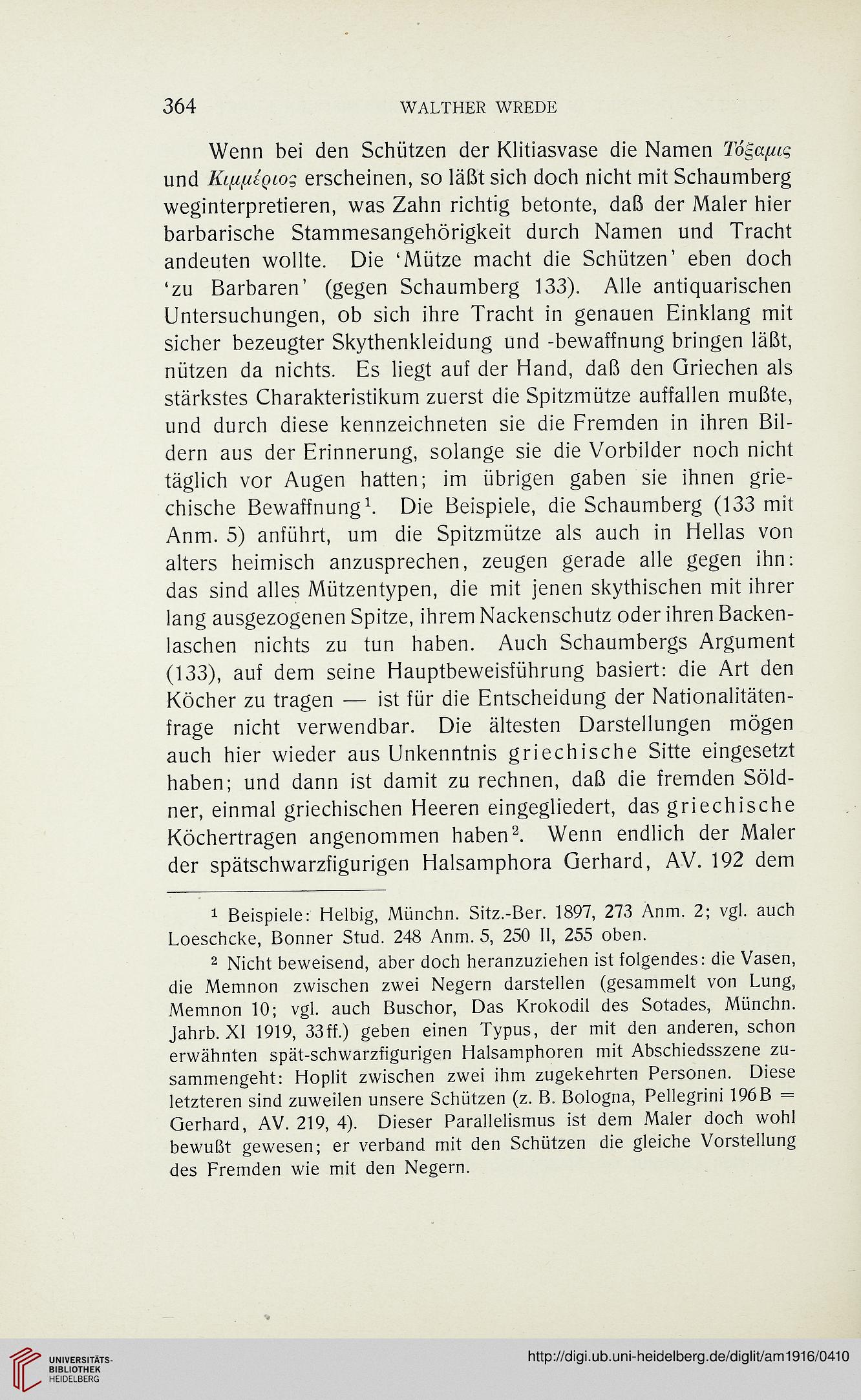364
WALTHER WREDE
Wenn bei den Schützen der Klitiasvase die Namen Toi-a/ug
und KififUQLog erscheinen, so läßt sich doch nicht mit Schaumberg
weginterpretieren, was Zahn richtig betonte, daß der Maler hier
barbarische Stammesangehörigkeit durch Namen und Tracht
andeuten wollte. Die ‘Mütze macht die Schützen’ eben doch
‘zu Barbaren’ (gegen Schaumberg 133). Alle antiquarischen
Untersuchungen, ob sich ihre Tracht in genauen Einklang mit
sicher bezeugter Skythenkleidung und -bewaffnung bringen läßt,
nützen da nichts. Es liegt auf der Hand, daß den Griechen als
stärkstes Charakteristikum zuerst die Spitzmütze auffallen mußte,
und durch diese kennzeichneten sie die Fremden in ihren Bil-
dern aus der Erinnerung, solange sie die Vorbilder noch nicht
täglich vor Augen hatten; im übrigen gaben sie ihnen grie-
chische Bewaffnung1. Die Beispiele, die Schaumberg (133 mit
Anm. 5) anführt, um die Spitzmütze als auch in Hellas von
alters heimisch anzusprechen, zeugen gerade alle gegen ihn:
das sind alles Mützentypen, die mit jenen skythischen mit ihrer
lang ausgezogenen Spitze, ihrem Nackenschutz oder ihren Backen-
laschen nichts zu tun haben. Auch Schaumbergs Argument
(133), auf dem seine Hauptbeweisführung basiert: die Art den
Köcher zu tragen — ist für die Entscheidung der Nationalitäten-
frage nicht verwendbar. Die ältesten Darstellungen mögen
auch hier wieder aus Unkenntnis griechische Sitte eingesetzt
haben; und dann ist damit zu rechnen, daß die fremden Söld-
ner, einmal griechischen Heeren eingegliedert, das griechische
Köchertragen angenommen haben2. Wenn endlich der Maler
der spätschwarzfigurigen Halsamphora Gerhard, AV. 192 dem
1 Beispiele: Helbig, Münchn. Sitz.-Ber. 1897, 273 Anm. 2; vgl. auch
Loeschcke, Bonner Stud. 248 Anm. 5, 250 II, 255 oben.
2 Nicht beweisend, aber doch heranzuziehen ist folgendes: die Vasen,
die Memnon zwischen zwei Negern darstellen (gesammelt von Lung,
Memnon 10; vgl. auch Buschor, Das Krokodil des Sotades, Münchn.
Jahrb. XI 1919, 33ff.) geben einen Typus, der mit den anderen, schon
erwähnten spät-schwarzfigurigen Halsamphoren mit Abschiedsszene zu-
sammengeht: Hoplit zwischen zwei ihm zugekehrten Personen. Diese
letzteren sind zuweilen unsere Schützen (z. B. Bologna, Pellegrini 196B -
Gerhard, AV. 219, 4). Dieser Parallelismus ist dem Maler doch wohl
bewußt gewesen; er verband mit den Schützen die gleiche Vorstellung
des Fremden wie mit den Negern.
WALTHER WREDE
Wenn bei den Schützen der Klitiasvase die Namen Toi-a/ug
und KififUQLog erscheinen, so läßt sich doch nicht mit Schaumberg
weginterpretieren, was Zahn richtig betonte, daß der Maler hier
barbarische Stammesangehörigkeit durch Namen und Tracht
andeuten wollte. Die ‘Mütze macht die Schützen’ eben doch
‘zu Barbaren’ (gegen Schaumberg 133). Alle antiquarischen
Untersuchungen, ob sich ihre Tracht in genauen Einklang mit
sicher bezeugter Skythenkleidung und -bewaffnung bringen läßt,
nützen da nichts. Es liegt auf der Hand, daß den Griechen als
stärkstes Charakteristikum zuerst die Spitzmütze auffallen mußte,
und durch diese kennzeichneten sie die Fremden in ihren Bil-
dern aus der Erinnerung, solange sie die Vorbilder noch nicht
täglich vor Augen hatten; im übrigen gaben sie ihnen grie-
chische Bewaffnung1. Die Beispiele, die Schaumberg (133 mit
Anm. 5) anführt, um die Spitzmütze als auch in Hellas von
alters heimisch anzusprechen, zeugen gerade alle gegen ihn:
das sind alles Mützentypen, die mit jenen skythischen mit ihrer
lang ausgezogenen Spitze, ihrem Nackenschutz oder ihren Backen-
laschen nichts zu tun haben. Auch Schaumbergs Argument
(133), auf dem seine Hauptbeweisführung basiert: die Art den
Köcher zu tragen — ist für die Entscheidung der Nationalitäten-
frage nicht verwendbar. Die ältesten Darstellungen mögen
auch hier wieder aus Unkenntnis griechische Sitte eingesetzt
haben; und dann ist damit zu rechnen, daß die fremden Söld-
ner, einmal griechischen Heeren eingegliedert, das griechische
Köchertragen angenommen haben2. Wenn endlich der Maler
der spätschwarzfigurigen Halsamphora Gerhard, AV. 192 dem
1 Beispiele: Helbig, Münchn. Sitz.-Ber. 1897, 273 Anm. 2; vgl. auch
Loeschcke, Bonner Stud. 248 Anm. 5, 250 II, 255 oben.
2 Nicht beweisend, aber doch heranzuziehen ist folgendes: die Vasen,
die Memnon zwischen zwei Negern darstellen (gesammelt von Lung,
Memnon 10; vgl. auch Buschor, Das Krokodil des Sotades, Münchn.
Jahrb. XI 1919, 33ff.) geben einen Typus, der mit den anderen, schon
erwähnten spät-schwarzfigurigen Halsamphoren mit Abschiedsszene zu-
sammengeht: Hoplit zwischen zwei ihm zugekehrten Personen. Diese
letzteren sind zuweilen unsere Schützen (z. B. Bologna, Pellegrini 196B -
Gerhard, AV. 219, 4). Dieser Parallelismus ist dem Maler doch wohl
bewußt gewesen; er verband mit den Schützen die gleiche Vorstellung
des Fremden wie mit den Negern.