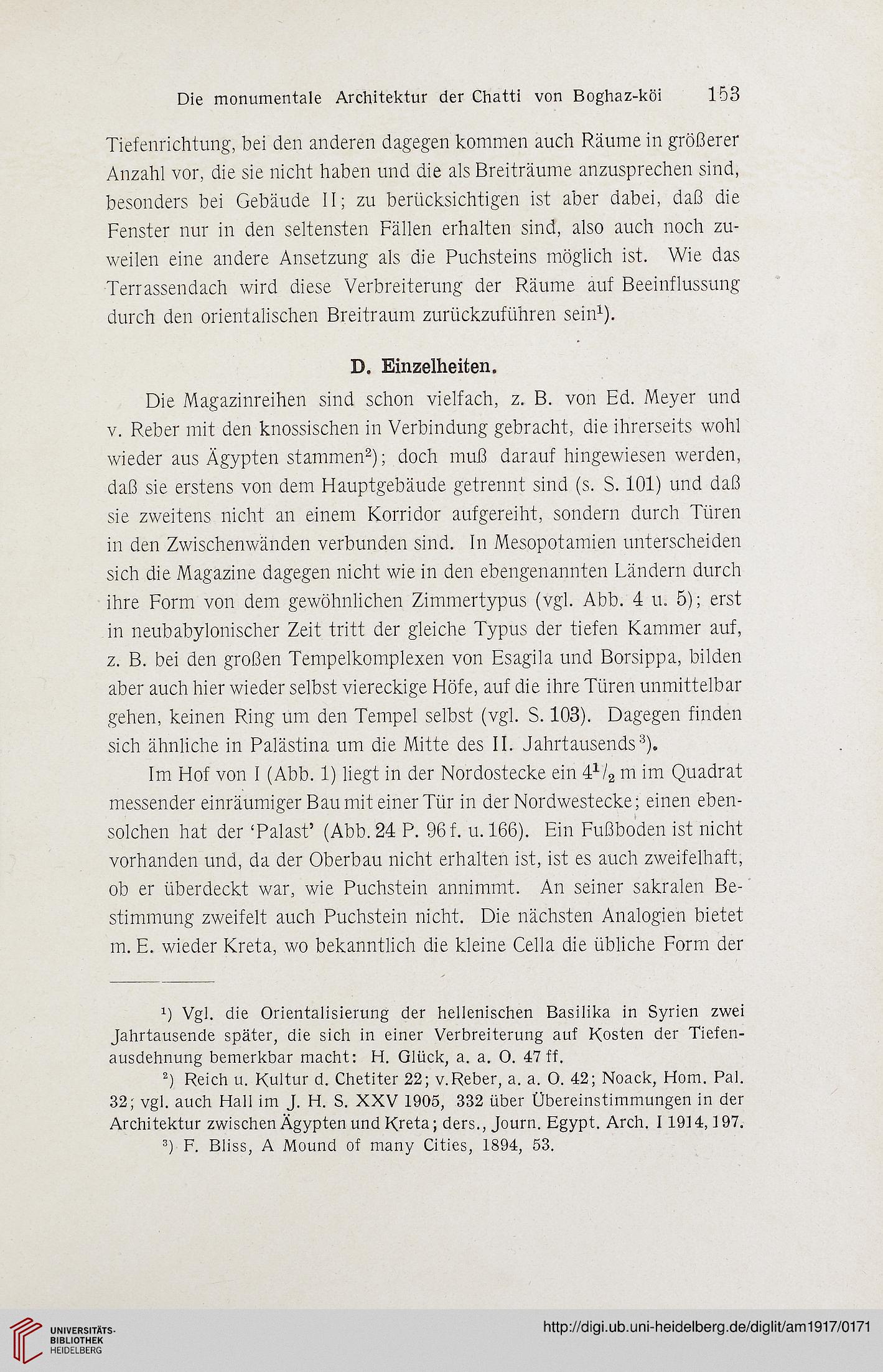Die monumentale Architektur der Chatti von Boghaz-köi
153
Tiefenrichtung, bei den anderen dagegen kommen auch Räume in größerer
Anzahl vor, die sie nicht haben und die als Breiträume anzusprechen sind,
besonders bei Gebäude 11; zu berücksichtigen ist aber dabei, daß die
Fenster nur in den seltensten Fällen erhalten sind, also auch noch zu-
weilen eine andere Ansetzung als die Puchsteins möglich ist. Wie das
Terrassendach wird diese Verbreiterung der Räume auf Beeinflussung
durch den orientalischen Breitraum zurückzuführen sein*).
D. Einzelheiten.
Die Magazinreihen sind schon vielfach, z. B. von Ed. Meyer und
v. Reber mit den knossischen in Verbindung gebracht, die ihrerseits wohl
wieder aus Ägypten stammen-); doch muß darauf hingewiesen werden,
daß sie erstens von dem Hauptgebäude getrennt sind (s. S. 101) und daß
sie zweitens nicht an einem Korridor aufgereiht, sondern durch Türen
in den Zwischenwänden verbunden sind, ln Mesopotamien unterscheiden
sich die Magazine dagegen nicht wie in den ebengenannten Ländern durch
ihre Form von dem gewöhnlichen Zimmertypus (vgl. Abb. 4 u. 5); erst
in neubabylonischer Zeit tritt der gleiche Typus der tiefen Kammer auf,
z. B. bei den großen Tempelkomplexen von Esagila und Borsippa, bilden
aber auch hier wieder selbst viereckige Höfe, auf die ihre Türen unmittelbar
gehen, keinen Ring um den Tempel selbst (vgl. S. 103). Dagegen finden
sich ähnliche in Palästina um die Mitte des H. Jahrtausends Q.
Im Hof von I (Abb. 1) liegt in der Nordostecke ein 4^/g m im Quadrat
messender einräumiger Bau mit einer Tür in der Nordwestecke; einen eben-
solchen hat der 'PalasP (Abb. 24 P. 96 f. u. 166). Ein Fußboden ist nicht
vorhanden und, da der Oberbau nicht erhalten ist, ist es auch zweifelhaft,
ob er überdeckt war, wie Puchstein annimmt. An seiner sakralen Be-
stimmung zweifelt auch Puchstein nicht. Die nächsten Analogien bietet
m. E. wieder Kreta, wo bekanntlich die kleine Cella die übliche Form der
i) Vgl. die Orientalisierung der hellenischen Basilika in Syrien zwei
Jahrtausende später, die sich in einer Verbreiterung auf Rosten der Tiefen-
ausdehnung bemerkbar macht: H. Glück, a. a. O. 47 ff.
") Reich u. Kultur d. Chetiter 22; v.Reber, a. a. 0. 42; Noack, Hom. Pal.
32; vgl. auch Hall im J. H. S. XXV 1905, 332 über Übereinstimmungen in der
Architektur zwischen Ägypten und Kreta; ders., Journ. Egypt. Arch. I 1914,197.
T F. Bliss, A Mound of many Cities, 1894, 53.
153
Tiefenrichtung, bei den anderen dagegen kommen auch Räume in größerer
Anzahl vor, die sie nicht haben und die als Breiträume anzusprechen sind,
besonders bei Gebäude 11; zu berücksichtigen ist aber dabei, daß die
Fenster nur in den seltensten Fällen erhalten sind, also auch noch zu-
weilen eine andere Ansetzung als die Puchsteins möglich ist. Wie das
Terrassendach wird diese Verbreiterung der Räume auf Beeinflussung
durch den orientalischen Breitraum zurückzuführen sein*).
D. Einzelheiten.
Die Magazinreihen sind schon vielfach, z. B. von Ed. Meyer und
v. Reber mit den knossischen in Verbindung gebracht, die ihrerseits wohl
wieder aus Ägypten stammen-); doch muß darauf hingewiesen werden,
daß sie erstens von dem Hauptgebäude getrennt sind (s. S. 101) und daß
sie zweitens nicht an einem Korridor aufgereiht, sondern durch Türen
in den Zwischenwänden verbunden sind, ln Mesopotamien unterscheiden
sich die Magazine dagegen nicht wie in den ebengenannten Ländern durch
ihre Form von dem gewöhnlichen Zimmertypus (vgl. Abb. 4 u. 5); erst
in neubabylonischer Zeit tritt der gleiche Typus der tiefen Kammer auf,
z. B. bei den großen Tempelkomplexen von Esagila und Borsippa, bilden
aber auch hier wieder selbst viereckige Höfe, auf die ihre Türen unmittelbar
gehen, keinen Ring um den Tempel selbst (vgl. S. 103). Dagegen finden
sich ähnliche in Palästina um die Mitte des H. Jahrtausends Q.
Im Hof von I (Abb. 1) liegt in der Nordostecke ein 4^/g m im Quadrat
messender einräumiger Bau mit einer Tür in der Nordwestecke; einen eben-
solchen hat der 'PalasP (Abb. 24 P. 96 f. u. 166). Ein Fußboden ist nicht
vorhanden und, da der Oberbau nicht erhalten ist, ist es auch zweifelhaft,
ob er überdeckt war, wie Puchstein annimmt. An seiner sakralen Be-
stimmung zweifelt auch Puchstein nicht. Die nächsten Analogien bietet
m. E. wieder Kreta, wo bekanntlich die kleine Cella die übliche Form der
i) Vgl. die Orientalisierung der hellenischen Basilika in Syrien zwei
Jahrtausende später, die sich in einer Verbreiterung auf Rosten der Tiefen-
ausdehnung bemerkbar macht: H. Glück, a. a. O. 47 ff.
") Reich u. Kultur d. Chetiter 22; v.Reber, a. a. 0. 42; Noack, Hom. Pal.
32; vgl. auch Hall im J. H. S. XXV 1905, 332 über Übereinstimmungen in der
Architektur zwischen Ägypten und Kreta; ders., Journ. Egypt. Arch. I 1914,197.
T F. Bliss, A Mound of many Cities, 1894, 53.